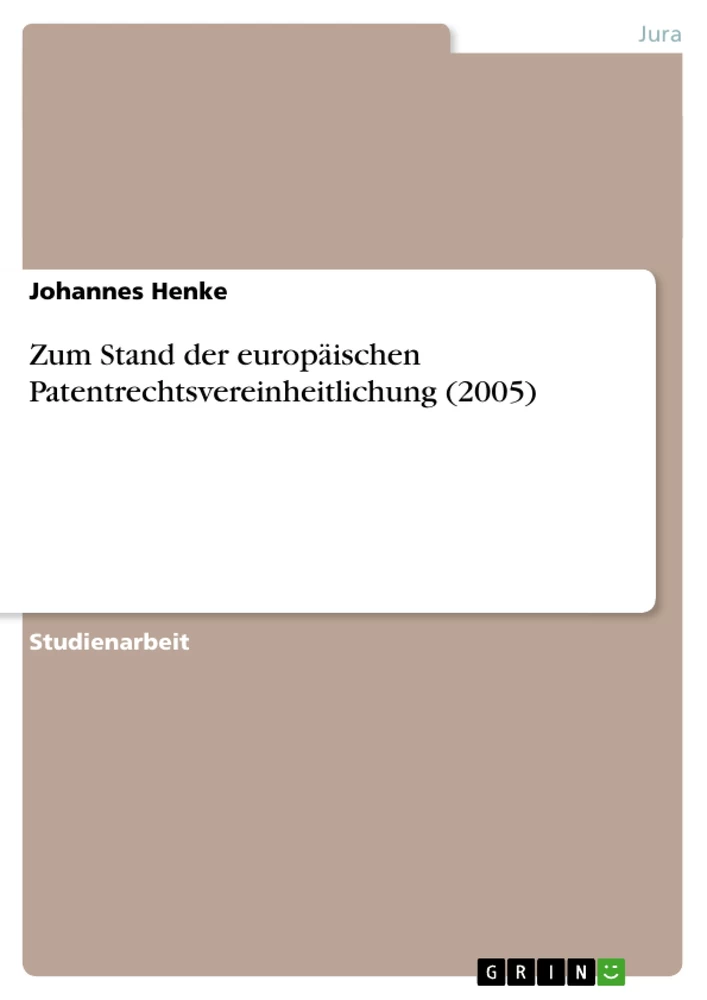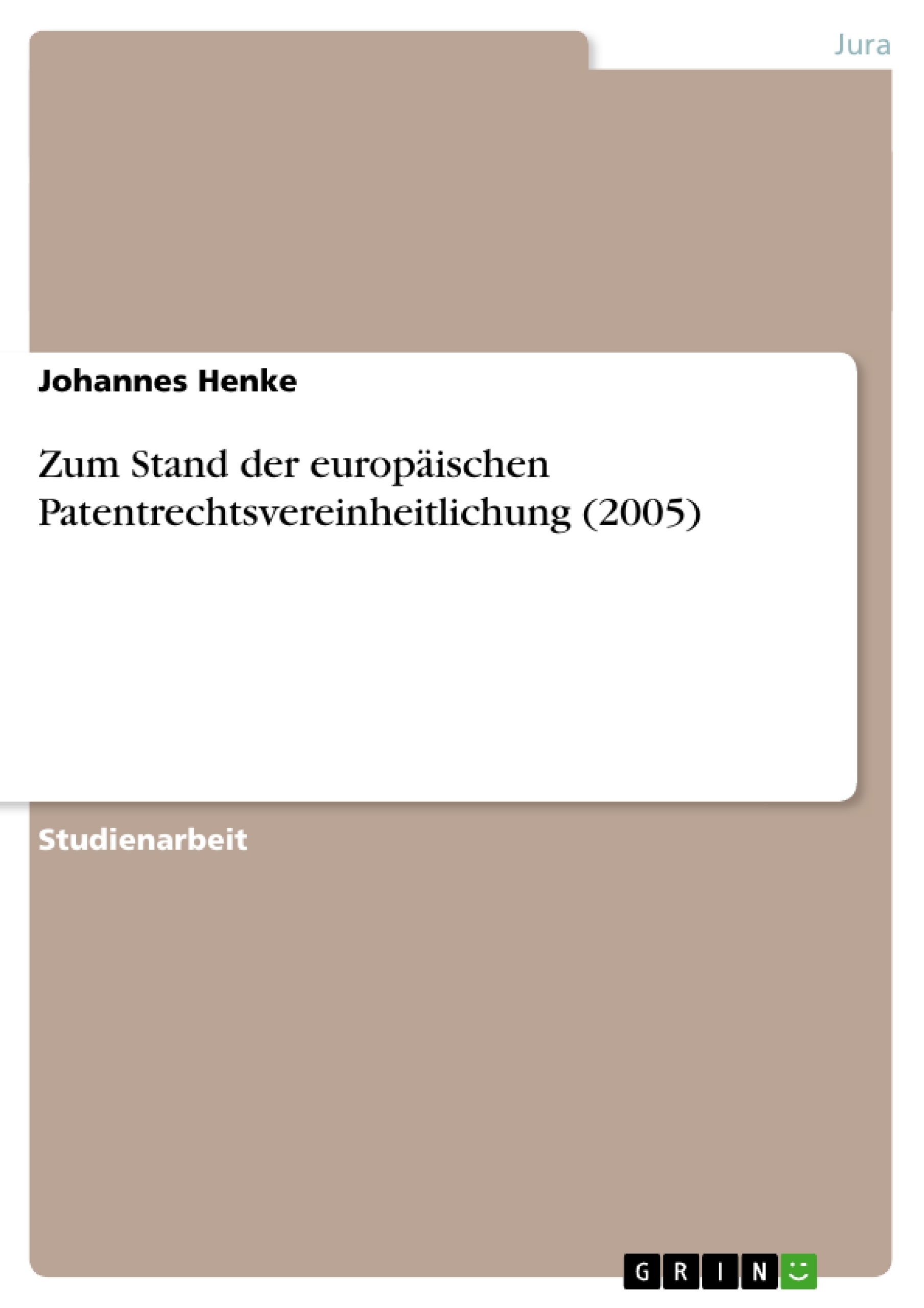Erfindungen können im Gegensatz zu körperlichen Gegenständen von einer Vielzahl von Menschen ohne Ortsbindung genutzt werden. Die Schutzwirkung in Bezug auf eine Erfindung kann sich aber nur im Rahmen der Kompetenz des jeweiligen Staates bewegen. Der Berechtigte muss also auf Grund des Territorialprinzips im jeweiligen Staat ein Schutzrecht erlangen, wo er die Erfindung verwerten möchte. Dieses System ist dazu geeignet, inländisches Gewerbe zu fördern, indem Inländer bei der Schutzverleihung bevorzugt behandelt werden. Es entfaltet Sinn, wenn man einem merkantilistischem Wirtschaftsverständnis folgt. In einer Union mit 25 Mitgliedstaaten ist dafür kein Platz. Vielmehr geht es dort um möglichst allseitige Anerkennung des vom Erfinder originär erworbenen Rechts, kurz: um eine Vereinheitlichung des Patentrechts.
Deutlich hat sich die Globalisierung in der wissensbasierten Ökonomie – vornehmlich der IT-Branche, der Telekommunikation und der Gentechnik – niedergeschlagen. Dies sind Branchen, die nicht unter den klassischen patentrechtlichen Technikbegriff fallen und zumindest teilweise vom Patentschutz ausgenommen waren. Insoweit kollidiert die dematerialisierenden Wirkung der Globalisierung mit dem Technizitätsprinzip des Patentrechts. In diesen Bereichen hat sich der patentrechtsvereinheitlichende Anpassungsbedarf stark erhöht. Die Einführung eines Gemeinschaftspatents erscheint unerlässlich, um einer Verwirklichung des Binnenmarktes näher zu kommen. Eine Einschränkung des Gesagten gebietet sich jedoch insofern, als nicht in jedem Fall ein Bedarf besteht, eine Erfindung über die Staatsgrenzen hinaus patentieren zu lassen.
Die Dimension einer Patentrechtsvereinheitlichung zeigt sich am deutlichsten, wenn man die im Zuge der Globalisierung international ausgerichtete Ökonomie mit der einzelstaatlich gefassten Organisation des Patentrechts vergleicht. Die ökonomische Endterritorialisierung steht gleichsam im Konflikt zum patentrechtlichen Territorialprinzip. Anders gewendet: Der größte Anpassungszwang folgt aus der Inkongruenz zwischen Aktivitäten der Wirtschaft und Reichweite der Patentrechtsordnungen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Die Bedeutung der Patentrechtsvereinheitlichung.
- II. Ausgestaltung des europäischen Patentschutzes in Europa.........
- B. Aktueller Stand der Patentrechtsvereinheitlichung.
- I. Staatsverträge.
- 1. Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ)...
- 2. Der \"Patent Cooperation Treaty” (PCT) ....
- 3. Das Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)
- 4. Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) .....
- 5. Das \"Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,\nIncluding Trade in Counterfeit Goods\" (TRIPS).
- II. Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) ......
- III. Richtlinien
- 1. Richtlinie 98/44/EG vom 6.7.1998 über den rechtlichen Schutz\nbiotechnologischer Erfindungen (Biotechnologierichtlinie).
- a) Vorbemerkung und Regelungsziel.
- b) Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen.
- c) Die Rolle der Ethik bei der Biotechnologierichtlinie....
- 2. Vorschlag für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter\nErfindungen.
- a) Problemstellung.......
- b) Bewertung.
- 1. Richtlinie 98/44/EG vom 6.7.1998 über den rechtlichen Schutz\nbiotechnologischer Erfindungen (Biotechnologierichtlinie).
- IV. Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent.………………………...
- 1. Notwendigkeit eines Gemeinschaftspatents
- a) Institutionelles Gefüge
- b) Sprachproblematik .
- c) Gerichtsbarkeit..
- II2. Verzögerungsgründe .
- a) Begründungsmodelle zur Rechtsintegration
- b) Nationale Interessen..
- c) Institutionelles Gefüge
- 3. Bewertung des vorgesehenen Gemeinschaftspatents.
- a) Vorteile....
- b) Nachteile.
- 4. Alternativen zum Gemeinschaftspatent
- a) Vereinheitlichung nationaler Patentrechte durch Richtlinie
- b) Wechselseitige Anerkennung nationaler Patente...
- c) Unvollkommenes Unionspatent.
- d) Flexibles Gemeinschaftspatent.
- 5. Lösungsansatz zur Sprachproblematik.
- 6. Lösungsansätze für Gerichtsbarkeit
- 1. Notwendigkeit eines Gemeinschaftspatents
- V. Ausblick...………………………………………….\n
- 1. Ausweitung der Schiedsgerichtsbarkeit ..
- 2. Umfassende Fachgerichtsbarkeit für gewerblichen Rechtsschutz.
- 3. Internationales Patentrecht..
- C. Zusammenfassung .....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der aktuellen Situation der europäischen Patentrechtsvereinheitlichung und analysiert die verschiedenen Ansätze und Herausforderungen in diesem Bereich. Sie untersucht, welche Fortschritte in der Harmonisierung des Patentrechts auf internationaler und europäischer Ebene erzielt wurden und welche Hürden es noch zu überwinden gilt.
- Die Bedeutung der Patentrechtsvereinheitlichung für die Wirtschaft und die Innovation.
- Die verschiedenen internationalen und regionalen Abkommen und Vereinbarungen im Patentrecht.
- Die Rolle der Europäischen Union bei der Harmonisierung des Patentrechts.
- Die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung und der Globalisierung im Kontext des Patentrechts.
- Die zukünftige Entwicklung des europäischen Patentrechts.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Buches führt in das Thema der Patentrechtsvereinheitlichung ein und erläutert die Relevanz dieses Bereichs. Das zweite Kapitel beleuchtet den aktuellen Stand der Patentrechtsvereinheitlichung und analysiert verschiedene internationale und regionale Abkommen, Richtlinien und Verordnungen. Es werden die zentralen Themenbereiche des Patentrechts beleuchtet, wie beispielsweise die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen oder computerimplementierter Erfindungen.
Die folgenden Kapitel befassen sich mit verschiedenen Aspekten der europäischen Patentrechtsvereinheitlichung, wie zum Beispiel der Notwendigkeit eines Gemeinschaftspatents, den Verzögerungsgründen und den möglichen Lösungen für die Sprachproblematik und die Gerichtsbarkeit. Es wird auch die Rolle der Schiedsgerichtsbarkeit und die Bedeutung der umfassenden Fachgerichtsbarkeit für gewerblichen Rechtsschutz beleuchtet.
Schlüsselwörter
Patentrechtsvereinheitlichung, europäisches Patentrecht, internationales Patentrecht, Gemeinschaftspatent, Biotechnologie, computerimplementierte Erfindungen, Richtlinie, Verordnung, Schiedsgerichtsbarkeit, Fachgerichtsbarkeit, Globalisierung, Digitalisierung, Innovation.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist eine Vereinheitlichung des europäischen Patentrechts notwendig?
In einem Binnenmarkt mit vielen Mitgliedstaaten behindern nationale Grenzen und das Territorialprinzip den Schutz von Erfindungen. Eine Vereinheitlichung fördert Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.
Was ist das Gemeinschaftspatent?
Das Gemeinschaftspatent (heute Einheitspatent) soll einen einheitlichen Schutz in allen teilnehmenden EU-Ländern durch eine einzige Anmeldung bieten.
Welche Hürden gibt es bei der Patentrechtsvereinheitlichung?
Zentrale Probleme sind die Sprachregelung (Übersetzungskosten), die Gerichtsbarkeit für Patentstreitigkeiten sowie unterschiedliche nationale Interessen.
Was regelt die Biotechnologierichtlinie?
Die Richtlinie 98/44/EG regelt den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen und setzt ethische Grenzen für die Patentierbarkeit in diesem Bereich.
Was bedeutet das Territorialprinzip im Patentrecht?
Es besagt, dass ein Patent nur in dem Staat Schutz gewährt, in dem es auch angemeldet und erteilt wurde.
- I. Staatsverträge.
- Citation du texte
- Johannes Henke (Auteur), 2005, Zum Stand der europäischen Patentrechtsvereinheitlichung (2005), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40224