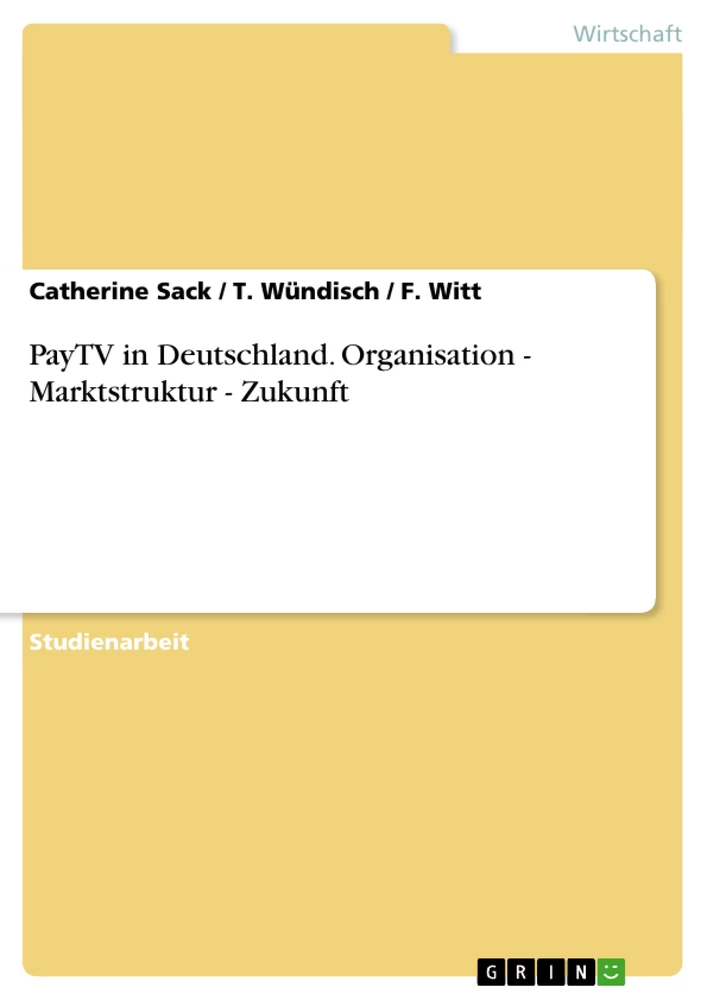Der europäische Fernsehmarkt steht nach der Jahrtausendwende an der Schwelle zum Eintritt in das digitale Zeitalter. In den kommenden zehn Jahren wird sich die schrittweise Ablösung der herkömmlichen analogen Übertragungstechnik durch die neue digitale Übertragung von Fernsehsignalen vollziehen.
Die Fernsehkonsumenten können bei einem in den letzten Jahren erheblich gestiegenen Freizeitaufkommen zwischen einer stetig wachsenden Anzahl an audiovisuellen Medien (AV-Medien) wählen, um ihre Bedürfnisse nach Unterhaltung und Information zu befriedigen. Diese Alternativen sind vor allem zu berücksichtigen, wenn über die Zahlungsbereitschaft potentieller Abonnenten von Pay-TV gesprochen werden soll.
Nicht zuletzt ist die Digitalisierung des Fernsehens auch mit einer Vielzahl an neuen Begriffen wie „Pay-per-view“, „Video-on-Demand“ oder „HDTV“ verbunden, die einer verständlichen Erklärung bedürfen, um sachgerecht angewendet werden zu können.
Pay-TV unterscheidet sich vom herkömmlichen Fernsehen hauptsächlich in seiner Finanzierungsform. Pay-TV wird direkt von den Zuschauern bezahlt. Diese haben dadurch im Gegensatz zum Free-TV die Möglichkeit, direkt über den Preismechanismus auf das Programmangebot einzuwirken. Betriebswirtschaftlich gesehen bringen die Abonnenten ihre Präferenzen für bestimmte Sendungen durch ihre Zahlungsbereitschaft zum Ausdruck. Aus rein ökonomischen Gesichtspunkten führt daher die direkte Finanzierung durch Entgelte am ehesten zu einer bedarfsgerechten Programmversorgung.
In der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, den Pay-TV Markt in Deutschland zu analysieren und Marktchancen für Newcomer zum gegenwärtigen Zeitpunkt und in Zukunft aufzuzeigen. Von Interesse ist dabei jedoch nicht nur die Zunahme von Programmvielfalt und Auswahlmöglichkeiten durch die Zuschauer, sondern vor allem auch die ökonomische Seite, ausgedrückt in der Möglichkeit zur Erwirtschaftung von Unternehmensgewinnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pay-TV
- Definition des Pay-TV
- Erscheinungsformen des Pay-TV
- Pay-per-Channel
- Pay-per-View
- Video-on-Demand
- Near Video on Demand
- Pay-TV Pakete
- Der ökonomische Wettbewerb
- Marktwirtschaftliche Einordnung
- Potentieller Wettbewerb: Markteintrittskosten und Risiko
- Die Unterschiede zwischen Free-TV und Pay-TV
- Free-TV
- Free TV Finanzierung
- Werbefinanziertes Free-TV
- Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
- Produktdifferenzierung
- Pay-TV
- Pay-TV Finanzierung
- Produktdifferenzierung
- Spartenkanäle
- Programmdifferenzierung zum Free-TV
- Rotation Scheduling
- Pay-TV als eigenständiges Medium
- Free-TV
- Kundenzufriedenheit
- Organisation des Pay-TV
- Intermediäre Wettbewerbsbeziehungen
- Nutzengründe des Pay-TV
- Gefahren für neue Pay-TV Anbieter
- Lizenzen und Rechte
- Spielfilme
- Sport
- Schutzliste
- Der relevante Markt
- Bestimmung der Marktgrenzen
- Die räumliche und zeitliche Marktabgrenzung
- Markteintrittsbarrieren
- Markteintritt
- Programmwettbewerb
- Kostenstruktur
- Programmkosten
- Akquisitionskosten
- Gemeinkosten
- Technische Systemkosten
- Kapitalkosten
- Zukunftsfähige Entwicklungen
- Video-on-Demand
- DVB - Digital Video Broadcast
- HDTV
- Premiere und HDTV
- Interaktives Fernsehen
- Software
- Software-Rechtemanagement
- Das Konvergenzkonzept
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den deutschen Pay-TV-Markt. Ziel ist es, die ökonomischen Aspekte des Pay-TV, den Wettbewerb und die zukünftige Entwicklung zu beleuchten.
- Ökonomische Analyse des Pay-TV-Marktes
- Wettbewerbsdynamik zwischen Pay-TV und Free-TV
- Markteintrittsbarrieren und -risiken
- Kundenzufriedenheit und Nutzengründe
- Zukunftsaussichten des Pay-TV im Hinblick auf technologische Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik des Pay-TV in Deutschland ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die zentralen Fragestellungen und den methodischen Ansatz der Untersuchung.
Pay-TV: Dieses Kapitel definiert Pay-TV und beschreibt seine verschiedenen Erscheinungsformen wie Pay-per-Channel, Pay-per-View, Video-on-Demand und Near Video on Demand. Es analysiert die unterschiedlichen Geschäftsmodelle und Paketstrukturen im Detail.
Der ökonomische Wettbewerb: Hier wird der Pay-TV-Markt im Kontext der Marktwirtschaft eingeordnet. Die Analyse fokussiert auf den potentiellen Wettbewerb, die Markteintrittskosten und die damit verbundenen Risiken für neue Anbieter. Die Kapitel untersucht die relevanten ökonomischen Faktoren und deren Einfluss auf den Markt.
Die Unterschiede zwischen Free-TV und Pay-TV: Dieser Abschnitt vergleicht die Finanzierungsmodelle (Werbung, Gebühren etc.), die Produktdifferenzierung und die Programmgestaltung von Free-TV und Pay-TV. Es werden die jeweiligen Stärken und Schwächen beider Modelle gegenübergestellt und deren Auswirkungen auf den Markt analysiert. Die Kapitel beleuchtet insbesondere die unterschiedlichen Strategien zur Kundenbindung.
Kundenzufriedenheit: Dieses Kapitel untersucht die Faktoren, die die Kundenzufriedenheit im Pay-TV-Bereich beeinflussen. Es analysiert die Bedeutung von Programmqualität, Service und Preisgestaltung für die Kundenbindung und die langfristige Marktentwicklung.
Organisation des Pay-TV: Hier werden die Organisationsstrukturen und die Wettbewerbsbeziehungen im Pay-TV-Markt analysiert. Die Kapitel beleuchtet die Rolle von Zwischenhändlern und die Bedeutung von Lizenzen und Rechten für die Programmgestaltung und den Marktzugang.
Spielfilme, Sport, Schutzliste: Diese Kapitel untersuchen die Bedeutung von verschiedenen Programminhalten (Spielfilme, Sport) für den Erfolg von Pay-TV Anbietern. Der Schutzliste wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet, um dessen Auswirkungen auf den Markt zu beleuchten.
Der relevante Markt: Dieses Kapitel befasst sich mit der Abgrenzung des relevanten Marktes für Pay-TV in Deutschland. Es analysiert die räumlichen und zeitlichen Marktgrenzen und untersucht die bestehenden Markteintrittsbarrieren. Die Kapitel betrachtet die Faktoren, die den Wettbewerb beeinflussen.
Markteintritt: Dieses Kapitel analysiert die Strategien und Herausforderungen für neue Anbieter, die in den Pay-TV-Markt eintreten wollen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Programmwettbewerb und den notwendigen Ressourcen für einen erfolgreichen Markteintritt.
Kostenstruktur: Hier wird die Kostenstruktur von Pay-TV-Anbietern detailliert untersucht. Die Analyse umfasst Programmkosten, Akquisitionskosten, Gemeinkosten, technische Systemkosten und Kapitalkosten. Die Kapitel beleuchtet den Einfluss der Kostenstruktur auf die Preisgestaltung und die Profitabilität.
Zukunftsfähige Entwicklungen: Dieser Abschnitt befasst sich mit den zukunftsorientierten Entwicklungen im Pay-TV-Markt, wie Video-on-Demand, DVB, HDTV und interaktivem Fernsehen. Die Kapitel beleuchtet die technischen Innovationen und deren Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle und den Wettbewerb.
Das Konvergenzkonzept: Das Kapitel untersucht das Konvergenzkonzept im Kontext von Pay-TV, welches sich auf die Zusammenführung verschiedener Medien und Technologien bezieht.
Schlüsselwörter
Pay-TV, Free-TV, ökonomischer Wettbewerb, Markteintrittsbarrieren, Kundenzufriedenheit, Programmgestaltung, Video-on-Demand, HDTV, Konvergenz, Lizenzen, Rechte, Finanzierung, Produktdifferenzierung.
Häufig gestellte Fragen zum deutschen Pay-TV-Markt
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den deutschen Pay-TV-Markt. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der ökonomischen Analyse des Marktes, dem Wettbewerb zwischen Pay-TV und Free-TV, den Markteintrittsbarrieren und der zukünftigen Entwicklung.
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Die Hauptthemen umfassen die ökonomische Analyse des Pay-TV-Marktes, die Wettbewerbsdynamik zwischen Pay-TV und Free-TV, Markteintrittsbarrieren und -risiken, Kundenzufriedenheit und Nutzengründe, sowie die Zukunftsaussichten des Pay-TV im Hinblick auf technologische Entwicklungen. Es werden verschiedene Pay-TV-Modelle (Pay-per-Channel, Pay-per-View, Video-on-Demand etc.) detailliert beschrieben und verglichen.
Wie ist der Pay-TV-Markt ökonomisch strukturiert?
Das Dokument analysiert den Pay-TV-Markt aus ökonomischer Perspektive, beleuchtet die Marktwirtschaftliche Einordnung, potentiellen Wettbewerb, Markteintrittskosten und Risiken. Es werden die Finanzierungsmodelle von Pay-TV und Free-TV verglichen (Werbung, Gebühren etc.) und die Kostenstruktur von Pay-TV-Anbietern detailliert untersucht (Programmkosten, Akquisitionskosten, Gemeinkosten etc.).
Welche Unterschiede gibt es zwischen Free-TV und Pay-TV?
Der Vergleich zwischen Free-TV und Pay-TV umfasst die Finanzierungsmodelle (Werbung vs. Gebühren), die Produktdifferenzierung (Spartenkanäle, Programmgestaltung) und die Strategien zur Kundenbindung. Die jeweiligen Stärken und Schwächen beider Modelle werden gegenübergestellt und deren Auswirkungen auf den Markt analysiert.
Welche Rolle spielt die Kundenzufriedenheit?
Die Kundenzufriedenheit wird als wichtiger Faktor für die langfristige Marktentwicklung betrachtet. Das Dokument analysiert die Einflussfaktoren auf die Kundenzufriedenheit, wie Programmqualität, Service und Preisgestaltung.
Welche Bedeutung haben Programm Inhalte wie Spielfilme und Sport?
Das Dokument untersucht die Bedeutung von verschiedenen Programminhalten, insbesondere Spielfilme und Sport, für den Erfolg von Pay-TV-Anbietern. Der Einfluss der Schutzliste auf den Markt wird ebenfalls beleuchtet.
Wie ist der relevante Markt für Pay-TV abgegrenzt?
Die Abgrenzung des relevanten Marktes für Pay-TV in Deutschland wird anhand der räumlichen und zeitlichen Marktgrenzen und der bestehenden Markteintrittsbarrieren analysiert.
Welche Herausforderungen gibt es beim Markteintritt?
Das Dokument analysiert die Strategien und Herausforderungen für neue Anbieter, die in den Pay-TV-Markt eintreten wollen, mit dem Schwerpunkt auf dem Programmwettbewerb und den notwendigen Ressourcen.
Welche zukunftsorientierten Entwicklungen werden im Dokument behandelt?
Zukunftsorientierte Entwicklungen wie Video-on-Demand, DVB, HDTV, interaktives Fernsehen und Software-Rechtemanagement werden im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle und den Wettbewerb analysiert.
Was ist das Konvergenzkonzept im Kontext von Pay-TV?
Das Dokument untersucht das Konvergenzkonzept, welches sich auf die Zusammenführung verschiedener Medien und Technologien im Bereich Pay-TV bezieht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter umfassen Pay-TV, Free-TV, ökonomischer Wettbewerb, Markteintrittsbarrieren, Kundenzufriedenheit, Programmgestaltung, Video-on-Demand, HDTV, Konvergenz, Lizenzen, Rechte, Finanzierung und Produktdifferenzierung.
- Arbeit zitieren
- Catherine Sack (Autor:in), T. Wündisch (Autor:in), F. Witt (Autor:in), 2005, PayTV in Deutschland. Organisation - Marktstruktur - Zukunft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40329