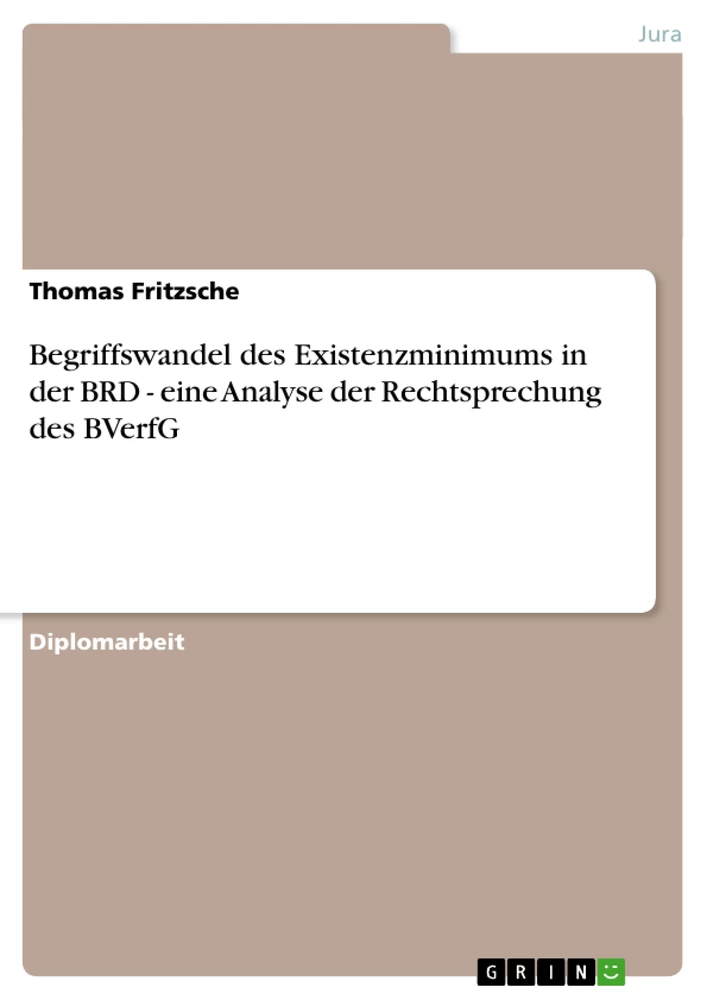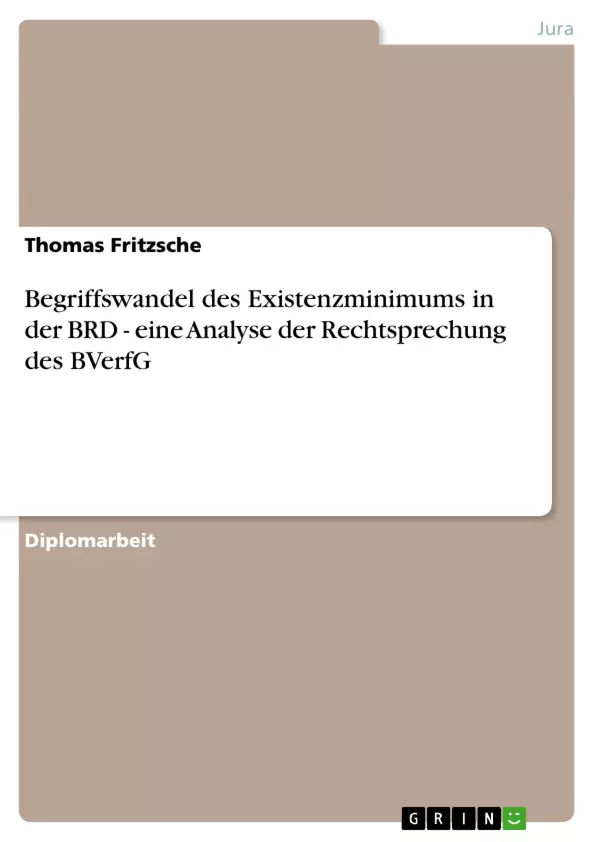Vielseitige gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen weckten in den letzten Jahren ein zunehmendes Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Thema der staatlichen Existenzsicherung. Gerade in Zeiten von hoher Arbeitslosigkeit wächst die öffentliche Diskussion darüber, wie der Staat seine Bürger vor sozialer Not und Ausgrenzung schützen soll. Dies ist auch Gegenstand dieser Arbeit. Untersucht wird die Bedeutung und Entwicklung des Existenzminimums in der Bundesrepublik Deutschland. Besondere Beachtung soll dabei die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts finden. Einführend soll die Frage geklärt werden, in wie weit überhaupt eine verfassungsmäßige Verpflichtung des Staates zur Gewährung einer Mindestsicherung besteht. Im Weiteren wird darauf eingegangen, wie die Ausgestaltung dieses Existenzminimums in der Praxis verwirklicht wird. Dabei werden exemplarisch das Sozialhilferecht und das Einkommensteuerrecht untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Existenzminimum als verfassungsmäßiges Recht?
- Das Sozialstaatsprinzip
- Der Schutz der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG)
- Der allgemeine Gleichheitssatz
- Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
- Schlussfolgerungen
- Das Existenzminimum in verschiedenen Bereichen des Rechts
- Das Existenzminimum im Sozialhilferecht
- Das BSHG
- Die Bedeutung der Regelsätze
- Bestimmung der Regelsätze und des Regelbedarfs
- Neuregelungen durch Inkrafttreten von SGB XII und SGB II
- Kritik an der Bestimmung der Regelsätze
- Würdigung der Rechtsprechung des BVerfG
- Das Existenzminimum im Einkommenssteuerrecht
- Einwirkung des Sozialhilferechts auf das Steuerrecht
- Mindestbedarf der Kinder des Steuerpflichtigen
- Mindestbedarf des Steuerpflichtigen
- Fazit
- Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die Entwicklung und Bedeutung des Existenzminimums in der Bundesrepublik Deutschland, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gelegt wird. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob eine verfassungsmäßige Verpflichtung des Staates zur Gewährung einer Mindestsicherung besteht und wie diese in der Praxis im Sozialhilferecht und im Einkommenssteuerrecht umgesetzt wird.
- Das Existenzminimum als verfassungsmäßiges Recht
- Die Bedeutung des Sozialstaatsprinzips
- Die Ausgestaltung des Existenzminimums im Sozialhilferecht
- Die Einwirkung des Sozialhilferechts auf das Einkommenssteuerrecht
- Die Rolle der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die gesellschaftliche Relevanz des Themas Existenzsicherung und führt in die Thematik der Diplomarbeit ein. Im zweiten Kapitel wird untersucht, ob eine verfassungsmäßige Verpflichtung des Staates zur Gewährung einer Mindestsicherung besteht. Dabei werden das Sozialstaatsprinzip, der Schutz der Menschenwürde und der allgemeine Gleichheitssatz betrachtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Ausgestaltung des Existenzminimums in verschiedenen Bereichen des Rechts. Im Schwerpunkt werden die Regelungen im Sozialhilferecht und im Einkommenssteuerrecht beleuchtet. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Regelsätze, die Bestimmung des Regelbedarfs und die Auswirkungen der Neuregelungen durch das SGB XII und SGB II. Schließlich wird die Kritik an der Bestimmung der Regelsätze und die Würdigung der Rechtsprechung des BVerfG zum Thema diskutiert.
Schlüsselwörter
Existenzminimum, Sozialstaatsprinzip, Menschenwürde, Gleichheitssatz, Sozialhilferecht, Einkommenssteuerrecht, BVerfG, Regelsatz, SGB XII, SGB II.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Existenzminimum in Deutschland ein verfassungsmäßiges Recht?
Ja, das Bundesverfassungsgericht leitet diesen Anspruch aus dem Schutz der Menschenwürde (Art. 1 GG) in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip ab.
Wie wird das Existenzminimum im Sozialhilferecht umgesetzt?
Dies geschieht primär über die Festlegung von Regelsätzen und den Regelbedarf nach SGB XII und SGB II (Hartz IV / Bürgergeld).
Welchen Einfluss hat das Sozialrecht auf das Steuerrecht?
Das steuerliche Existenzminimum muss sich am sozialhilferechtlichen Bedarf orientieren; Einkommen bis zur Höhe des Existenzminimums muss steuerfrei bleiben.
Was wird an der Bestimmung der Regelsätze kritisiert?
Kritikpunkte sind oft eine mangelhafte Bedarfsermittlung, die nicht ausreichende Berücksichtigung soziokultureller Teilhabe und die Berechnungsgrundlagen.
Was bedeutet der "allgemeine Gleichheitssatz" in diesem Kontext?
Er fordert, dass der Staat bei der Gewährung der Mindestsicherung alle Bürger nach gleichen Maßstäben vor Not und Ausgrenzung schützen muss.
- Citar trabajo
- Thomas Fritzsche (Autor), 2004, Begriffswandel des Existenzminimums in der BRD - eine Analyse der Rechtsprechung des BVerfG, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40370