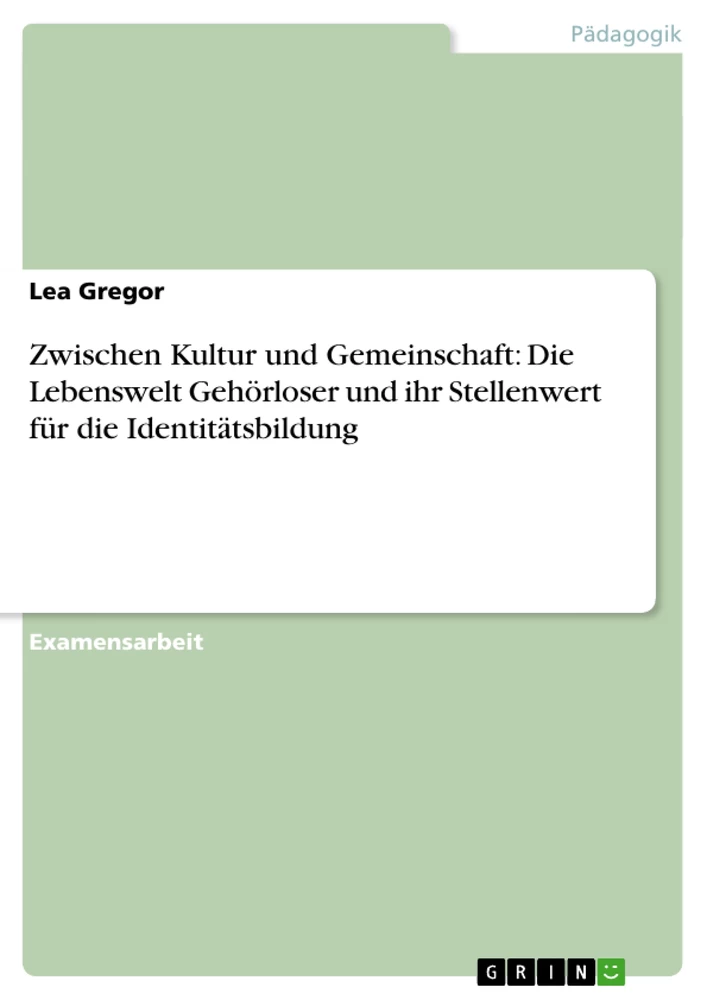Mein Nachbar ist gehörlos, Analphabet und kann weder sprechen noch gebärden, sich nur im engsten Familienkreis notdürftig verständigen. Als er mit acht Jahren in Folge einer Viruserkrankung das Gehör verlor, nahmen ihn seine Eltern aus der Schule und behielten ihn im Haus. Sie empfanden es als Schande, ein gehörloses Kind zu haben, deshalb sollte es der Öffentlichkeit möglichst verborgen bleiben. Das liegt jetzt fast sechzig Jahre zurück. Inzwischen gibt es das Bundesgleichstellungsgesetz vom 1.5.2002, das die Gebärdensprache als eigenständige Sprache anerkennt. Auch die zunehmende Präsenz von Gehörlosen in den Medien (wie z.B. in dem Film „Jenseits der Stille“, im „Tatort“ oder durch Gebärdensprachdolmetscher in der Nachrichtensendung „Phönix“ oder durch die Sendung für Gehörlose von Gehörlosen „Sehen statt Hören“) zeigt, dass sich das Bild der Gehörlosen in der Öffentlichkeit gewandelt hat. Ein Schicksal wie das meines Nachbarn ist heute in der Bundesrepublik nicht mehr vorstellbar.
Neue Erkenntnisse in der Gebärdensprach-Forschung und ein damit zusammenhängendes neues Selbstverständnis der Gehörlosen haben dazu geführt, dass Gehörlosigkeit immer häufiger nicht nur aus pathologischer Sicht betrachtet wird. Die Gehörlosen haben ein positives Selbstbewusstsein entwickelt, das das Ausmaß der Hörschädigung in den Hintergrund treten lässt. Sie sehen sich weniger als Menschen mit Behinderung, sondern vielmehr als Teil einer eigenen kulturellen Gemeinschaft.
Beobachtet man Gehörlose, die ihre Gehörlosigkeit nicht verleugnen, in einer hörenden Umgebung, z.B. eine Gruppe gebärdender junger Erwachsener im Zug, ist zu beobachten, dass sich das positive Selbstbild der Gehörlosen auch auf die Hörenden überträgt, die ihnen begegnen. Von anfänglich befremdeter Neugier wechseln die Blicke der Hörenden meist rasch zu fasziniertem Interesse, mit dem die in der Regel intensive und lebendige gebärdensprachliche Konversation verfolgt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kultur und Gemeinschaft der Gehörlosen
- Kultur
- Eine Begriffsdefinition
- Die Kultur der Gehörlosen
- Die Gehörlosengemeinschaft
- Die Zugehörigkeit zur Gehörlosengemeinschaft
- Der Gehörlosenverein
- Die kulturellen Merkmale der Gehörlosengemeinschaft
- Die Gebärdensprache
- Die Sprach- und Verhaltenskonventionen Gehörloser
- Konversationsverhalten
- Informationsaustausch
- Entscheidungen
- Namensgebärden
- Kennenlernen
- Zeit
- Die Kunst Gehörloser
- Der Stellenwert der Gehörlosengemeinschaft für die Identitätsbildung
- Identität
- Die Entwicklung der Identität bei Gehörlosen
- Die Bedeutung der Sprache
- Die individuellen Voraussetzungen
- Die Bedeutung der Gemeinschaft
- Die Konsequenzen für die pädagogische Förderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Lebenswelt Gehörloser in ihrer kulturellen Besonderheit darzustellen und die wichtige Rolle ihrer Kultur und Gemeinschaft für die Identitätsentwicklung Gehörloser in einer hörenden Welt aufzuzeigen. Sie soll Anreize dafür schaffen, dass gehörlose Kinder in der pädagogischen Förderung nicht nur auf die Integration in die Welt der Hörenden vorbereitet werden, sondern auch die Welt der Gehörlosen kennenlernen und die Möglichkeit bekommen, sich zu entscheiden, ob sie sich in beiden Welten zu Hause fühlen wollen.
- Die Gehörlosengemeinschaft als kulturelle Minderheit
- Die Bedeutung der Gebärdensprache für die Identität und Kommunikation der Gehörlosen
- Die spezifischen Verhaltenskonventionen und Traditionen der Gehörlosengemeinschaft
- Die Rolle der Gehörlosengemeinschaft für die Identitätsentwicklung Gehörloser
- Die Implikationen für die pädagogische Förderung gehörloser Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Notwendigkeit dar, die Gehörlosenkultur in der pädagogischen Förderung stärker zu berücksichtigen und den Fokus nicht nur auf die Integration in die hörende Welt zu legen.
- Kultur und Gemeinschaft der Gehörlosen: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Kultur" und beschreibt die Kultur der Gehörlosen als eigenständige kulturelle Einheit. Es befasst sich auch mit der Bedeutung der Gehörlosengemeinschaft und dem Zusammenhalt innerhalb dieser Gruppe.
- Die kulturellen Merkmale der Gehörlosengemeinschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die Gebärdensprache als zentrale Kommunikationsform der Gehörlosen und beschreibt die typischen Sprach- und Verhaltenskonventionen innerhalb der Gehörlosengemeinschaft. Die Bedeutung der Kunst für die Kultur der Gehörlosen wird ebenfalls hervorgehoben.
- Der Stellenwert der Gehörlosengemeinschaft für die Identitätsbildung: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Identität bei Gehörlosen im Kontext ihrer kulturellen Prägung und den Einfluss der Sprache und der Gemeinschaft auf diese Entwicklung.
- Die Konsequenzen für die pädagogische Förderung: Dieses Kapitel erörtert die Auswirkungen der Erkenntnisse über die Gehörlosenkultur auf die pädagogische Förderung gehörloser Kinder und skizziert Möglichkeiten, die Gehörlosenkultur in den Unterricht zu integrieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Gehörlosenkultur, Gebärdensprache, Identitätsbildung, Sprach- und Verhaltenskonventionen, Gemeinschaft, Inklusion, pädagogische Förderung und kulturelle Minderheit.
- Citation du texte
- Lea Gregor (Auteur), 2003, Zwischen Kultur und Gemeinschaft: Die Lebenswelt Gehörloser und ihr Stellenwert für die Identitätsbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40454