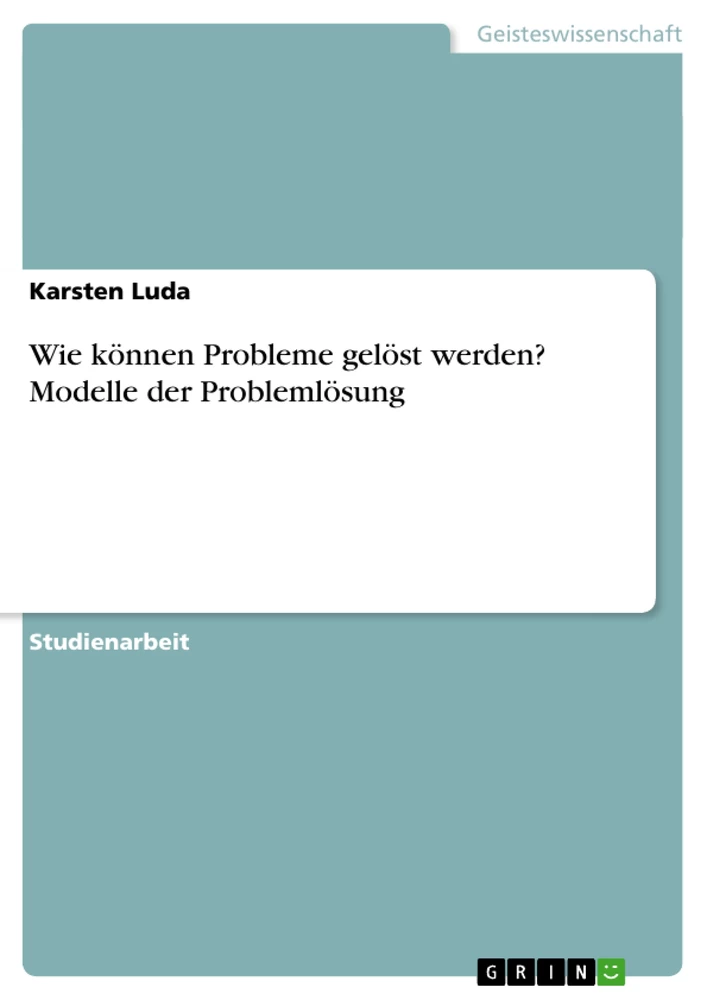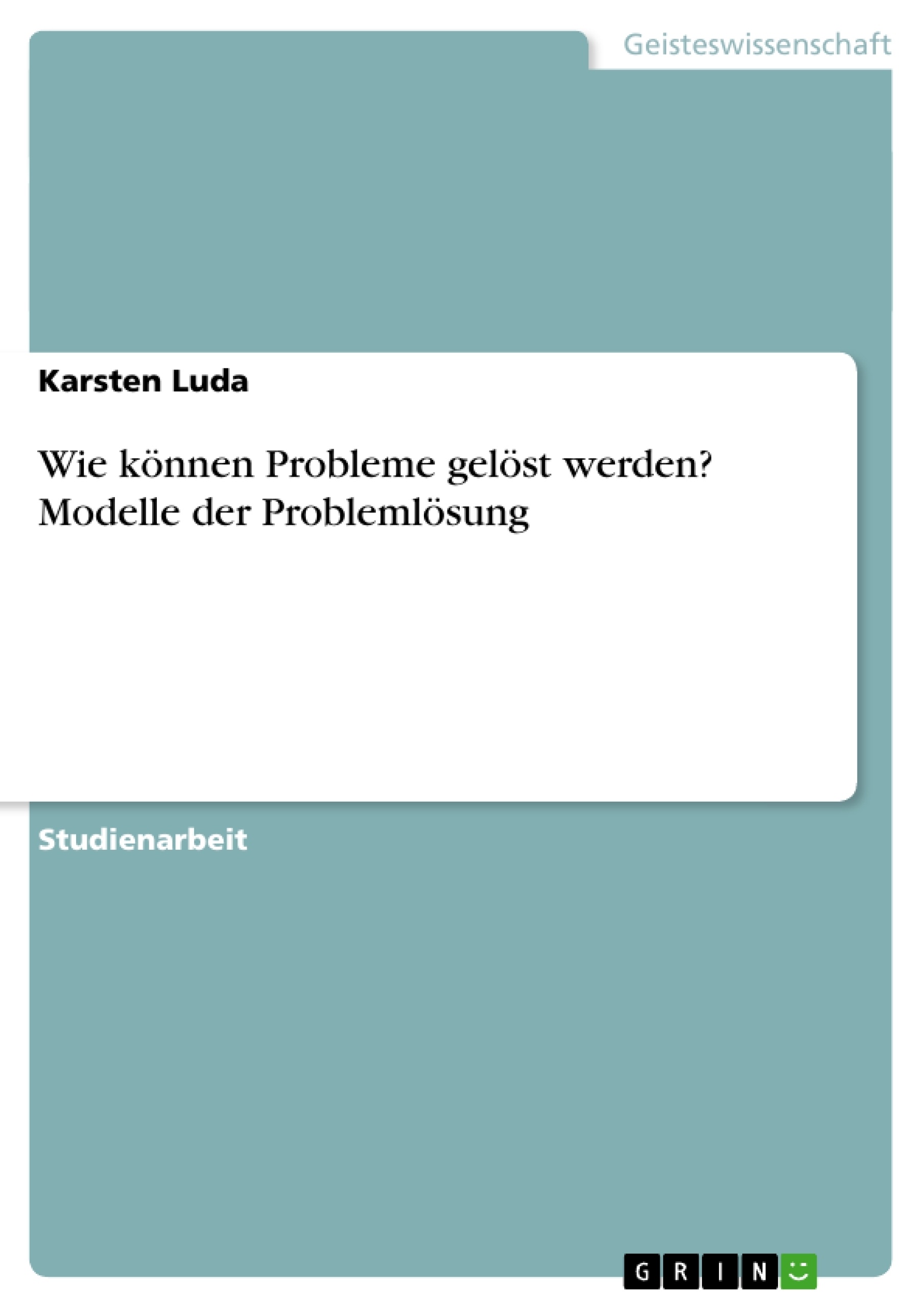Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Probleme gelöst werden können. Hierzu werden zunächst die verschiedenen Problemebenen und Einflussmöglichkeiten (die kognitive Struktur, dem Problem und Personenmerkmal, der Realitätsbereich) komplexer Problemen behandelt und anschließend die fünf, mitunter sehr komplexen Problemlösetheorien anhand von anschaulichen Beispielen vorgestellt. Am ausführlichsten wird hierbei die Problemlösetheorie „Problemlösen durch Kreativität“ behandelt, da sie die Interessanteste, weil Ungewöhnlichste aller fünf Theorien darstellt. Abschließend soll der Problemlöseprozess in ein allgemeineres, leichter Verständlicheres Ablaufmodell gebracht werden. Um einen Überblick und einen überschaubaren Einstieg in das Thema Problem/Problemlösen zu geben, werden an dieser Stelle einige Definitionen vorgestellt und anschließend auf gemeinsamen Inhalt überprüft: „Ein Problem entsteht z.B. dann, wenn ein Lebewesen ein Ziel hat und nicht weiß, wie es dieses Ziel erreichen soll“ (Duncker, 1935, S.1) „Ein Individuum steht einem Problem gegenüber, wenn es sich in einem inneren oder äußeren Zustand befindet, den es aus irgendwelchen Gründen nicht für wünschenswert hält, aber im Moment nicht über die Mittel verfügt, um den unerwünschten Zustand in einen wünschenswerten Zustand zu überführen“ (Dörner, 1979, S.10) „Eine Situation, in der die Erreichung eines Ziels nicht über ein bekanntes Handlungsmuster möglich ist. Ein Problem setzt also immer eine als wesentlich empfundene Soll- Ist-Abweichung (Abweichung des Ist-Zustandes von einem Ziel oder einer aus dem Ziel abgeleiteten Soll-Größe) voraus.“ (http://www.olev.de/p/problem.htm /15.12.04) Ein Problem ist also durch drei Komponenten gekennzeichnet: - Unerwünschter Anfangszustand - Erwünschter Zielzustand - Barriere, die die Überführung des Anfangszustandes in den Zielzustand im Augenblick verhindert
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition: Problem
- 3. Verschiedene Ebenen des Problems
- 3.1 Problem und Aufgabe
- 3.2 Die kognitive Struktur
- 3.3 Problemmerkmale und Personenmerkmale
- 3.4 Realitätsbereiche
- 4. Problemlösetheorien
- 4.1 Problemlösen durch Versuch und Irrtum
- 4.2 Problemlösen durch Umstrukturieren
- 4.3 Problemlösen durch Anwendung von Strategien
- 4.4 Problemlösen durch Kreativität
- 4.4.1 Der kreative Prozess
- 4.4.2 Die kreative Persönlichkeit
- 4.4.3 Kreativität und spezifisches Wissen
- 4.4.4 Exkurs: Kreativitätstechniken
- 4.5 Problemlösen durch Systemdenken
- 5. Der Problemlöseprozess
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht verschiedene Ansätze zur Problemlösung. Das Ziel ist es, verschiedene Ebenen von Problemen und Einflussfaktoren auf den Problemlöseprozess zu beleuchten und verschiedene Problemlösetheorien vorzustellen. Die Arbeit konzentriert sich auf ein tiefergehendes Verständnis der verschiedenen Herangehensweisen an die Bewältigung von Problemen.
- Definition und Ebenen von Problemen
- Verschiedene Problemlösetheorien
- Der Einfluss kognitiver Strukturen und Personenmerkmale auf die Problemlösung
- Der kreative Prozess als Problemlösestrategie
- Ein allgemeines Modell des Problemlöseprozesses
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Problemlösung ein und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Sie skizziert die zentralen Fragen, die behandelt werden, nämlich die verschiedenen Ebenen von Problemen und die Vorstellung verschiedener Problemlösetheorien, wobei der Schwerpunkt auf der Kreativität als Problemlösestrategie liegt. Der Fokus liegt auf der Komplexität des Themas und dem Ziel, ein umfassenderes Verständnis des Problemlöseprozesses zu entwickeln. Die Arbeit verspricht eine Analyse der Einflussfaktoren auf die Problemlösung und die Entwicklung eines vereinfachten Ablaufmodells des Prozesses.
2. Definition: Problem: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Definitionen von "Problem" aus der Literatur und untersucht deren Gemeinsamkeiten. Es werden unterschiedliche Perspektiven auf die Entstehung und Charakterisierung von Problemen vorgestellt und analysiert, um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Durch die Gegenüberstellung verschiedener Definitionen wird die Komplexität des Begriffs "Problem" herausgestellt und eine Grundlage für die weiteren Kapitel gelegt. Die verschiedenen Definitionen werden daraufhin untersucht, welche gemeinsamen Elemente sie aufweisen und welche Unterschiede sich zeigen. Dies dient der Etablierung einer Arbeitsdefinition für die weiteren Kapitel der Arbeit.
3. Verschiedene Ebenen des Problems: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Facetten, die ein Problem charakterisieren. Es differenziert zwischen Problem und Aufgabe und beleuchtet den Einfluss kognitiver Strukturen, Personenmerkmale und des Realitätsbereichs auf die Wahrnehmung und Lösung eines Problems. Die Diskussion der Aufgabenschwierigkeit und ihrer Relativität im Kontext der Expertise des Problemlösers ist ein zentraler Aspekt. Der Kapitel verdeutlicht, dass die Schwierigkeit einer Aufgabe nicht objektiv, sondern immer auch subjektiv und von den Fähigkeiten des Individuums abhängig ist. Es wird darauf hingewiesen, dass viele Probleme unbemerkt bleiben, weil die Lösung durch bekannte Handlungsmuster (Algorithmen) unterstellt wird.
4. Problemlösetheorien: Dieses Kapitel stellt verschiedene Theorien der Problemlösung vor, darunter das Problemlösen durch Versuch und Irrtum, Umstrukturieren, Anwendung von Strategien, Kreativität und Systemdenken. Es wird jeweils kurz erläutert, wie in diesen Theorien Probleme angegangen werden. Besonders ausführlich wird die Theorie des Problemlösens durch Kreativität behandelt, mit Unterkapiteln zum kreativen Prozess, der kreativen Persönlichkeit, der Rolle von spezifischem Wissen und einem Exkurs zu Kreativitätstechniken. Dies unterstreicht die Bedeutung der Kreativität im Kontext des Problemlösens und bietet einen detaillierten Einblick in die verschiedenen Aspekte dieser Problemlösestrategie.
Schlüsselwörter
Problemlösung, Problemlösetheorien, kognitive Strukturen, Personenmerkmale, Kreativität, Realitätsbereiche, Aufgabe, Algorithmus, Versuch und Irrtum, Umstrukturieren, Systemdenken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Problemlösung
Was ist der Gegenstand der Studienarbeit?
Die Studienarbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Problemlösung. Sie untersucht verschiedene Ansätze zur Problemlösung, beleuchtet verschiedene Ebenen von Problemen und Einflussfaktoren auf den Problemlöseprozess und stellt verschiedene Problemlösetheorien vor. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Verständnis der verschiedenen Herangehensweisen an die Bewältigung von Problemen und der Rolle der Kreativität.
Welche Themen werden in der Studienarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Ebenen von Problemen, verschiedene Problemlösetheorien (Versuch und Irrtum, Umstrukturieren, Strategien, Kreativität, Systemdenken), den Einfluss kognitiver Strukturen und Personenmerkmale auf die Problemlösung, den kreativen Prozess als Problemlösestrategie und ein allgemeines Modell des Problemlöseprozesses.
Wie ist die Studienarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Definition des Problems, verschiedene Ebenen des Problems (inkl. Problem vs. Aufgabe, kognitive Strukturen, Personenmerkmale, Realitätsbereiche), Problemlösetheorien (inkl. detaillierter Betrachtung der Kreativität mit Unterkapiteln zum kreativen Prozess, der kreativen Persönlichkeit, der Rolle von spezifischem Wissen und Kreativitätstechniken), der Problemlöseprozess und Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Problemlösetheorien werden vorgestellt?
Die Studienarbeit präsentiert verschiedene Problemlösetheorien, darunter das Problemlösen durch Versuch und Irrtum, Umstrukturieren, die Anwendung von Strategien, Kreativität und Systemdenken. Die Theorie des Problemlösens durch Kreativität wird besonders ausführlich behandelt.
Welche Rolle spielt die Kreativität in der Problemlösung?
Die Kreativität wird als wichtige Problemlösestrategie betrachtet. Die Arbeit analysiert den kreativen Prozess, die kreative Persönlichkeit, die Rolle von spezifischem Wissen im kreativen Prozess und gibt einen Exkurs zu verschiedenen Kreativitätstechniken.
Welche Faktoren beeinflussen den Problemlöseprozess?
Der Problemlöseprozess wird als beeinflusst durch kognitive Strukturen, Personenmerkmale und den Realitätsbereich beschrieben. Die Arbeit betont die subjektive Wahrnehmung der Aufgabenschwierigkeit und den Einfluss von Expertise.
Wie ist das Problem "Problem" definiert?
Das Kapitel "Definition: Problem" untersucht verschiedene Definitionen von "Problem" aus der Literatur und analysiert deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede, um eine Arbeitsdefinition für die weitere Arbeit zu entwickeln.
Gibt es ein Fazit oder eine Zusammenfassung?
Ja, die Arbeit enthält ein Fazit, das die zentralen Ergebnisse zusammenfasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studienarbeit?
Schlüsselwörter sind: Problemlösung, Problemlösetheorien, kognitive Strukturen, Personenmerkmale, Kreativität, Realitätsbereiche, Aufgabe, Algorithmus, Versuch und Irrtum, Umstrukturieren, Systemdenken.
- Citar trabajo
- Karsten Luda (Autor), 2005, Wie können Probleme gelöst werden? Modelle der Problemlösung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40630