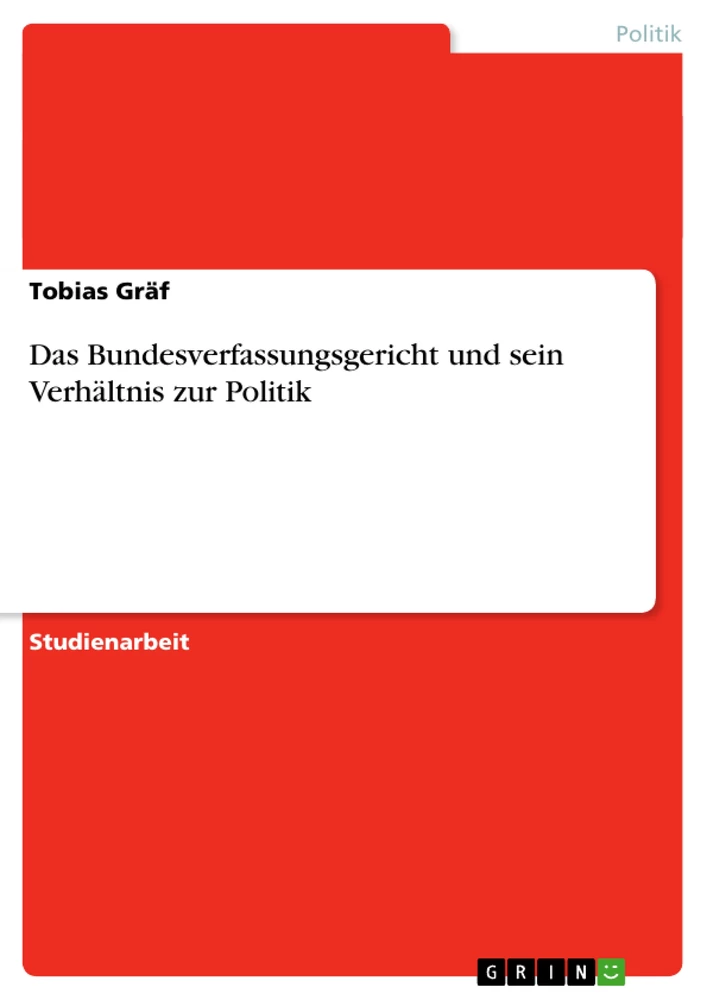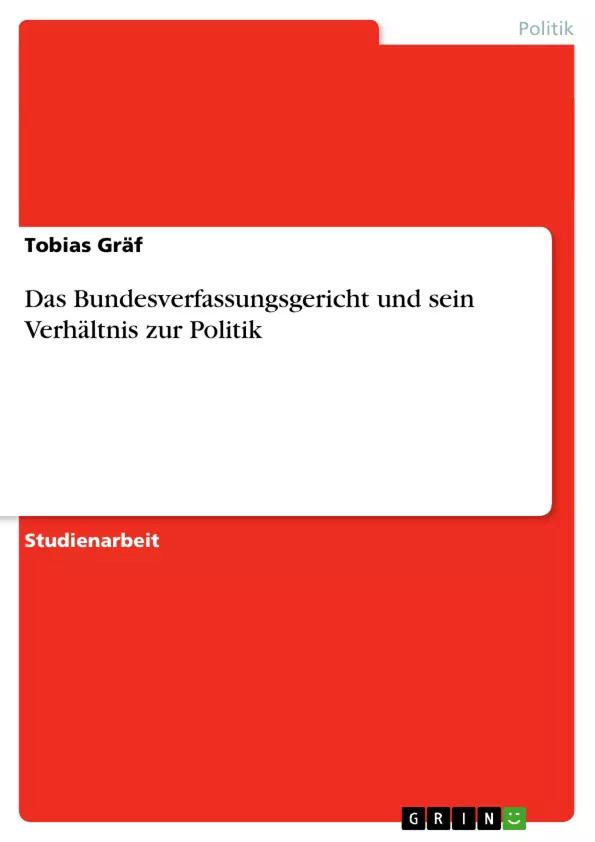Das Bundesverfassungsgericht steht seit seiner Gründung in einem Spannungsverhältnis vernichten Politik und Recht. Zumindest wird dies immer wieder behauptet. Das BVerfG ist eines der fünf obersten Verfassungsorgane und steht somit neben dem Bundespräsidenten, dem Bundestag, dem Bundesrat und der Bundesregierung. Der Vorsitzende des BVerfG ist der fünfte Mann eben Staat. Aufgabe des BVerfG ist es, über die Verfassung zu wachen.
Jedoch ist das BVerfG kein Rat, kein Ausschluss, keine Verfassungskommission oder Ähnliches. Der Hüter der Verfassung ist ein Gericht. Es urteilt über die Verfassung und deren Einhaltung bzw. Auslegung, indem es in seinem Recht spricht.
Kritiker, die Recht und Politik voneinander getrennt sehen, werfen dem BVerfG immer wieder vor, zu politisch zu sein bzw. Politik zu betreiben. Einem Gericht stehe so etwas nicht zu, denn aufgrund der Gewaltenteilung sei die Funktion des BVerfG nur die Rechtsprechung. Die Politik obliegt der Exekutiven und der Legislativen. Andererseits ist die Verfassung Grundlage aller Gesetze, und Politik wird nun mal nicht zuletzt durch Gesetze gemacht und anhand von Gesetzen ausgeführt. Die Verfassung ist also politisches Recht, und das BVerfG kommt mit seiner Rechtsprechung zwangsläufig mit der Politik in Kontakt.
Die Frage, der hier nachgegangen werden soll, lautet demnach auch, wie politisch das BVerfG denn nun eigentlich ist.
Zu diesem Zweck muss zu aller Erst geklärt sein, was Politik ist. Es werden hier verschiedene Verständnisse von Politik vorgestellt, die alle aufeinander Bezug nehmen und zu einer im Folgenden gültigen Definition verknüpft werden.
Daran anschließend wird mit Hilfe dieser Definition von Politik das BVerfG auf sein Verhältnis zur Politik überprüft. In drei Abschnitten wird analysiert, ob das BVerfG in Konkurrenz zu Bundestag und Bundesregierung steht, ob es Teil hat am Regieren bzw. an der Gesetzgebung und ob das BVerfG ein Instrument der Opposition ist. In jedem der drei Fälle wird geprüft, ob das BVerfG in diesem speziellen Fall politisch ist und in welcher Weise sich dieses politische Moment ausdrückt.
Ziel ist es, ein möglichst differenziertes Bild des BVerfG zu zeichnen, das dem Doppelcharakter dieses obersten Verfassungsorgans gerecht wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Politik
- Allgemeine Erklärung
- Politik im Sinne Aristoteles'
- Das Systemmodell von David Easton
- Rechtswissenschaftlicher Ansatz
- Zwischenbilanz
- Das Bundesverfassungsgericht und die Politik
- Das BVerfG als Konkurrenz zu Bundestag und Bundesregierung
- Der Tatbestand
- Die Analyse
- Das BVerfG und seine Teilhabe am Regieren
- Der Tatbestand
- Die Analyse
- Das BVerfG als Instrument der Opposition
- Der Tatbestand
- Die Analyse
- Das BVerfG als Konkurrenz zu Bundestag und Bundesregierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Politik. Dabei wird analysiert, inwieweit das BVerfG als ein politisch agierendes Organ betrachtet werden kann und welche spezifischen Formen seiner politischen Einflussnahme erkennbar sind.
- Die verschiedenen Definitionen des Begriffs "Politik" und ihre Relevanz für die Analyse des BVerfG
- Die Rolle des BVerfG als potenzielle Konkurrenz zu den politischen Organen Bundestag und Bundesregierung
- Die mögliche Teilhabe des BVerfG am Regieren bzw. an der Gesetzgebung
- Die Funktion des BVerfG als Instrument der Opposition
- Die Abgrenzung von Recht und Politik im Kontext der Entscheidungen des BVerfG
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und führt den Leser in das Thema des Verhältnisses zwischen dem Bundesverfassungsgericht und der Politik ein.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Begriff der Politik. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition von Politik beleuchtet, darunter die allgemeine Erklärung des Begriffs, die aristotelische Sichtweise, das Systemmodell von David Easton und der rechtswissenschaftliche Ansatz. Das Kapitel dient dazu, den Begriff "Politik" im Kontext der Untersuchung des BVerfG klar zu definieren.
Kapitel 3 analysiert das Verhältnis des BVerfG zur Politik in drei verschiedenen Dimensionen: als Konkurrenz zu Bundestag und Bundesregierung, als Teilhaber am Regieren und als Instrument der Opposition. In jedem Fall wird untersucht, ob und in welcher Weise das BVerfG politisch agiert.
Schlüsselwörter
Bundesverfassungsgericht, Politik, Recht, Gewaltenteilung, Rechtsprechung, Gesetzgebung, Verfassung, politische Einflussnahme, Konkurrenz, Teilhabe, Opposition.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Bundesverfassungsgericht ein politisches Organ?
Das BVerfG ist ein Gericht, urteilt aber über die Verfassung, die als „politisches Recht“ gilt. Es steht daher zwangsläufig in Kontakt mit der Politik, auch wenn es rein rechtlich urteilt.
Wie wird Politik in dieser Arbeit definiert?
Die Arbeit verknüpft verschiedene Ansätze, darunter die Sichtweisen von Aristoteles, das Systemmodell von David Easton und rechtswissenschaftliche Definitionen.
Steht das BVerfG in Konkurrenz zum Bundestag?
In gewisser Weise ja, da das Gericht Gesetze für verfassungswidrig erklären kann und somit die Entscheidungsautonomie der Legislative einschränkt.
Wird das BVerfG von der Opposition instrumentalisiert?
Die Opposition nutzt das BVerfG oft als Instrument, um Regierungsentscheidungen verfassungsrechtlich prüfen zu lassen, was dem Gericht eine politische Dimension verleiht.
Hat das BVerfG Teilhabe am Regieren?
Durch seine Urteile setzt das Gericht oft Rahmenbedingungen für künftige Gesetze und nimmt somit indirekt Einfluss auf die politische Gestaltung und das Regieren.
- Quote paper
- Tobias Gräf (Author), 2005, Das Bundesverfassungsgericht und sein Verhältnis zur Politik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40634