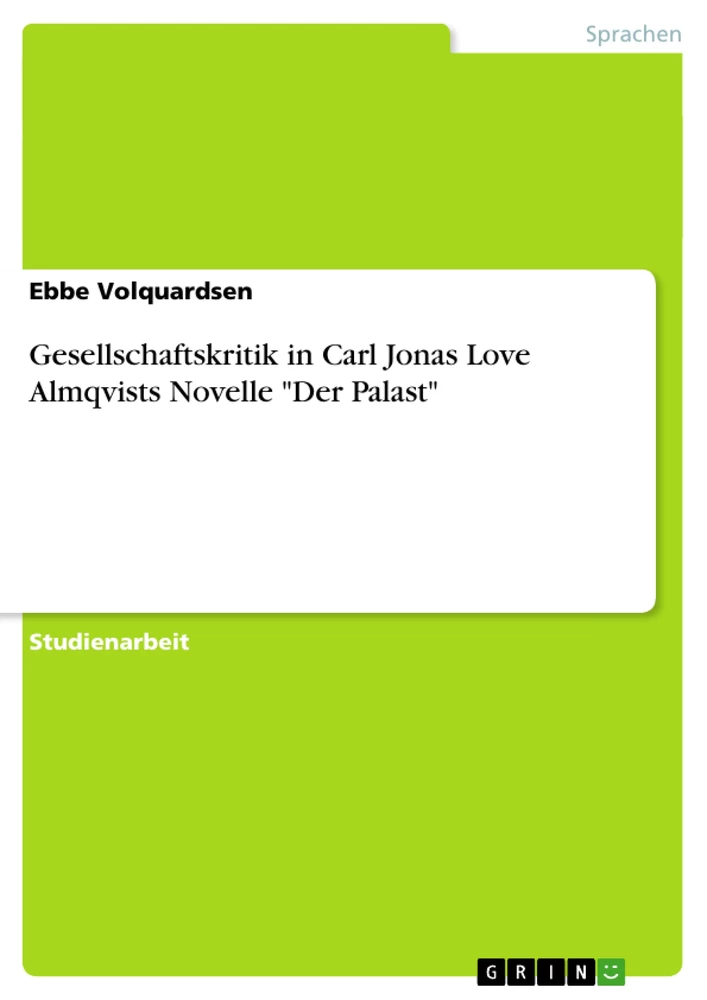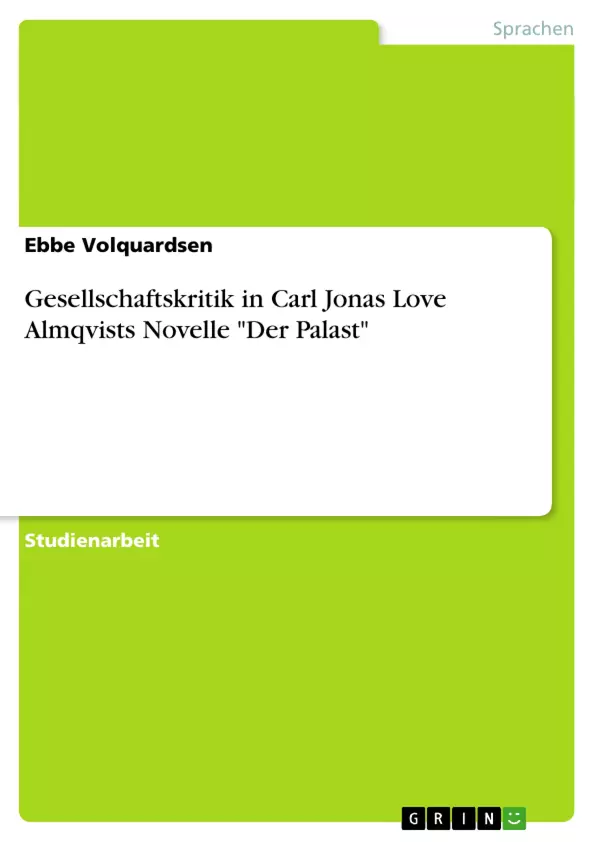Will man eine literaturwissenschaftliche Arbeit verfassen, so empfiehlt sich zunächst die Einordnung des zu behandelnden Verfassers in eine literarische Epoche. Im Falle des schwedischen Autoren Carl Jonas Love Almqvist (1793 – 1866) ist das aber nicht ganz einfach. So schreibt Artur Lundkvist: „Många har haft svårt for at se någon enhet i Almqvists diktning […]“. Während unstrittig ist, dass die früheren Werke Almqvists zur schwedischen Neuromantik zählen und seine späteren Schriften eher in die Epoche des Realismus fallen, gibt es in seiner mittleren Schaffensperiode Werke, bei denen diese Zuordnung sich nicht eindeutig treffen lässt. Folke Isaksson spricht daher über Almqvist als „en gränsgestalt mellan två huvudströmningar i svensk litteratur“. Die 1837 erstmals veröffentliche Novelle „Der Palast“ ist sicherlich ein solcher Grenzfall, über dessen epochale Einordnung sich die Literaturwissenschaftler nicht einig sind. So nennt Fritz Paul Almqvists Novelle ein romantisches Gesamtkunstwerk und hebt in Anlehnung an die Werke Edgar Allan Poes deren schauerromantische Grundstimmung hervor. Bertil Romberg stellt hingegen fest, dass „också etnografiska och sociala frågor markeras“, was wiederum eher für eine Einordnung der Novelle in die realistische Epoche sprechen würde, die schließlich als Antwort der Literatur auf die in Europa aufkommenden politischen Strömungen der Zeit wie Liberalismus und Sozialismus gesehen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politisch-historischer Hintergrund
- Textanalyse
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Analyse von Carl Jonas Love Almqvists Novelle „Der Palast“ und untersucht, inwieweit das Werk als sozial- und gesellschaftskritisches Werk gedeutet werden kann. Es wird untersucht, wie die offene Schilderung gesellschaftlicher Missstände in der ersten Hälfte der Novelle in Bezug auf die Epoche des Vormärz der europäischen Revolution von 1848 zu verstehen ist. Darüber hinaus wird auf die allegorischen und parabolischen Stellen in der zweiten Hälfte der Novelle eingegangen, um die Kritik des Protagonisten am japanischen Harakiri-Ritual zu deuten.
- Einordnung der Novelle in die literarische Epoche (Romantik vs. Realismus)
- Analyse der Darstellung gesellschaftlicher Missstände
- Deutung des Harakiri-Rituals und seiner symbolischen Bedeutung
- Die Rolle von Almqvist als sozialkritischer Autor
- Der Einfluss der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in Europa auf die schwedische Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Frage nach der Einordnung von Almqvists Werk in die literarische Epoche. Der zweite Abschnitt beleuchtet den politisch-historischen Hintergrund der Novelle und zeigt die Einflüsse der Französischen Revolution, der Julirevolution von 1830 und der anschließenden Veränderungen in der schwedischen Gesellschaft auf.
Der dritte Abschnitt, die Textanalyse, untersucht die Darstellung von Armut und soziale Missstände in der ersten Hälfte der Novelle und analysiert die symbolische Bedeutung des Harakiri-Rituals in der zweiten Hälfte. Der Abschnitt fokussiert auf die Frage, ob Almqvists „Palast“ eher als romantisches oder realistische Werk zu interpretieren ist.
Schlüsselwörter
Carl Jonas Love Almqvist, „Der Palast“, Romantik, Realismus, Sozialkritik, Gesellschaft, Harakiri, Vormärz, Europäische Revolution von 1848, Schweden, Literaturgeschichte, Allegorie, Symbol.
Häufig gestellte Fragen
In welche Epoche lässt sich Carl Jonas Love Almqvist einordnen?
Almqvist gilt als Grenzgänger zwischen der schwedischen Neuromantik und dem Realismus, wobei seine Novelle "Der Palast" Merkmale beider Epochen vereint.
Worum geht es in der Novelle "Der Palast"?
Das Werk schildert in der ersten Hälfte offen gesellschaftliche Missstände und Armut, während die zweite Hälfte allegorische Elemente wie ein japanisches Harakiri-Ritual nutzt.
Welche Gesellschaftskritik übt Almqvist?
Er kritisiert soziale Ungerechtigkeit und veraltete Traditionen, beeinflusst durch die politischen Strömungen des Liberalismus und Sozialismus im Europa des Vormärz.
Was symbolisiert das Harakiri-Ritual im Text?
Das Ritual dient als Parabel für die Kritik an starren gesellschaftlichen Normen und wird in der Arbeit im Kontext der Identitäts- und Sozialkritik gedeutet.
Wie beeinflusste die europäische Revolution von 1848 das Werk?
Obwohl die Novelle 1837 erschien, spiegelt sie bereits die aufkommenden Unruhen und den Wunsch nach gesellschaftlicher Transformation wider, die 1848 ihren Höhepunkt fanden.
- Citation du texte
- Ebbe Volquardsen (Auteur), 2003, Gesellschaftskritik in Carl Jonas Love Almqvists Novelle "Der Palast", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40747