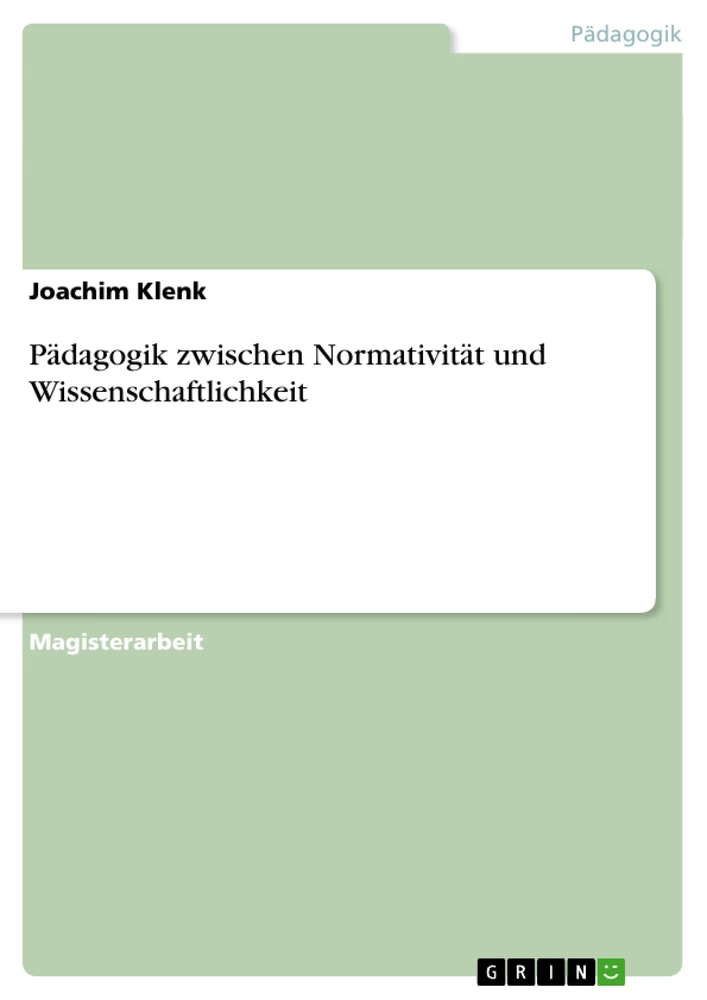Sieht man sich den Prozess der Ausdifferenzierung der Wissenschaften an, ist ein Ringen um ein zweifaches Anliegen nachzuzeichnen: Die Grenzen und Möglichkeiten der menschlichen Erkenntnisfähigkeit zu bestimmen, und die Zuständigkeitsbereiche der Erkenntnisformen und deren Methoden voneinander abzugrenzen.
Was jedoch, wenn die Vernunft auf diesem Wege nicht nur vor den „Gerichtshof der Vernunft“ , sondern schlussendlich auf das Schafott der Wissenschaften gelangt? Was bedeutet ein Wissenschaftsverständnis für die Welt, das einen nicht unerheblichen Teil aller möglichen Fragen, u. a. Fragen nach dem Sollen des Menschen, zunächst nur methodisch ausblendet, ihn dann aber durch den eigenen Fortschritt für überwunden und somit obsolet erklärt, ihn zur spekulativen Metaphysik abstempelt, derer man sich tunlichst zu enthalten habe?
Was ist von einer Wissenschaft zu halten, die, um ihrer selbstgesetzten präskriptiven Standards Willen, sich normativer Aussagen enthält, sich aber auch jeder Verantwortung für ihr Handeln und Denken entzieht?
Und wie kommen Generationen ohne Kommunikation dieser lästigen Fragen aus, weil sie in Vergessenheit geraten sind, denn, „worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen“.
Spätestens an dieser Stelle tritt die pädagogische Dimension des beschriebenen Dilemmas zutage. Kann pädagogisches Denken diese lästigen Sollens-Fragen ignorieren, um in der Familie der Wissenschaften willkommen zu sein oder gibt es eine Lesart von Normativität, die es pädagogischem Denken erlaubt, Sollens-Fragen zu stellen und normative Antworten zu geben, und dennoch Wissenschaft zu bleiben?
Mit anderen Worten: Kann pädagogisches Denken und Handeln ethische Fragen an „Ethikkommissionen“ delegieren? Kann es dem Pädagogen genügen, sich durch eine Art „pädagogischen Eid“ moralisch abzusichern? Oder muss „die Pädagogik“ sich gleichsam mit dem Hut in den Ring werfen, um das ihr immanente Wesen zu erreichen, dann aber um den Preis, dem etablierten Wissenschaftsverständnis nicht zu entsprechen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Abklärung über Aufklärung“ oder von der Verabschiedung des Normativitätsproblems in der Postmoderne
- Vom „Projekt der Aufklärung“
- Naturwissenschaft und Empirie
- Geistes- und Sozialwissenschaften
- Positivismus
- Hermeneutik
- Von der „,Dialektik der Aufklärung”
- Vom Erbe der Philosophie
- Vom Ende der großen Erzählungen
- ,,Revision der Moderne” oder von der Normativität des Faktischen zur Faktizität der Normativität
- Transzendentalphilosophie
- Vom Bürger zweier Welten
- Die sensible Welt des Seins in Ansehung der Natur der Dinge und der Gebrauch der ,,spekulativen” Vernunft
- Die intelligible Welt des Sollens bzw. Handelns in Ansehung der Freiheit des Menschen und der Gebrauch der „praktischen“ Vernunft
- Von der Freiheit bei dem Zwange
- Urteilskraft und Primat der praktischen Vernunft
- „Aufklärung ohne Ende“ oder „normative“ Pädagogik als „Prinzipien-wissenschaft”
- Prinzipien
- Exkurs: Immanuel Kant: Über Pädagogik
- Pädagogik als Wissenschaft
- Pädagogik und Philosophie
- Von der ,,Natur des Ich”
- Pädagogik und Empirie
- Pädagogik als Profession
- Vom pädagogischen Takt
- Pädagogen zwischen Engagement und Distanzierung
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen Normativität und Wissenschaftlichkeit in der Pädagogik. Sie analysiert die historische Entwicklung des Wissenschaftsverständnisses im Kontext der „Aufklärung“ und der „Postmoderne“ und hinterfragt die Rolle von Normativität in diesem Zusammenhang. Dabei wird das Ziel verfolgt, ein wissenschaftliches Modell der Welterschließung zu entwickeln, das die Möglichkeit von normativen Aussagen in der Pädagogik ermöglicht, ohne die Wissenschaftlichkeit zu gefährden.
- Das „ungelöste Normativitätsproblem der Pädagogik“ im historischen Kontext
- Die Bedeutung von Normativität im Wandel des Wissenschaftsverständnisses
- Entwicklung eines wissenschaftlichen Modells der Welterschließung, das die Möglichkeit von normativen Aussagen in der Pädagogik ermöglicht
- Bedeutung und Relevanz von „praktischer Vernunft“ und „Urteilskraft“ für die pädagogische Praxis
- Abgrenzung der Pädagogik von anderen Wissenschaften durch die Hinwendung zu genuin pädagogischen Gegenständen und Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik des Normativitätsproblems in der Pädagogik ein und stellt die zentrale Frage nach der Möglichkeit von normativen Aussagen im Kontext der Wissenschaftlichkeit. Sie verdeutlicht die Herausforderungen, die sich aus der Abgrenzung von normativen und deskriptiven Aussagen ergeben und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- „Abklärung über Aufklärung“ oder von der Verabschiedung des Normativitätsproblems in der Postmoderne: Dieses Kapitel analysiert die Geschichte des Wissenschaftsverständnisses im Kontext der Aufklärung und der Postmoderne. Es beleuchtet die Entwicklung von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften und die damit einhergehenden Veränderungen in der Bedeutung von Normativität.
- ,,Revision der Moderne” oder von der Normativität des Faktischen zur Faktizität der Normativität: Dieses Kapitel stellt die Grundzüge der Transzendentalphilosophie dar und erörtert die Bedeutung von „praktischer Vernunft“ und „Urteilskraft“ für die Möglichkeit von normativen Aussagen. Es argumentiert, dass Normativität nicht nur als ein „Sollens-Problem“, sondern auch als „Sein-Problem“ verstanden werden kann.
- „Aufklärung ohne Ende“ oder „normative“ Pädagogik als „Prinzipien-wissenschaft”: Dieses Kapitel entwickelt einen Begriff der „normativen Pädagogik“, die auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Modells der Welterschließung normativen Aussagen ermöglicht. Dabei werden die Prinzipien und Methoden dieser „Prinzipien-Wissenschaft“ erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Themen wie Normativität, Wissenschaftlichkeit, Aufklärung, Postmoderne, Transzendentalphilosophie, „praktische Vernunft“, „Urteilskraft“, Pädagogik als Prinzipien-Wissenschaft, pädagogisches Modell der Welterschließung, pädagogische Praxis. Diese Themen werden in einem historischen Kontext betrachtet und analysiert, um das Wesen und die Möglichkeit von normativen Aussagen in der Pädagogik zu ergründen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernproblem der Pädagogik zwischen Normativität und Wissenschaftlichkeit?
Es geht um die Frage, ob pädagogisches Denken "Sollens-Fragen" (normative Aussagen) stellen darf, ohne seinen Status als Wissenschaft zu verlieren, da moderne Wissenschaft oft nur deskriptive Fakten anerkennt.
Welche Rolle spielt Immanuel Kant in dieser Arbeit?
Die Arbeit nutzt Kants Transzendentalphilosophie, insbesondere die Begriffe der "praktischen Vernunft" und der "Urteilskraft", um eine Basis für normative pädagogische Aussagen zu finden.
Was bedeutet "Pädagogik als Prinzipienwissenschaft"?
Es ist ein Modell, das Pädagogik als eine Wissenschaft definiert, die auf grundlegenden Prinzipien basiert und sowohl empirische als auch philosophisch-normative Aspekte integriert.
Wie wird Normativität in der Postmoderne betrachtet?
Das Kapitel zur Postmoderne analysiert das "Ende der großen Erzählungen" und die Tendenz, normative Fragen als spekulativ oder obsolet auszublenden.
Kann Pädagogik ethische Fragen an Ethikkommissionen delegieren?
Die Arbeit hinterfragt kritisch, ob es ausreicht, Moral zu delegieren, oder ob die Pädagogik selbst eine inhärente normative Dimension bewahren muss, um ihrem Wesen gerecht zu werden.
- Citar trabajo
- Joachim Klenk (Autor), 2005, Pädagogik zwischen Normativität und Wissenschaftlichkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40758