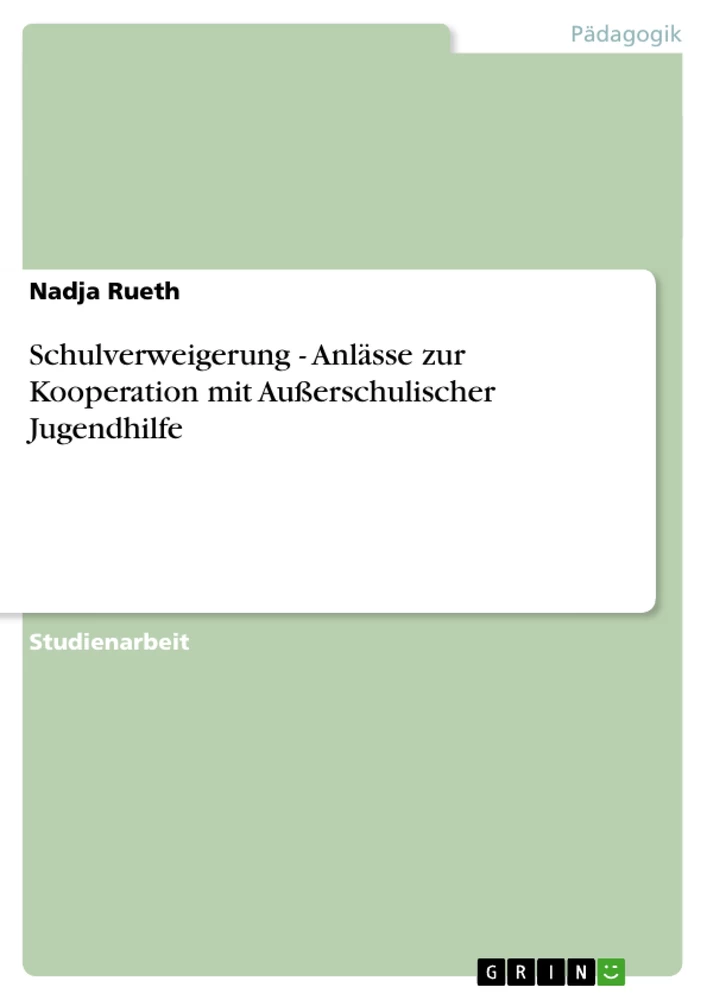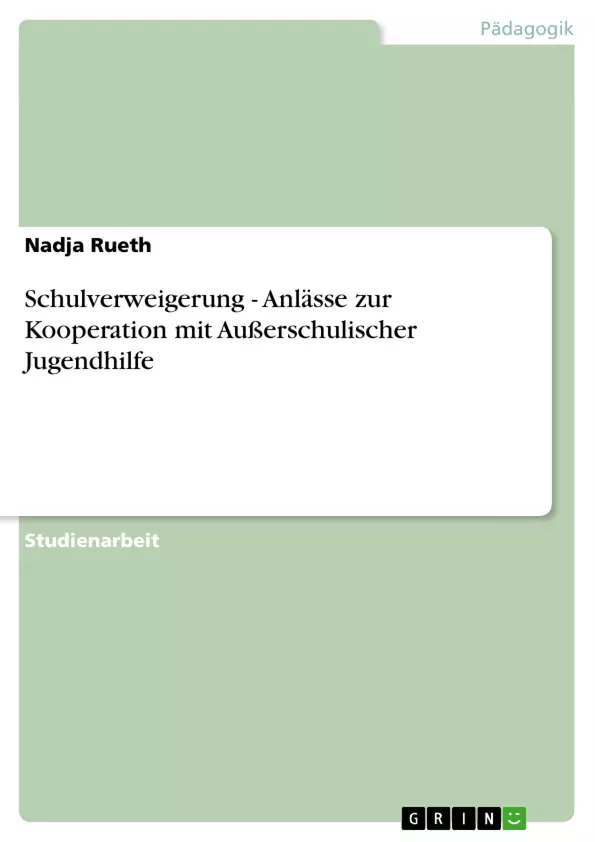Das Thema Schulschwierigkeiten und Schulverweigerung dürfte eigentlich fast jedem geläufig sein. Entweder man hat es schon am eigenen Leib durch die eigenen Kinder erfahren oder man wurde durch Presse und Medien darauf aufmerksam gemacht. Denn wir haben es bei diesem Thema nicht mit einem vorübergehenden Phänomen zu tun, sondern mit einem mittlerweile sozial gesellschaftlichen Problem, dem die Institution Schule allein nicht mehr gewachsen ist. Denn, um auf die veränderten gesellschaftlichen Strukturen einzugehen, ist unser Schulsystem zu starr und zu traditionell verhaftet. Deshalb müssen außerschulische Einrichtungen der Jugendhilfe der Schule tatkräftig unter die Arme greifen. Dazu ist es sehr wichtig, dass Schule und Jugendhilfe miteinander arbeiten, denn ohne diese Kooperation wird die Minderung oder Abschaffung von Schulverweigerung wohl kaum realisierbar sein.
Unsere Regierung scheint begriffen zu haben, dass wir es mit einem schwerwiegenderem Problem zu tun haben und versucht Strategien zu entwickeln, um der Schulverweigerung Abhilfe zu verschaffen. So wird es zum Beispiel den Schulschwänzern mit Hilfe der Polizei nicht mehr so leicht gemacht. Denn die Polizei fahndet nach Schulschwänzern, indem sie Jugendliche aufgreift, die zur eigentlichen Schulzeit auf öffentlichen Plätzen herumlungern oder sie sucht das Zuhause von längerfristig fehlenden Schülern auf.
Doch es reicht nicht aus, den Schwänzern nachzugehen und sie wieder in die Schule zu führen. Hinter dieser Verweigerung steckt noch viel mehr als nur mal keine Lust auf Unterricht zu haben oder einer Klausur auszuweichen. Manche Kinder und Jugendliche haben sogar eine Phobie und bedürfen therapeutischer Hilfe. Andere Heranwachsende kämpfen mit den zusätzlichen Belastungen wie schwierige Familienverhältnisse, schlechte Deutschkenntnisse oder Hänseleien durch Mitschüler. Zudem kommt noch der starke Leistungsdruck unseres Schulsystems, dem sehr viele Schüler nicht gewachsen sind. Außerdem ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt sowieso schlecht, so dass sich die meisten Hauptschüler fragen, warum sie überhaupt noch in die Schule gehen sollen und einen Abschluss erwerben sollen. Denn danach stehen sie höchstwahrscheinlich arbeitslos auf der Straße, also weshalb die Mühen und sich durch den meist als langweilig empfundenen Unterricht quälen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erscheinungsformen von Schulverweigerung und unregelmäßigem Schulbesuch
- Verschiedene Formen des Phänomens Schulversäumnis
- Passive und aktive Schulverweigerung
- Schulphobie
- Ursachen und Hintergründe für Schulverweigerung
- Schulische Gegebenheiten
- Familiäre Bedingungen
- Weitere Ursachen
- Verschiedene Ansätze zur Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
- Projektarbeit von Jugendhilfeträgern
- Projektbeispiel des ABC Bildungs- und Tagungszentrums
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Problem der Schulverweigerung und dem unregelmäßigen Schulbesuch. Ziel ist es, die verschiedenen Erscheinungsformen, Ursachen und Hintergründe des Phänomens zu beleuchten und verschiedene Ansätze zur Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, die die Institution Schule und das deutsche Schulsystem im Umgang mit Schulverweigerung erleben.
- Erscheinungsformen von Schulverweigerung und unregelmäßigem Schulbesuch
- Ursachen und Hintergründe für Schulverweigerung
- Zusammenspiel von schulischen und familiären Faktoren
- Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
- Notwendigkeit von Interventionen und Unterstützung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Schulschwierigkeiten und Schulverweigerung ein und stellt die Problematik als gesellschaftliches Problem dar, dem die Schule allein nicht mehr gewachsen ist. Es wird die Notwendigkeit der Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe betont.
Erscheinungsformen von Schulverweigerung und unregelmäßigem Schulbesuch
Dieses Kapitel definiert den Begriff des unregelmäßigen Schulbesuchs und beleuchtet die verschiedenen Formen des Phänomens Schulversäumnis, wie z.B. Schulmüdigkeit, Schulverdrossenheit und Schulabsentismus. Es werden die Unterschiede zwischen Schulschwänzen und Schulverweigerung sowie die Sonderform der Schulphobie beschrieben. Das Kapitel betont die Bedeutung der Intensität des Fehlens und die unterschiedlichen Bewertungen durch die Schule und die Gesellschaft.
Ursachen und Hintergründe für Schulverweigerung
Dieses Kapitel untersucht die Ursachen und Hintergründe für Schulverweigerung. Es werden schulische, familiäre und weitere Ursachen beleuchtet, wie z.B. schlechte Deutschkenntnisse, Hänseleien, Leistungsdruck und schwierige Familienverhältnisse. Der Einfluss der Lage auf dem Arbeitsmarkt und die Überlastung der Lehrer werden ebenfalls betrachtet.
Verschiedene Ansätze zur Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze zur Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe im Kontext der Schulverweigerung. Es werden Beispiele für Projektarbeit von Jugendhilfeträgern und ein konkretes Projektbeispiel des ABC Bildungs- und Tagungszentrums vorgestellt.
Schlüsselwörter
Schulverweigerung, Schulabsentismus, Schulschwänzen, Schulphobie, Jugendhilfe, Kooperation, Schule, Schulsystem, Ursachen, Hintergründe, Interventionen, Unterstützung, gesellschaftliches Problem.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptgründe für Schulverweigerung?
Gründe sind vielfältig: Leistungsdruck, Mobbing, familiäre Probleme, mangelnde Deutschkenntnisse oder eine klinische Schulphobie.
Was ist der Unterschied zwischen Schulschwänzen und Schulphobie?
Schwänzen ist oft motiviert durch Unlust; eine Schulphobie ist eine angstbedingte Störung, die oft therapeutische Hilfe erfordert.
Wie können Schule und Jugendhilfe zusammenarbeiten?
Durch gemeinsame Projekte, Schulsozialarbeit und außerschulische Einrichtungen, die Jugendliche dort abholen, wo das starre Schulsystem scheitert.
Warum reicht polizeiliche Fahndung nach Schwänzern nicht aus?
Weil sie nur die Symptome bekämpft, aber nicht die tieferliegenden Ursachen (wie psychische Belastungen oder Perspektivlosigkeit) löst.
Was ist "passive Schulverweigerung"?
Wenn Schüler zwar physisch anwesend sind, sich aber innerlich komplett vom Unterricht distanzieren und nicht mehr mitarbeiten.
- Citar trabajo
- Nadja Rueth (Autor), 2005, Schulverweigerung - Anlässe zur Kooperation mit Außerschulischer Jugendhilfe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40772