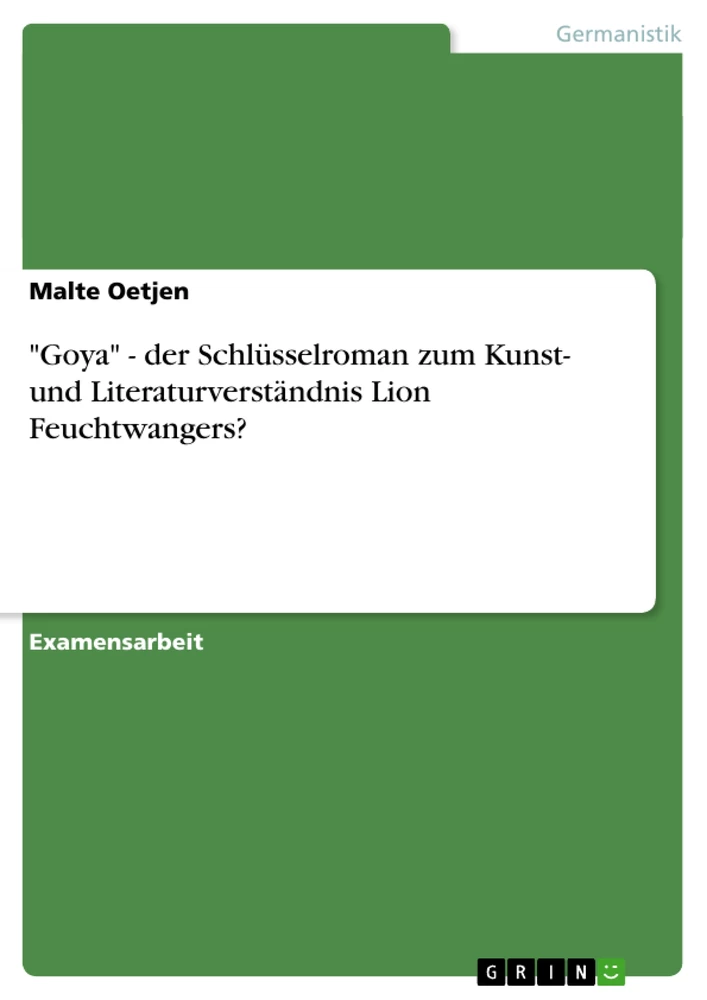Einleitung
Oftmals sei das Urteil über gegenwärtige Kunst von verzweifelter Unsicherheit geprägt2, so Hans-Georg Gadamer in »Wahrheit und Methode«. Der Abstand der Zeit, so führt er aus, sei hingegen als eine produktive und hilfreiche Bedingung anzusehen, wenn es gelte, ein angemessenes Verständnis von literarischen Texten oder, ganz allgemein gesprochen, überhaupt von Kunstwerken zu entwickeln. Denn nur dem geschichtlich entrückten Kunstgegenstand vermögen wir bei der Beurteilung seiner Bedeutung mit einem höheren Maß an Sicherheit zu begegnen, und zwar deshalb, weil wir durch den Abstand der Zeit freier würden von unkontrollierbaren Vorurteilen3, die uns in der Auseinandersetzung mit gegenwärtiger Kunst im Moment „[...] viel zu sehr einnehmen, als daß wir sie wissen [...]“4 und erkennen könnten. Daher seien wir bei der Beurteilung von gegenwärtiger Kunst auch nicht in der Lage, die mögliche Berechtigung und eventuelle Gültigkeit unserer zeitlich und damit jeweils geschichtlich bedingten Vorurteile, die unser Bemühen um ein adäquates Verständnis von Kunst und ihrer Bedeutung immer unbewußt mitbestimmen, durch kritisches Hinterfragen auf die Probe zu stellen. Statt dessen würden wir sie im Verstehensprozeß von gegenwärtiger Kunst vielmehr unbewußt applizieren und könnten sie folglich in ihrer Wirkung, wo eigentlich notwendig, auch nicht suspendieren. Dies habe jedoch zur Folge, so Gadamer, daß wir die Bedeutung des aktuellen Kunstwerkes nur sehr schwer, wenn überhaupt, angemessen erfassen könnten, weil sie eben oftmals erst gar nicht die Möglichkeit erhielte, sich von unseren Vorurteilen abzuheben.
Nun zählt das Romanwerk Lion Feuchtwangers (*München 1884, † Kalifornien, USA 1958) ganz gewiß nicht zur gegenwärtigen Literatur. Statt dessen gehört es überwiegend zu jenem speziellen Abschnitt der deutschsprachigen Literaturgeschichte, dem man das Schrifttum derer zuordnet, die nach der Machtübernahme Hitlers, dem Reichstagsbrand und der Bücherverbrennung vor politischer oder rassistischer Verfolgung aus Deutschland flohen und deren Werke deshalb zwischen 1933 und 1945 – aber auch noch danach – im Ausland, im Exil entstanden. Doch obwohl die Werke der deutschen Exilliteratur damit einer literaturgeschichtlichen Epoche angehören, die schon geraume Zeit zurückliegt, ist der Umgang mit ihnen nicht ganz unproblematisch. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedingungen für die Rezeption Feuchtwangers nach 1945
- Innere und äußere Emigration – diese Kontroverse triff auch Feuchtwanger
- Die Kulturpolitik der Besatzungsmächte - ein weiterer Grund für Feuchtwangers positive Aufnahme im Osten und seine Ablehnung im Westen Deutschlands
- »Moskau 1937 « - auch kleine Bücher machen Schicksale
- Der Autor von »Waffen für Amerika« und Verehrer Franklins vor dem McCarthy-Ausschuß in den USA
- »Die Jüdin von Toledo« im Umfeld der Wiederbewaffnung und als Absage an die Gewalt
- Tendenzen der Feuchtwanger-Rezeption in Ost- und in Westdeutschland
- Herleitung der Fragestellung
- Goya, ein Künstler unter vielen in Feuchtwangers Werk
- Jacques Tüverlins und Sepp Trautweins Entwicklung
- »Goya oder Kunst und Politik«
- In >>Erfolg<< wird Goyas Entwicklung vom „Nur-Künstler“ zum Künstler (andeutungsweise) vorweggenommen
- Lion Feuchtwanger und der Ästhetizismus der Décadents
- »Goya« - Feuchtwangers Antwort auf die Frage: Wie muß Kunst beschaffen sein, um verändernd auf die Gesellschaft wirken zu können?
- Goya macht sich auf den Weg der Erkenntnis
- »Goya« im Kontext der Revolutionstrilogie
- Erzählperspektive
- Das historische Umfeld des »Goya«<-Romans
- Goyas Weg vom Hofmaler zum Kritiker gesellschaftlicher Verhältnisse
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Roman „Goya“ von Lion Feuchtwanger im Kontext der Rezeption des Autors in der Nachkriegszeit und analysiert, wie sich die politische und künstlerische Entwicklung Goyas im Roman mit Feuchtwangers eigener Haltung zur Kunst und Politik verbinden lässt.
- Die Rezeption Feuchtwangers in Ost- und Westdeutschland nach 1945
- Die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft und seine Verantwortung
- Die Verbindung von Kunst und Politik im Werk von Lion Feuchtwanger
- Die Bedeutung der Revolutionstrilogie für Feuchtwangers Schaffen
- Goyas künstlerische Entwicklung und sein Verhältnis zur Macht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet die Problematik der Rezeption von Literatur im historischen Kontext. Kapitel 2 analysiert die Bedingungen für die Rezeption Feuchtwangers nach 1945 und beleuchtet die Kontroverse um innere und äußere Emigration sowie die Auswirkungen der Kulturpolitik der Besatzungsmächte. Das dritte Kapitel stellt die Fragestellung der Arbeit vor und untersucht die Rolle Goyas im Werk von Feuchtwanger. Kapitel 4 analysiert den Roman „Goya“ im Kontext der Revolutionstrilogie und untersucht Goyas Weg vom Hofmaler zum Kritiker gesellschaftlicher Verhältnisse.
Schlüsselwörter
Lion Feuchtwanger, Goya, Revolutionstrilogie, Kunst und Politik, Rezeption, Emigration, Nachkriegszeit, Künstlerische Entwicklung, Gesellschaftliche Verhältnisse.
Häufig gestellte Fragen
Welche zentrale Frage behandelt Lion Feuchtwangers Roman "Goya"?
Der Roman geht der Frage nach, wie Kunst beschaffen sein muss, um verändernd auf die Gesellschaft wirken zu können und welche Verantwortung der Künstler trägt.
Wie entwickelt sich die Figur Goya im Roman?
Goya wandelt sich vom unpolitischen Hofmaler, der primär nach ästhetischem Erfolg strebt, zum scharfen Kritiker gesellschaftlicher und politischer Missstände.
Warum ist Feuchtwangers Rezeption nach 1945 in Deutschland gespalten?
Aufgrund seiner politischen Haltung und Werke wie "Moskau 1937" wurde er in der DDR gefeiert, während er in Westdeutschland im Kontext des Kalten Krieges oft kritisch gesehen oder ignoriert wurde.
Was versteht man unter dem Begriff "Schlüsselroman" in diesem Kontext?
Der Roman dient als Schlüssel zu Feuchtwangers eigenem Kunstverständnis, in dem er seine Erfahrungen aus dem Exil und seinen Kampf gegen den Faschismus verarbeitet.
Welche Rolle spielt die Revolutionstrilogie für das Werk?
"Goya" steht im Kontext von Feuchtwangers Auseinandersetzung mit historischen Umbrüchen und der Frage, wie Vernunft und Fortschritt sich gegen Unterdrückung durchsetzen können.
- Citation du texte
- Malte Oetjen (Auteur), 2005, "Goya" - der Schlüsselroman zum Kunst- und Literaturverständnis Lion Feuchtwangers?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40793