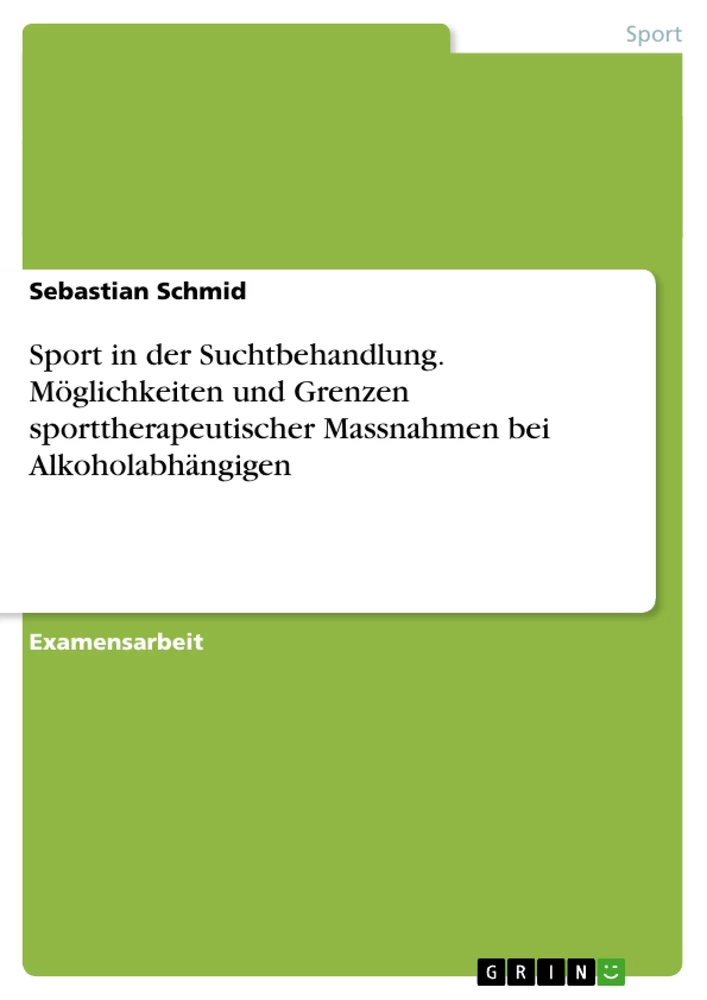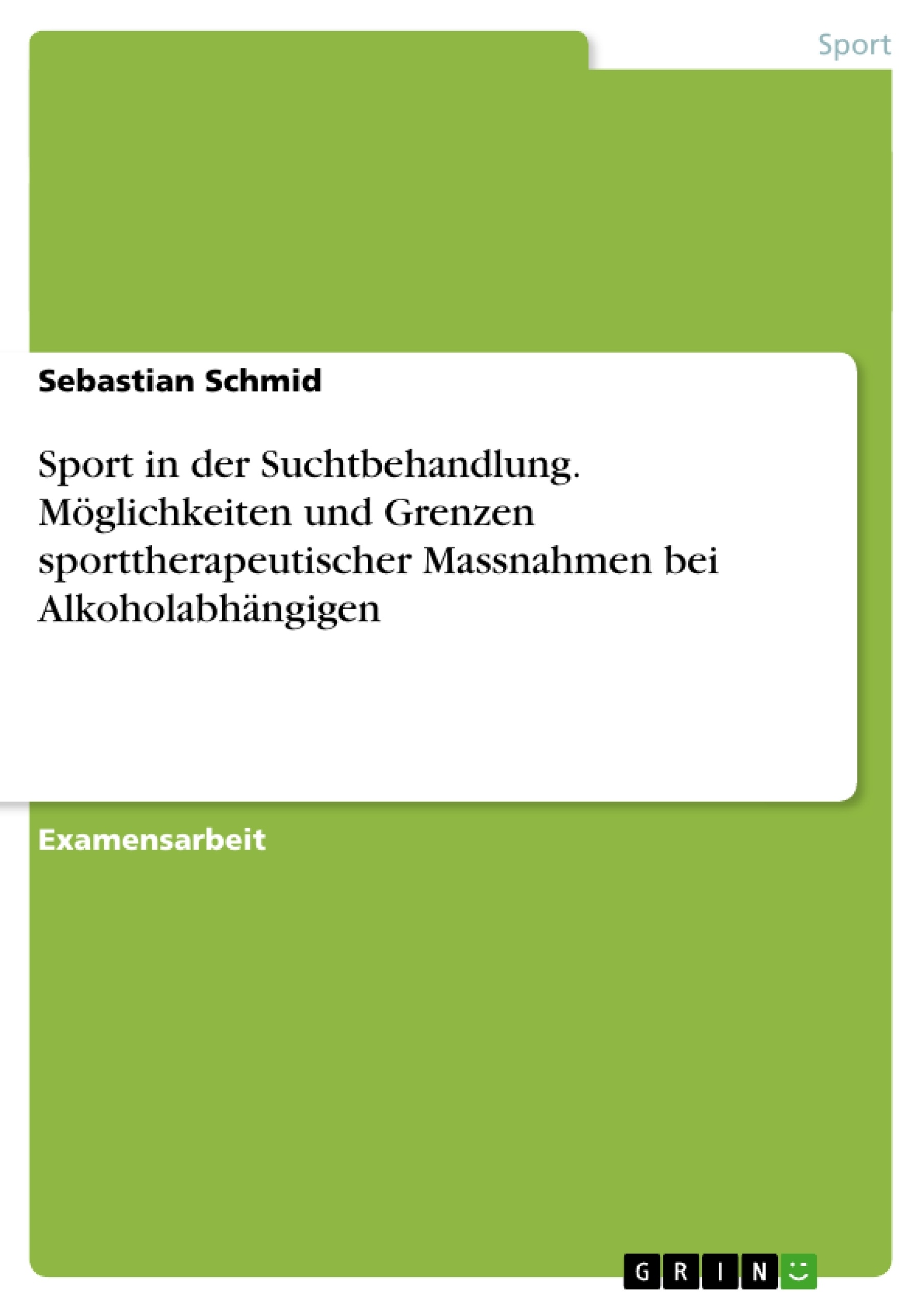Alkoholabhängigkeit besitzt eine hohe gesellschaftliche Brisanz unter gesundheitlichen und sozialpolitischen Gesichtspunkten. In der Bundesrepublik Deutschland sterben jährlich ca. 40.000 Menschen an den Folgen der Alkoholabhängigkeit, rund 2,5 Millionen gelten als alkoholabhängig und ca. eine Million Bundesbürger sind schwere Alkoholiker. Alkohol ist damit nach Zigaretten und falscher Ernährung einhergehend mit Bewegungsmangel die dritthäufigste vermeidbare Todesursache in unserer Gesellschaft. Neben den individuellen Folgen für den Alkoholsüchtigen, sind es auch sozioökonomische Kosten in Milliardenhöhe (z.B. Arbeitsunfälle, Arbeitsausfall, Arbeitslosigkeit, Invalidität und Straffälligkeit), die in der Gesellschaft Handlungsdruck entstehen lassen. Der volkswirtschaftliche Verlust im Jahr 2001 betrug 20 Milliarden Euro. Dagegen sind die Ausgaben für die Rehabilitation Alkoholabhängiger mit 500 Millionen Euro eher gering.
Es hat sich in der Öffentlichkeit allmählich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Abhängigkeit nicht nur eine Gefahr für einige wenige Willensschwache, sondern eine Gefahrenpotential für den Menschen an sich dargestellt. Süchtige sind demnach nicht Menschen, die aus Charakterschwäche der Versuchung verfallen. Vorraussetzung einer adäquaten Hilfe für Suchtpatienten ist aus diesem Grund zuallererst, dass man ihre Sucht als Krankheit anerkennt, denn eine gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung wirkt von vorne herein kontraproduktiv auf den Behandlungsverlauf der Suchtkranken. Deshalb stehen Aufklärung, Prävention und Rehabilitation im Bereich der Drogenabhängigkeit im Mittelpunkt staatlicher Kampagnen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Symptomatik von Alkoholkranken
- II.1. Das allgemeine Suchtphänomen
- II.1.1. Definition
- II.1.2. Entstehung der Sucht
- II.1.2.1. Soziale Entstehungsfaktoren
- II.1.2.2. Personale Entstehungsfaktoren
- II.1.2.3. Biologische Entstehungsfaktoren
- II.2. Konflikte und Störungen bei Alkoholkranken
- II.2.1. Anamnese des Alkoholkranken
- II.2.1.1. Phasenmodell
- II.2.1.2. Typologie
- II.2.2. Physiologische Folgen
- II.2.2.1. Internistische Erkrankungen
- II.2.2.2. Neurologische Erkrankungen
- II.2.3. Soziale Folgen
- II.2.4. Psychische Folgen
- II.2.4.1. Störungen im affektiv-emotionalen Bereich
- II.2.4.2. Beeinträchtigung kognitiver und psycho-motorischer Funktionen
- II.2.4.3. Störungen durch Alkoholpsychosen
- III. Sporttherapie mit Suchtkranken
- III.1. Definition von Sporttherapie
- III.2. Möglichkeiten der Sporttherapie bei Alkoholabhängigen
- III.2.1. Der physiologische Bereich
- III.2.2. Der soziale Bereich
- III.2.3. Der psychische Bereich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Zulassungsarbeit befasst sich mit der Rolle des Sports in der Suchtbehandlung von Alkoholabhängigen. Sie untersucht die Möglichkeiten und Grenzen sporttherapeutischer Maßnahmen in diesem Kontext und analysiert die verschiedenen physiologischen, sozialen und psychischen Aspekte, die durch Sport beeinflusst werden können.
- Analyse der Symptomatik von Alkoholabhängigkeit
- Definition und Einordnung von Sporttherapie im Kontext der Suchtbehandlung
- Bewertung der Möglichkeiten sporttherapeutischer Maßnahmen bei Alkoholabhängigen
- Bedeutung des Sports für die physiologische, soziale und psychische Rehabilitation
- Grenzen und Herausforderungen der Sporttherapie bei Alkoholabhängigen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit führt in das Thema der Alkoholabhängigkeit ein und beleuchtet die gesellschaftliche Brisanz und die gesundheitlichen sowie sozialpolitischen Auswirkungen. Es werden die individuellen und sozioökonomischen Kosten des Alkoholkonsums beschrieben und die Notwendigkeit von Präventions-, Rehabilitations- und Aufklärungskampagnen hervorgehoben.
Im zweiten Kapitel wird die Symptomatik von Alkoholkranken umfassend analysiert. Es werden verschiedene Aspekte der Sucht, einschließlich der Definition, Entstehung, Konflikte, Störungen, physiologischen Folgen und psychischen Auswirkungen beleuchtet. Das Kapitel deckt sowohl die sozialen und personalen Faktoren, die zur Entstehung der Sucht beitragen, als auch die biologischen Prozesse auf, die durch den Alkoholmissbrauch beeinflusst werden.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Anwendung von Sporttherapie bei Suchtkranken. Es definiert die Sporttherapie, erörtert die Möglichkeiten dieser Therapieform im Bereich der Alkoholabhängigkeit und beleuchtet die verschiedenen Auswirkungen des Sports auf die physiologischen, sozialen und psychischen Aspekte der Rehabilitation.
Schlüsselwörter
Alkoholabhängigkeit, Sucht, Sporttherapie, Rehabilitationsmaßnahmen, physiologische Folgen, soziale Folgen, psychische Folgen, Suchtprävention, Bewegungstherapie, Therapiekonzepte, Effektivitätsstudien.
- Citar trabajo
- Sebastian Schmid (Autor), 2005, Sport in der Suchtbehandlung. Möglichkeiten und Grenzen sporttherapeutischer Massnahmen bei Alkoholabhängigen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40797