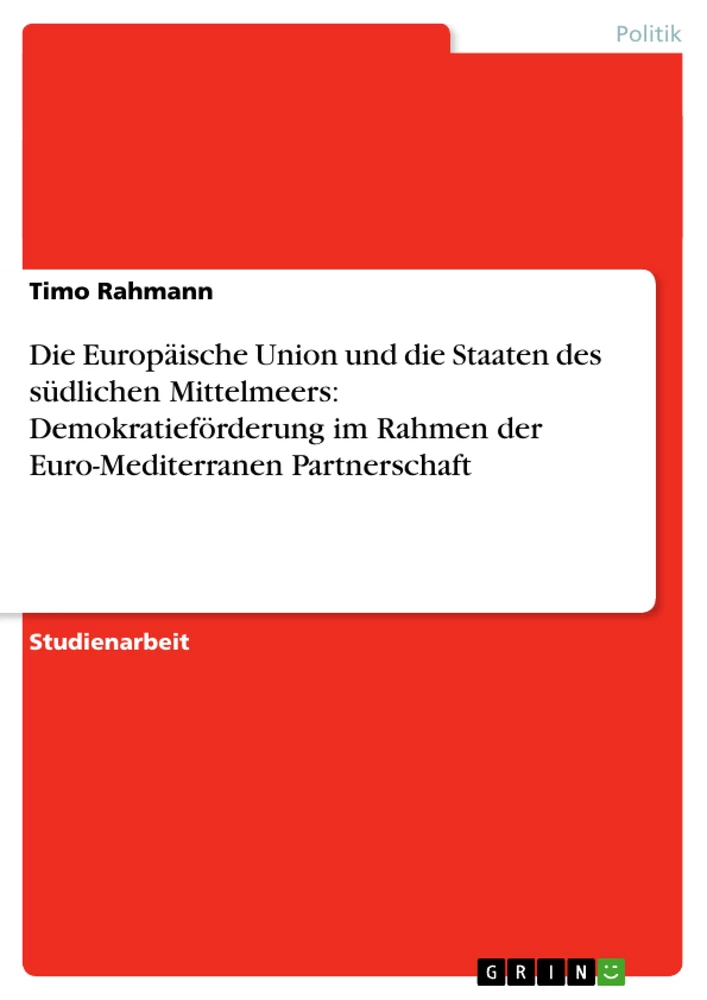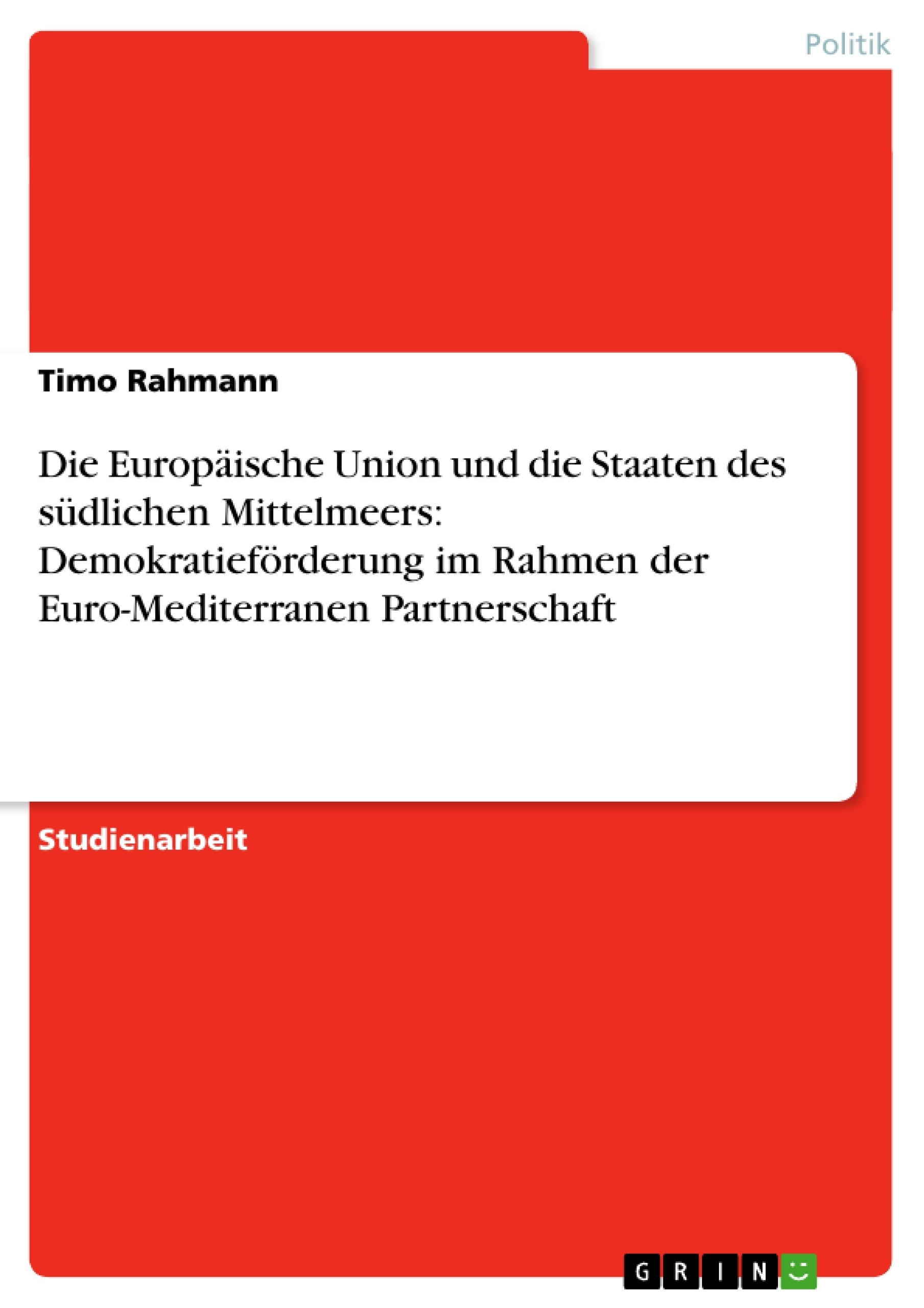[...] Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Euro-Mediterranen Partnerschaft vor allem im Kontext der politischen Dimension. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die EU, dem normativen Leitbild der „Zivilmacht“ folgend, Demokratisierung, Friedensförderung sowie die Durchsetzung von Menschenrechten und internationalem Recht im multilateralen Rahmen als grundsätzliche Ziele ihrer Politik zu Drittstaaten betrachtet. Doch wird der EU in keinem Fall Altruismus unterstellt, sondern die genannten Prinzipien vielmehr als konsequente und legitime Verfolgung eigener Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen betrachtet. Betrachtet man erstens Demokratisierung als Ziel der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen und erkennt zweitens die politische Konditionierung als Instrument dieses Ziel zu verfolgen, so stellt sich die Frage nach der Wirksamkeit dieses Instruments innerhalb des spezifischen Rahmens des Barcelona-Prozesses. In welchem Ausmaß eignet sich politische Konditionierung im Kontext der Problemlagen des südlichen Mittelmeerraums dazu demokratisierende Prozesse zu unterstützen und zu fördern? Die generelle Realisierbarkeit von demokratischen Strukturen und Institutionen im arabischen Raum soll im Rahmen dieser Arbeit nicht thematisiert werden. Ebenso soll an dieser Stelle nicht allgemein (global) nach Erfolg und Misserfolg der Demokratisierungspolitik der EU gefragt werden, denn dies eröffnet eine Fülle von möglichen Fallbeispielen und erfordert zudem den Einfluss der EU auf den jeweiligen Reformprozess von dem anderer Akteure zu isolieren. Dies kann in der erforderlichen Breite hier nicht geleistet werden. Vielmehr soll im Zuge einer allgemeinen Analyse der politischen Partnerschaft von Barcelona nach der eigenständigen Rolle von politischer Konditionierung in diesem Kontext gefragt werden. Zum Zwecke eines besseren theoretischen Verständnisses des Politikziels der EU – Demokratisierung – soll dieses in einem ersten Schritt näher eingegrenzt und dessen historischen und konzeptionellen Grundlagen nachgezeichnet werden. Darauf aufbauend soll zweitens in der erforderlichen Kürze die Bedeutung der politischen Konditionierung hierbei geklärt werden. Vor diesem Hintergrund ist der Hauptteil dieser Arbeit der EMP als solcher gewidmet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I.) Einleitung
- II.) Demokratieförderung als außenpolitisches Ziel der Europäischen Union
- III.) Politische Konditionierung als Instrument
- IV.) Die Euro-Mediterrane Partnerschaft
- a) Genese und historische Grundlagen
- b) Ziele und Inhalte des Barcelona-Prozesses
- V.) Die politische Dimension innerhalb der Euro-Mediterranen Partnerschaft – Ergebnisse und Probleme
- VI.) Die Praxis der politischen Konditionierung innerhalb der EMP
- VII.) Schlussbetrachtung
- VIII.) Abkürzungsverzeichnis
- IX.) Verwendete Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Euro-Mediterrane Partnerschaft (EMP) als ein Instrument der Demokratieförderung der Europäischen Union in der Region des südlichen Mittelmeerraums. Die Arbeit untersucht die Rolle der politischen Konditionierung als Mittel zur Förderung demokratischer Werte und Normen in den Partnerstaaten der EMP und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit diesem Ansatz verbunden sind.
- Die geostrategische Bedeutung des südlichen Mittelmeerraums für die Europäische Union
- Die Rolle der Demokratieförderung in der Außenpolitik der Europäischen Union
- Die politische Konditionierung als Instrument der Demokratieförderung
- Die Ziele und Inhalte des Barcelona-Prozesses
- Die Herausforderungen und Chancen der politischen Konditionierung in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- I.) Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz des südlichen Mittelmeerraums für die Europäische Union im Kontext der Ereignisse nach dem 11. September 2001 dar und führt in die Thematik der Demokratieförderung und politischen Konditionierung ein.
- II.) Demokratieförderung als außenpolitisches Ziel der Europäischen Union: Dieses Kapitel diskutiert die Bedeutung der Demokratieförderung in der Außenpolitik der Europäischen Union und beleuchtet unterschiedliche Konzepte und Ansätze.
- III.) Politische Konditionierung als Instrument: Dieses Kapitel definiert den Begriff der politischen Konditionierung und erläutert die Funktionsweise dieses Instruments in der Praxis.
- IV.) Die Euro-Mediterrane Partnerschaft: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Genese und historischen Grundlagen der EMP sowie die Ziele und Inhalte des Barcelona-Prozesses.
- V.) Die politische Dimension innerhalb der Euro-Mediterranen Partnerschaft – Ergebnisse und Probleme: Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse und Probleme, die mit der politischen Dimension der EMP verbunden sind.
- VI.) Die Praxis der politischen Konditionierung innerhalb der EMP: Dieses Kapitel untersucht die konkrete Umsetzung der politischen Konditionierung im Rahmen der EMP.
Schlüsselwörter
Euro-Mediterrane Partnerschaft, Demokratieförderung, politische Konditionierung, Barcelona-Prozess, südlicher Mittelmeerraum, politische Union, Zivilmacht, Außen- und Sicherheitspolitik, Erweiterung, Nahostkonflikt, Migrationsdruck, Staatlichkeit, Autokratie, Instabilität, sozioökonomische Faktoren, wirtschaftliche und soziale Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Barcelona-Prozess?
Der Barcelona-Prozess begründete 1995 die Euro-Mediterrane Partnerschaft (EMP) mit dem Ziel, Frieden, Stabilität und Wohlstand im Mittelmeerraum durch multilaterale Zusammenarbeit zu fördern.
Was bedeutet „politische Konditionierung“?
Es ist ein Instrument der EU-Außenpolitik, bei dem finanzielle Hilfe oder engere Zusammenarbeit an die Bedingung geknüpft wird, dass der Partnerstaat demokratische Reformen und Menschenrechte umsetzt.
Verfolgt die EU mit der Demokratieförderung nur altruistische Ziele?
Nein, die Förderung von Demokratie und Stabilität im südlichen Mittelmeerraum dient auch der konsequenten Verfolgung eigener Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen der EU.
Warum ist die Demokratisierung im arabischen Raum so schwierig?
Die Arbeit beleuchtet Herausforderungen wie autokratische Strukturen, sozioökonomische Instabilität und den Migrationsdruck, die den Erfolg politischer Konditionierung erschweren.
Ist die politische Konditionierung in der EMP wirksam?
Die Untersuchung hinterfragt kritisch die Wirksamkeit dieses Instruments und analysiert die Praxis und die Probleme bei der Umsetzung demokratischer Standards in den Partnerländern.
- Arbeit zitieren
- Timo Rahmann (Autor:in), 2004, Die Europäische Union und die Staaten des südlichen Mittelmeers: Demokratieförderung im Rahmen der Euro-Mediterranen Partnerschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40827