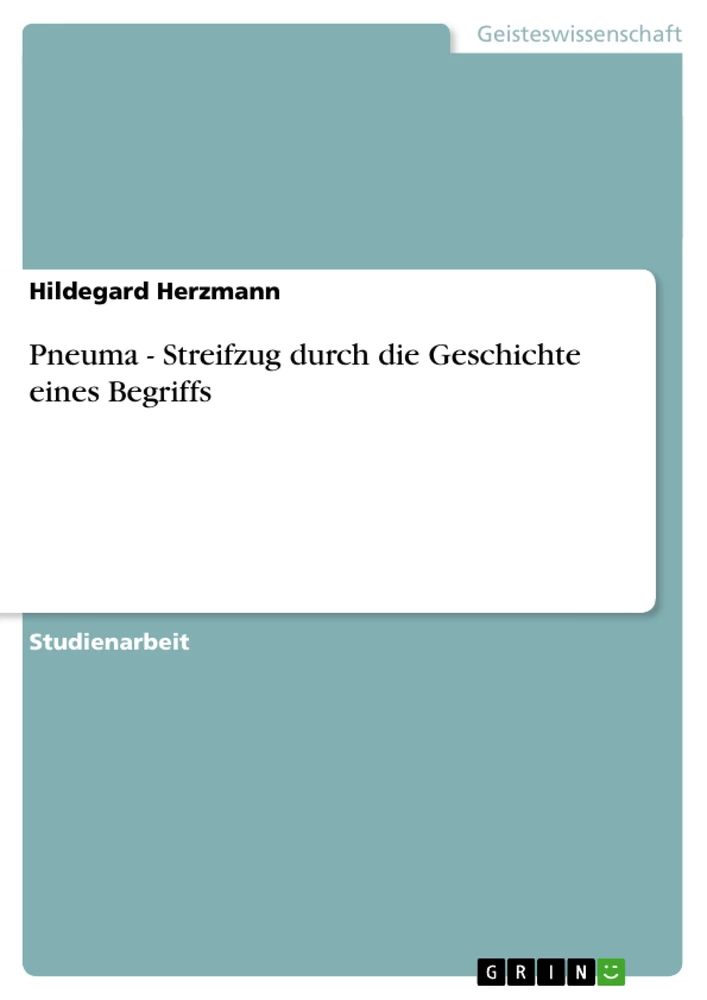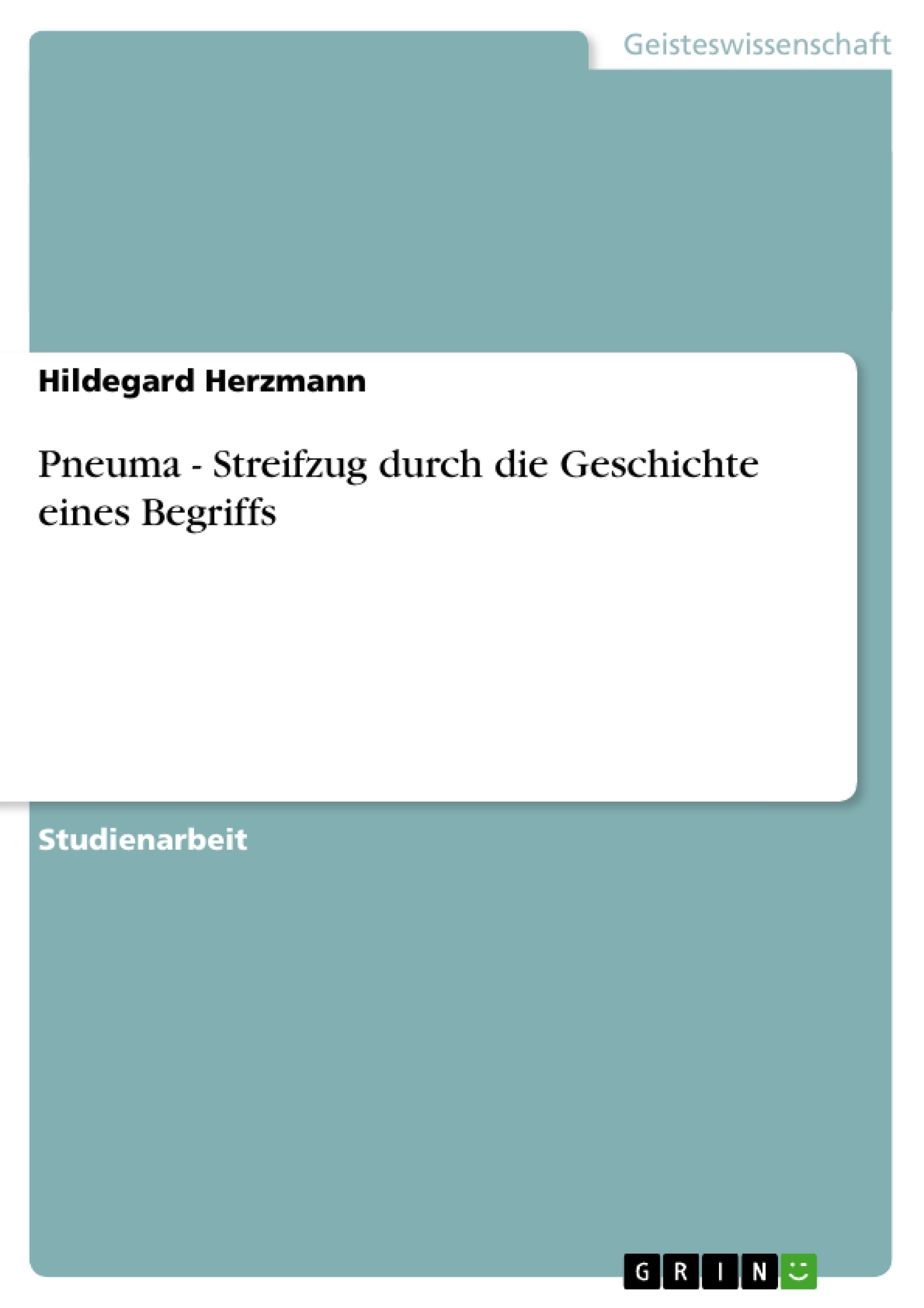Im 19. Jahrhundert erfährt der Begriff "Geist" im Zusammenhang mit dem Zurücktreten des metaphysischen und transzendental-reflexiven Denkens zugunsten der positivistischen Methode eine bis heute wirksame Verengung seiner Bedeutung: Er bezeichnet lediglich noch das, was mit dem Denkvermögen und Bewusstsein des einzelnen Menschen zusammenhängt. In zahlreichen Ableitungen und Begriffszusammensetzungen wie "Geistesblitz", "Geistesgegenwart", "geistreich" etc. kommt dies zum Ausdruck.
Doch das war nicht immer so. Bereits ein Blick zurück in die Geschichte der deutschen Sprache zeigt, dass ursprünglich zwei Bedeutungsstränge parallel liefen. Neben dem eben genannten wurde der Begriff "Geist" auch im Sinne von "überirdisches Wesen", "Gespenst" benutzt. Noch viel umfangreicher und differenzierter wird sein Bedeutungsgehalt, zieht man Ausschnitte aus der Religions- und Philosophiegeschichte hinzu. Den Kern dieser Arbeit bildet hierbei der in der Gnosis benutzte "Pneuma"-Begriff, der anhand des wahrscheinlich aus dem 3. nachchristlichen Jahrhundert stammenden, vermutlich ägyptischen Textes "Das Wesen der Archonten" aus dem Codex II von Nag Hammadi veranschaulicht und als exemplarisch für das gnostische Denken dargestellt werden soll. Darüber hinaus lassen sich an diesem Text auch andere für die Gnosis wesentliche Bereiche entwickeln: der Dualismus, die Kosmogonie, die Anthropogonie und Anthropologie, die Soteriologie und schließlich die Eschatologie. Anschließend zeigt ein Blick zurück in die römische und griechische Antike die Wurzeln des "Pneuma"-Begriffs auf und eine Darstellung der semantischen Vielfalt im Neuen Testament sowie im frühen Christentum rundet die Untersuchung ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der Pneuma-Begriff der Gnosis
- Der vorgnostische Pneuma-Begriff
- Der Pneuma-Begriff im Neuen Testament und im frühen Christentum
- Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die vielschichtige Bedeutung des Begriffs „Pneuma“ anhand religions- und philosophiegeschichtlicher Beispiele aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und semantischen Vielfalt des Begriffs von der vorgnostischen Antike bis ins frühe Christentum. Dabei werden die unterschiedlichen Interpretationen und die damit verbundenen theologischen und philosophischen Implikationen untersucht.
- Der Pneuma-Begriff in der Gnosis
- Der Pneuma-Begriff in der vorgnostischen Antike
- Der Pneuma-Begriff im Neuen Testament und frühen Christentum
- Dualismus und Kosmogonie in gnostischen Texten
- Anthropologie und Soteriologie im Kontext des Pneuma
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung beleuchtet die veränderte Bedeutung des Begriffs "Geist" im 19. Jahrhundert, die zu einer Reduktion auf Bewusstsein und Denkvermögen führte. Sie hebt die ursprüngliche Bedeutung von "Erregung" und "Ergriffenheit" hervor und zeigt den Einfluss von lateinischem "spiritus" und griechischem "pneuma" auf die Entwicklung des Begriffs auf. Die Einleitung kündigt die Untersuchung der umfassenden Bedeutung des Begriffs "Pneuma" in der Religions- und Philosophiegeschichte an, mit Schwerpunkt auf der Gnosis, der vorgnostischen Antike und dem frühen Christentum. Der Text verspricht eine Analyse der semantischen Vielfalt des Begriffs.
2. Der Pneuma-Begriff der Gnosis: Dieses Kapitel analysiert den Pneuma-Begriff anhand des gnostischen Textes "Das Wesen der Archonten" aus dem Codex II von Nag Hammadi. Es beschreibt die gnostische Kosmogonie, die eine stufenweise Entstehung der Materie aus dem Geistigen darstellt. Die Rolle der Sophia, die den Anlass zur Entstehung der Welt außerhalb der Unvergänglichkeit gab, und die Figur Jaldabaoth, als Demiurg identifiziert, werden detailliert untersucht. Der Dualismus zwischen der oberen, geistigen Welt und der unteren, materiellen Welt, wird durch den Metapher des "Vorhangs" verdeutlicht. Die Schöpfungsgeschichte wird gnostisch interpretiert, wobei der Mensch als Produkt der Archonten initiell ein bloß psychisches Wesen ist, welches erst durch die Einwohnung des transzendenten Gottes einen geistigen Kern (Pneuma) erhält. Die Rolle der Schlange, die im Gegensatz zur biblischen Erzählung positive Aufgabe der Selbsterkenntnis vermittelt, wird ebenfalls diskutiert. Der Akt der Selbsterkenntnis als zentraler Punkt der gnostischen Soteriologie wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Pneuma, Gnosis, vorgnostische Antike, Neues Testament, frühes Christentum, Dualismus, Kosmogonie, Anthropogonie, Anthropologie, Soteriologie, Eschatologie, Geist, Seele, Nag Hammadi-Schriften, Jaldabaoth, Sophia, Archonten.
Häufig gestellte Fragen zu: "Der Pneuma-Begriff in der Gnosis und im frühen Christentum"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die vielschichtige Bedeutung des Begriffs "Pneuma" (Geist) in religions- und philosophiegeschichtlicher Perspektive. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und semantischen Vielfalt des Begriffs von der vorgnostischen Antike bis ins frühe Christentum, einschließlich der unterschiedlichen Interpretationen und theologisch-philosophischen Implikationen.
Welche Epochen und Strömungen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die vorgnostische Antike, die Gnosis, das Neue Testament und das frühe Christentum. Sie beleuchtet den "Pneuma"-Begriff in diesen unterschiedlichen Kontexten und zeigt die Entwicklung und Veränderung seiner Bedeutung auf.
Welche zentralen Themen werden untersucht?
Zentrale Themen sind der Pneuma-Begriff in der Gnosis und der vorgnostischen Antike, seine Bedeutung im Neuen Testament und frühen Christentum, Dualismus und Kosmogonie in gnostischen Texten, sowie Anthropologie und Soteriologie im Kontext des Pneuma.
Welche Quellen werden verwendet?
Ein zentrales Beispiel aus der Gnosis ist der gnostische Text "Das Wesen der Archonten" aus dem Codex II von Nag Hammadi. Die Arbeit bezieht sich auch auf das Neue Testament und andere relevante Texte des frühen Christentums sowie auf philosophiegeschichtliche Quellen der vorgnostischen Antike.
Wie wird der Pneuma-Begriff in der Gnosis dargestellt?
In der Gnosis wird Pneuma im Kontext der gnostischen Kosmogonie und Anthropologie betrachtet. Es wird die stufenweise Entstehung der Materie aus dem Geistigen dargestellt, die Rolle der Sophia und Jaldabaoth wird beleuchtet, und der Dualismus zwischen geistiger und materieller Welt wird durch die Metapher des "Vorhangs" verdeutlicht. Der Mensch wird als zunächst psychisches Wesen dargestellt, das erst durch den transzendenten Gott einen geistigen Kern (Pneuma) erhält. Die Selbsterkenntnis spielt eine zentrale Rolle in der gnostischen Soteriologie.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Pneuma, Gnosis, vorgnostische Antike, Neues Testament, frühes Christentum, Dualismus, Kosmogonie, Anthropogonie, Anthropologie, Soteriologie, Eschatologie, Geist, Seele, Nag Hammadi-Schriften, Jaldabaoth, Sophia und Archonten.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die umfassende Bedeutung des Begriffs "Pneuma" aufzuzeigen und seine Entwicklung und semantische Vielfalt über verschiedene religiöse und philosophische Strömungen hinweg zu analysieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zum Pneuma-Begriff in der Gnosis, ein Kapitel zum vorgnostischen Pneuma-Begriff, ein Kapitel zum Pneuma-Begriff im Neuen Testament und frühen Christentum und abschließende Schlussgedanken. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung und Analyse des Themas.
- Quote paper
- Hildegard Herzmann (Author), 2005, Pneuma - Streifzug durch die Geschichte eines Begriffs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40850