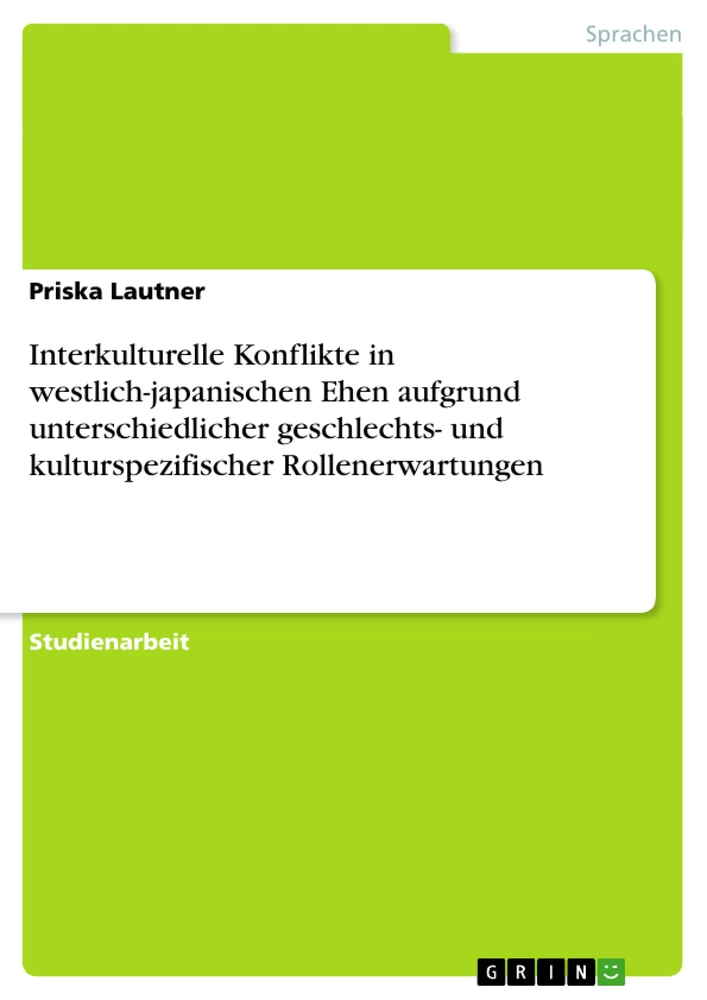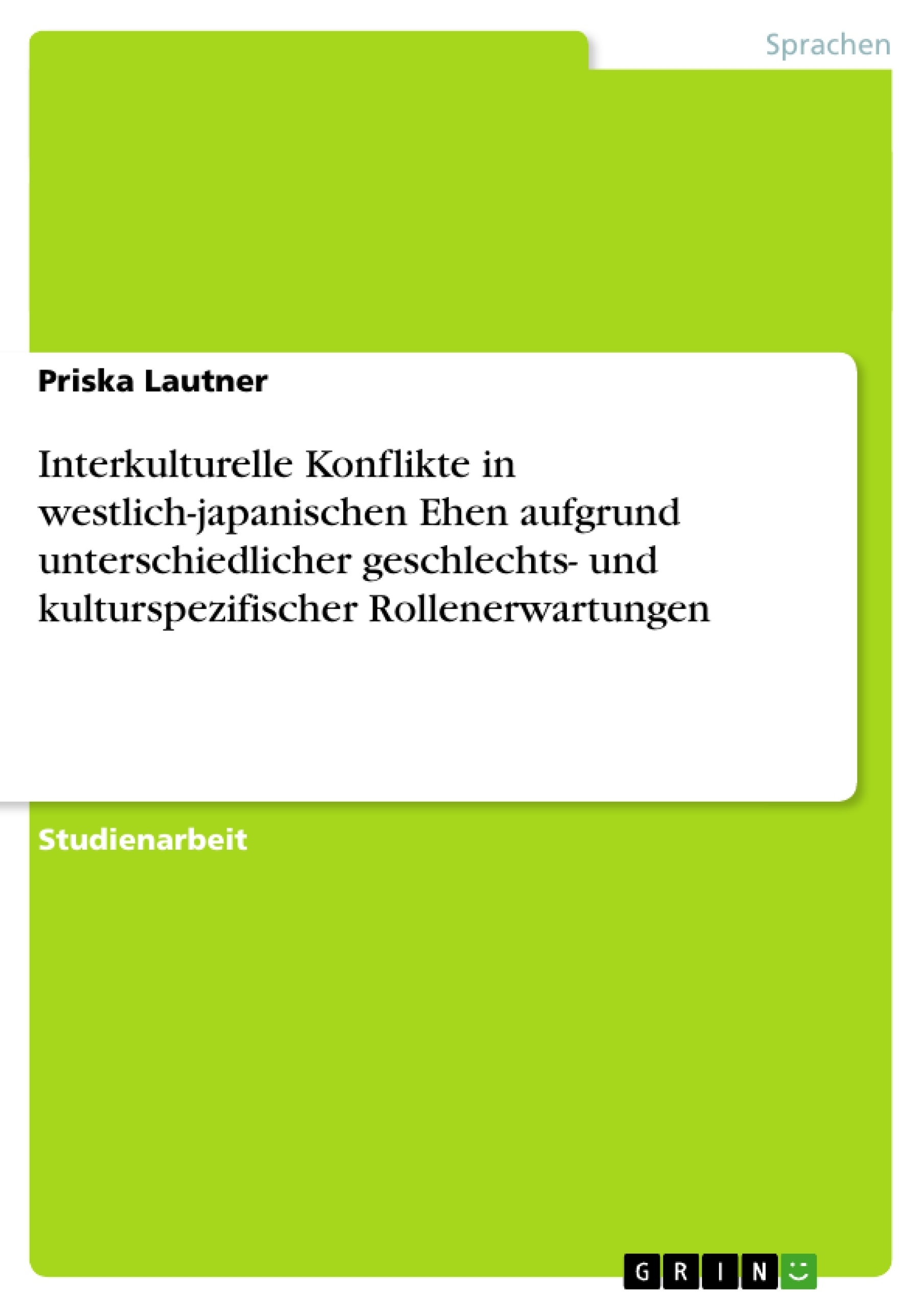Es gibt in einer rein-japanischen Familie ein klar differenziertes Rollenverhalten der Eheleute. In meinem ersten Teil der Arbeit, möchte ich das japanische Familiensystem betrachten. Im Gegensatz zum Westen hat sich die japanische Familie erst relativ spät im Sinne einer Gleichberechtigung für beide Ehepartner entwickelt. Die beiden Eheleute gehen getrennte Wege und jeder hat seinen eigenen Bereich und seine eigenen Aufgaben im Leben. Ich möchte versuchen keine Stereotypen aufzuzeigen, sondern nur den allgemeinen Trend in der japanischen Familie zu analysieren.
Danach möchte ich mich den geschlechtsspezifischen Kommunikationsmustern widmen. Mann-Frau Gespräche sind oft gekennzeichnet durch Missverständnisse, aufgrund von unterschiedlichen Sozialisationen. Ich möchte ein paar Kommunikationsmuster erläutern und anführen, warum es hier zu geschlechtsspezifischen Unverständlichkeiten kommt.
Anschließend werde ich die unterschiedlichen Kommunikationsmuster aufgrund der nationalen Kulturen erläutern. Dabei werde ich einige Klassifikationen von der japanischen und westlichen Kultur heranziehen und analysieren, welche Probleme bei der Kommunikation zwischen Menschen aus diesen beiden unterschiedlichen Kulturkreisen auftreten können.
Das letzte Kapitel befasst sich dann mit meiner eigenen Auswertung, die ich auf der Grundlage eines Fragebogens vornehmen werde.
Methodisch ist meine Arbeit in zwei Bereiche gegliedert.
Im ersten Teil habe ich nach einer umfangreichen Literaturrecherche die mir wichtig erscheinenden kulturellen Unterschiede zusammengefasst.
Dabei habe ich verschiedene Thesen aus der Literatur vorgestellt. In meinem zweiten Teil der Arbeit will ich nun diese Thesen anhand eines quantitativen Fragebogens überprüfen.
Ich habe einen Online-Fragebogen erstellt und in diversen Japan bezogenen Internetforen, die Leute gebeten, mir, falls sie in einer interkulturellen Ehe sind, den Fragebogen auszufüllen.
Ich habe insgesamt 50 ausgefüllte Fragebogen erhalten, die ich in meiner Arbeit auswerte. Meine Ergebnisse werde ich anhand des ersten Teils meiner Arbeit interpretieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. GESCHLECHTERROLLEN IN EINER JAPANISCHEN FAMILIE
- 2.1. Die Rolle der Frau in einer japanischen Familie
- 2.2. Die Rolle des Mannes in einer japanischen Familie
- 2.3. Die Rollenverteilung zwischen Ehemann und Ehefrau in einer japanischen Familie
- 3. GESCHLECHTSSPEZIFISCHE KOMMUNIKATIONSMUSTER
- 4. KULTURSPEZIFISCHE KOMMUNIKATIONSMUSTER
- 4.1. Soziokulturelle Merkmale der unterschiedlichen Kulturen
- 4.2. „Low-Context“ Kultur versus „High-Context“ Kultur
- 4.3. Japanische Mentalität und Kultur – zwei untrennbare Welten
- 4.4. Kommunikationsprobleme zwischen Japanern und Europäern
- 4.4.1. Direkter versus indirektem Kommunikationsstil
- 4.4.2. Japanisch – eine „männliche“ Sprache?
- 5. Interkulturelle westlich-japanische Ehen
- 5.1 Fragebogenauswertung: Allgemeine Angaben
- 5.2 Auswertung über die Konflikte in interkulturellen Ehen
- 5.3 Auswertung über die Lösung der Konflikte
- 5.4 Tsengs interkulturelle Partnerschaftsarrangements
- 6. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht interkulturelle Konflikte in westlich-japanischen Ehen, die auf unterschiedlichen Geschlechter- und kulturspezifischen Rollenerwartungen beruhen. Die Zielsetzung ist es, diese Konflikte zu identifizieren, zu analysieren und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Arbeit stützt sich auf Literaturrecherche und die Auswertung von Fragebögen.
- Geschlechterrollen in der japanischen Familie
- Geschlechtsspezifische Kommunikationsmuster
- Kulturspezifische Kommunikationsmuster (westlich vs. japanisch)
- Konflikte in interkulturellen Ehen
- Lösungsstrategien für interkulturelle Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Analyse interkultureller Konflikte in westlich-japanischen Ehen, basierend auf unterschiedlichen Geschlechter- und Kulturrollen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, beginnend mit einer Betrachtung des japanischen Familiensystems, gefolgt von einer Untersuchung geschlechtsspezifischer und kulturspezifischer Kommunikationsmuster, um schließlich die Ergebnisse einer Fragebogenauswertung zu präsentieren. Die methodische Vorgehensweise, bestehend aus Literaturrecherche und quantitativer Fragebogenerhebung (50 Teilnehmer), wird ebenfalls erläutert.
2. GESCHLECHTERROLLEN IN EINER JAPANISCHEN FAMILIE: Dieses Kapitel beleuchtet die traditionellen und sich verändernden Geschlechterrollen innerhalb japanischer Familien. Es zeigt den Wandel vom hierarchischen Familiensystem vor 1945 hin zur modernen Kernfamilie nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Rolle der Frau, traditionell dem Mann untergeordnet und an den Haushalt gebunden, wird im Vergleich zur Rolle des Mannes dargestellt. Die zunehmende Gleichberechtigung und der damit einhergehende Konflikt zwischen traditionellen Erwartungen und dem Wunsch nach partnerschaftlicher Gleichstellung werden detailliert diskutiert, wobei die „Bewusstseinsspalte“ (ishiki no gyappu) als zentrales Beispiel genannt wird.
3. GESCHLECHTSSPEZIFISCHE KOMMUNIKATIONSMUSTER: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Kommunikation, die zu Missverständnissen in Beziehungen führen können. Es werden verschiedene Kommunikationsmuster erläutert und analysiert, welche Unterschiede in der Sozialisation zu solchen Missverständnissen beitragen. Der Fokus liegt auf der Erklärung der spezifischen Ursachen für die geschlechtsspezifische Kommunikation, um die Grundlage für das Verständnis interkultureller Konflikte zu legen.
4. KULTURSPEZIFISCHE KOMMUNIKATIONSMUSTER: Dieses Kapitel vergleicht die kulturspezifischen Kommunikationsmuster westlicher und japanischer Kulturen. Es werden verschiedene Klassifizierungen herangezogen, um die Unterschiede zwischen „Low-Context“ und „High-Context“ Kulturen zu erläutern und zu analysieren, wie diese Unterschiede zu Kommunikationsproblemen zwischen Menschen aus diesen beiden Kulturkreisen führen können. Die japanische Mentalität und Kultur werden als untrennbare Einheit betrachtet, und es werden konkrete Beispiele für Kommunikationsschwierigkeiten aufgeführt, zum Beispiel Unterschiede im direkten und indirekten Kommunikationsstil. Die Frage nach einer möglichen „männlichen“ Prägung der japanischen Sprache wird ebenfalls angesprochen.
5. Interkulturelle westlich-japanische Ehen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Fragebogenauswertung. Es werden allgemeine Angaben der Befragten vorgestellt, gefolgt von einer detaillierten Analyse der in interkulturellen Ehen aufgetretenen Konflikte. Die Auswertung konzentriert sich auf die Art der Konflikte (kulturbedingt, rollenbedingt usw.), deren Häufigkeit und die Strategien, die zur Konfliktlösung eingesetzt wurden. Tsengs interkulturelle Partnerschaftsarrangements (einseitig, alternativ, kreativ) werden im Kontext der Ergebnisse diskutiert und die verschiedenen Konfliktbereiche werden spezifisch herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Konflikte, Japanische Familie, Geschlechterrollen, Kommunikation, Kulturvergleich, Westliche Kultur, Fragebogenauswertung, Konfliktlösung, Partnerschaft, Rollenerwartungen, „Low-Context“, „High-Context“, ishiki no gyappu.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Interkulturelle Konflikte in westlich-japanischen Ehen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht interkulturelle Konflikte in westlich-japanischen Ehen, die auf unterschiedlichen Geschlechter- und kulturspezifischen Rollenerwartungen beruhen. Das Ziel ist die Identifizierung, Analyse dieser Konflikte und die Aufzeigen möglicher Lösungsansätze.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf Literaturrecherche und der Auswertung von Fragebögen (50 Teilnehmer).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Geschlechterrollen in der japanischen Familie, geschlechtsspezifische und kulturspezifische Kommunikationsmuster (westlich vs. japanisch), Konflikte in interkulturellen Ehen und Lösungsstrategien für diese Konflikte. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich von „Low-Context“ und „High-Context“ Kulturen und der Rolle der „Bewusstseinsspalte“ (ishiki no gyappu).
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Geschlechterrollen in japanischen Familien, geschlechtsspezifische und kulturspezifische Kommunikationsmuster, die Auswertung interkultureller Ehen (inkl. Fragebogenergebnisse und Tsengs interkulturelle Partnerschaftsarrangements) und eine Zusammenfassung.
Welche Geschlechterrollen werden in der japanischen Familie betrachtet?
Das Kapitel zu Geschlechterrollen beleuchtet traditionelle und sich verändernde Rollen in japanischen Familien, den Wandel vom hierarchischen System vor 1945 zur modernen Kernfamilie und den Konflikt zwischen traditionellen Erwartungen und dem Wunsch nach Gleichberechtigung.
Wie werden geschlechtsspezifische Kommunikationsmuster behandelt?
Dieses Kapitel analysiert geschlechtsspezifische Unterschiede in der Kommunikation und deren Beitrag zu Missverständnissen in Beziehungen, indem es verschiedene Kommunikationsmuster erklärt und die Ursachen für geschlechtsspezifische Kommunikation aufzeigt.
Wie werden kulturspezifische Kommunikationsmuster verglichen?
Der Vergleich westlicher und japanischer Kommunikationsmuster erfolgt anhand von „Low-Context“ und „High-Context“ Kulturklassifizierungen. Es werden Kommunikationsprobleme zwischen den Kulturkreisen erläutert, die japanische Mentalität betrachtet und der direkte/indirekte Kommunikationsstil sowie die Frage nach einer „männlichen“ Prägung der japanischen Sprache diskutiert.
Was sind die Ergebnisse der Fragebogenauswertung?
Die Fragebogenauswertung präsentiert allgemeine Angaben der Befragten, analysiert Konflikte in interkulturellen Ehen (kulturbedingt, rollenbedingt etc.) hinsichtlich Häufigkeit und eingesetzter Lösungsstrategien und diskutiert Tsengs interkulturelle Partnerschaftsarrangements im Kontext der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Konflikte, Japanische Familie, Geschlechterrollen, Kommunikation, Kulturvergleich, Westliche Kultur, Fragebogenauswertung, Konfliktlösung, Partnerschaft, Rollenerwartungen, „Low-Context“, „High-Context“, ishiki no gyappu.
- Quote paper
- Mag. B.A. Priska Lautner (Author), 2004, Interkulturelle Konflikte in westlich-japanischen Ehen aufgrund unterschiedlicher geschlechts- und kulturspezifischer Rollenerwartungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40852