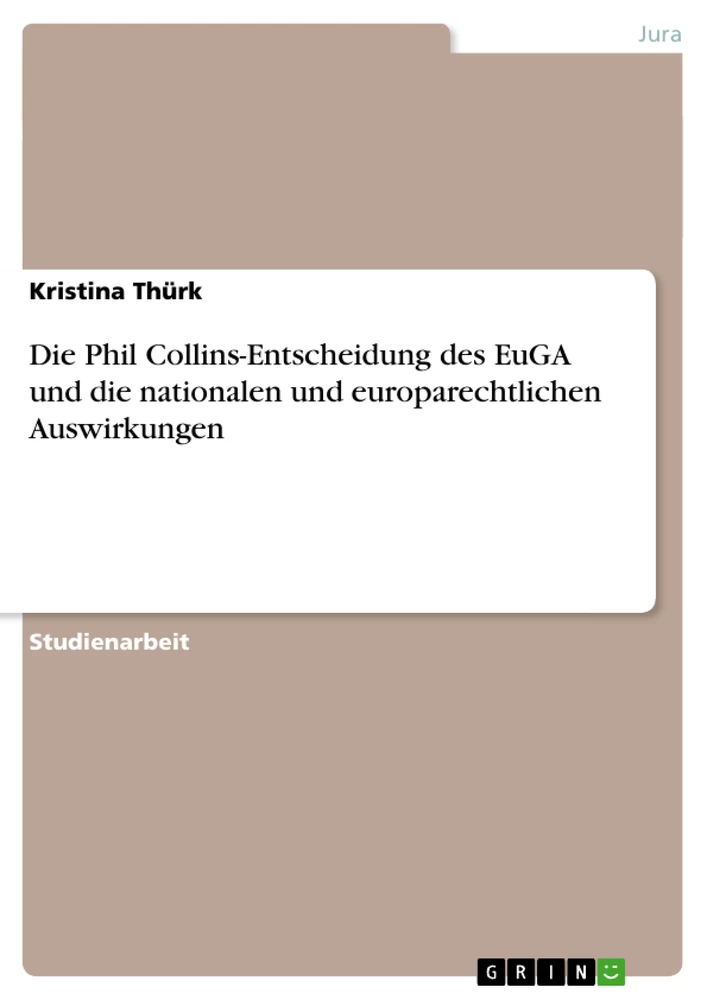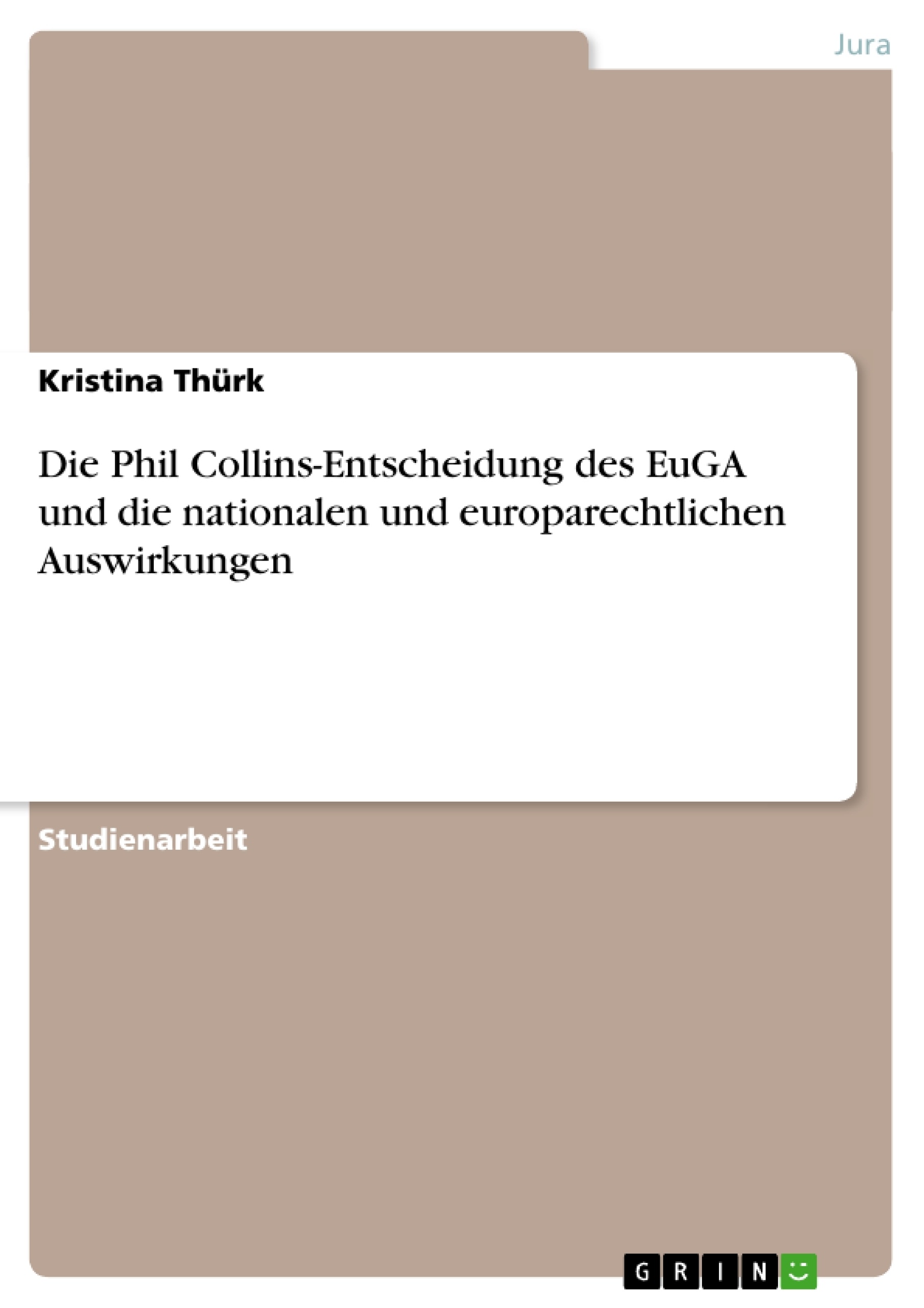Auf kaum einem Gebiet des Rechts haben sich internationale Abkommen als so erfolgreich erwiesen, wie auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte. Multilaterale völkerrechtliche Verträge weisen jedoch zwangsläufig Lücken auf. Derartige Lücken im Leistungsschutzrecht wurden in nicht ganz unerheblichem Maße durch die deshalb so genannte Schutzlückenpiraterie ausgenutzt. Der Begriff der Schutzlückenp iraterie ist verbindlich nicht definiert. Im Folgenden soll darunter die unautorisierte Aufnahme von Klangdarbietungen oder die una utorisierte Vervielfältigung bzw. Verbreitung von auf Tonträgern festgelegten Aufnahmen verstanden werden. Die Erscheinung der Schutzlücken-Piraterie wurde lange rechtlich vernachlässigt, obwohl es sich hierbei lediglich um eine verfeinerte Form des „bootlegging“ handelt, eines Phänomens, das in kommerzieller Form bereits seit Ende der 60er Jahre existiert. Auf dem Gebiet des Leistungsschutzes ausübender Künstler begann das gezielte Suchen nach Schutzlücken gegen Ende der 80er Jahre. Einige kleine Plattenfirmen mit zum Teil ausgefallen Namen („Chamelion Records“, „Swingin´ Pig Records“) brachten eine Fülle bislang unveröffentlichter Live- und Studioaufnahmen berühmter Interpreten (z.B. Prince, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Bob Dylan, The Doors, Beatles, ABBA, Dire Straits, Judas Priest) auf den Markt und versetzten damit sowohl die Künstler als auch die Vertragsfirmen in Aufregung. Diese Aufregung wird verständlich, wenn man den Hintergrund der Veröffentlichungen beleuchtet. Es handelt sich in allen Fällen um
unautorisierte – also von den Interpreten nicht genehmigte – Tonträger. Trotzdem gestaltete es sich für die Künstler außerordentlich schwierig, den Vertrieb dieser Tonträger zu untersagen. Die im nachfolgenden hauptsächlich dargestellten verbundenen Streitsachen Phil Collins ./. Imtrat und Patricia ./. EMI Electrola, besser bekannt als die Phil-Collins-Entscheidung sind Fälle der so genannten Schutzlückenpiraterie. Um zu begreifen, welche Auswirkungen die viel beachtete und diskutierte Phil-Collins-Entscheidung auf das nationale Urheberrecht und im Kampf gegen die Schutzlückenpiraterie hatte, muss vorab geklärt werden, wie das Urheberrecht vor dieser Entscheidung gelagert war. Im Nachgang wird die Phil-Collins-Entscheidung ausführlich beleuchtet, sodass abschließend die Auswirkungen klar herausgestellt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Urheberrecht vor der Entscheidung des EuGH.
- 1. Der Anwendungsbereich des UrhG.
- a) Der persönliche Geltungsbereich des UrhG.
- (1) Staatsangehörige anderer Staaten
- (2) Der Schutz von ausübenden Künstlern nach Maßgabe von Staatsverträgen
- b) Der räumlicher Anwendungsbereich
- 2. Ergebnis.
- III. Die Phil-Collins-Entscheidung
- 1. Wirtschaftlicher Hintergrund.
- 2. Rechtliche Veranlassung.
- a) Ausgangspunkt der Entscheidung.
- (1) Das Verfahren vor dem BGH
- (a) Schutz nach den Bestimmungen des deutschen Urheberrechts.
- (b) Schutz nach den Bestimmungen des GTA oder des Rom-Abkommen.
- (c) Schutz aufgrund fiktiven Bearbeitungsrechts.
- (d) Schutz der Darbietung nach Art. 6 I EGV.
- (2) Das Verfahren vor dem LG München I.
- (3) Problemstellung.
- b) Verfahren vor dem EuGH.
- (1) Umdeutung der Vorlagefragen durch den EuGH
- (2) Entscheidung des EuGH.
- c) Maastricht-Urteil.
- 3. Ergebnis
- IV. Auswirkungen der Phil-Collins-Entscheidung
- 1. Rechtliche Auswirkungen
- a) Inländerbehandlung gem. §§ 120 II Nr. 2, 125 I 2 UrhG
- b) Inländerbehandlung aufgrund von Staatsverträgen gemäß § 125 V UrhG.
- (1) Das Rom-Abkommen
- (2) Die Revidierte Berner Übereinkunft
- (3) Das Welturheberrechtsabkommen.
- (4) Bilaterale Abkommen
- c) Der persönlichkeitsrechtliche Mindestschutz gemäß § 125 VI UrhG.
- d) Verbot gemäß §§ 97 I, 96 I, 75 I, 125 VI UrhG.
- e) Verbot gemäß §§ 97 I, 83 I, 125 VI UrhG.
- f) Bedeutung des Schutzfristvergleiches gemäß §§ 125 VII UrhG.
- 2. Wirtschaftliche Auswirkungen.
- V. Zusammenfassung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die europarechtlichen Auswirkungen der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 20. Oktober 1993 im Fall Phil Collins auf das nationale Urheberrecht. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Rechtsprechung und ihrer Relevanz für die Schutzrechte von ausübenden Künstlern.
- Die Auswirkungen der Entscheidung des EuGH auf das nationale Urheberrecht
- Die Bedeutung des Inländerbehandlungsgrundsatzes im Urheberrecht
- Die Schutzrechte von ausübenden Künstlern unter dem Gesichtspunkt von Staatsverträgen
- Die Rolle des persönlichkeitsrechtlichen Mindestschutzes im Urheberrecht
- Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Entscheidung auf die Musikbranche
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz der Phil-Collins-Entscheidung für das Urheberrecht dar.
Kapitel II analysiert das Urheberrecht vor der Entscheidung des EuGH, wobei der Fokus auf den Anwendungsbereich des deutschen Urheberrechtsgesetzes (UrhG) liegt.
Kapitel III widmet sich der Analyse der Phil-Collins-Entscheidung und beleuchtet den wirtschaftlichen und rechtlichen Hintergrund der Entscheidung sowie das Verfahren vor dem EuGH.
Kapitel IV untersucht die Auswirkungen der Phil-Collins-Entscheidung auf das nationale Urheberrecht. Es werden sowohl die rechtlichen als auch die wirtschaftlichen Folgen der Entscheidung beleuchtet.
Kapitel V fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Urheberrecht, Europarecht, EuGH, Phil-Collins-Entscheidung, Inländerbehandlung, Staatsverträge, ausübende Künstler, Schutzrechte, wirtschaftliche Auswirkungen, Musikbranche.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern der Phil-Collins-Entscheidung?
Der EuGH entschied 1993, dass der Grundsatz der Nichtdiskriminierung (Art. 6 EGV) verlangt, dass EU-Ausländer im Urheberrecht wie Inländer behandelt werden müssen.
Was versteht man unter „Schutzlückenpiraterie“?
Es ist der Vertrieb unautorisierter Aufnahmen (Bootlegs), der möglich war, weil bestimmte ausländische Künstler in Deutschland keinen ausreichenden gesetzlichen Schutz genossen.
Wie wirkte sich das Urteil auf das deutsche Urheberrechtsgesetz aus?
Es führte zu einer Ausweitung des Schutzes für ausübende Künstler aus anderen EU-Staaten, unabhängig von gegenseitigen Staatsverträgen.
Welche wirtschaftlichen Folgen hatte das Urteil für die Musikbranche?
Künstler und Plattenfirmen konnten den Vertrieb von Bootlegs effektiver untersagen, was ihre wirtschaftlichen Verwertungsrechte stärkte.
Was ist der „persönlichkeitsrechtliche Mindestschutz“?
Dies ist ein Grundschutz, der Künstlern zusteht, um die Entstellung ihrer Werke oder unbefugte Veröffentlichungen zu verhindern.
- Quote paper
- Kristina Thürk (Author), 2003, Die Phil Collins-Entscheidung des EuGA und die nationalen und europarechtlichen Auswirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40968