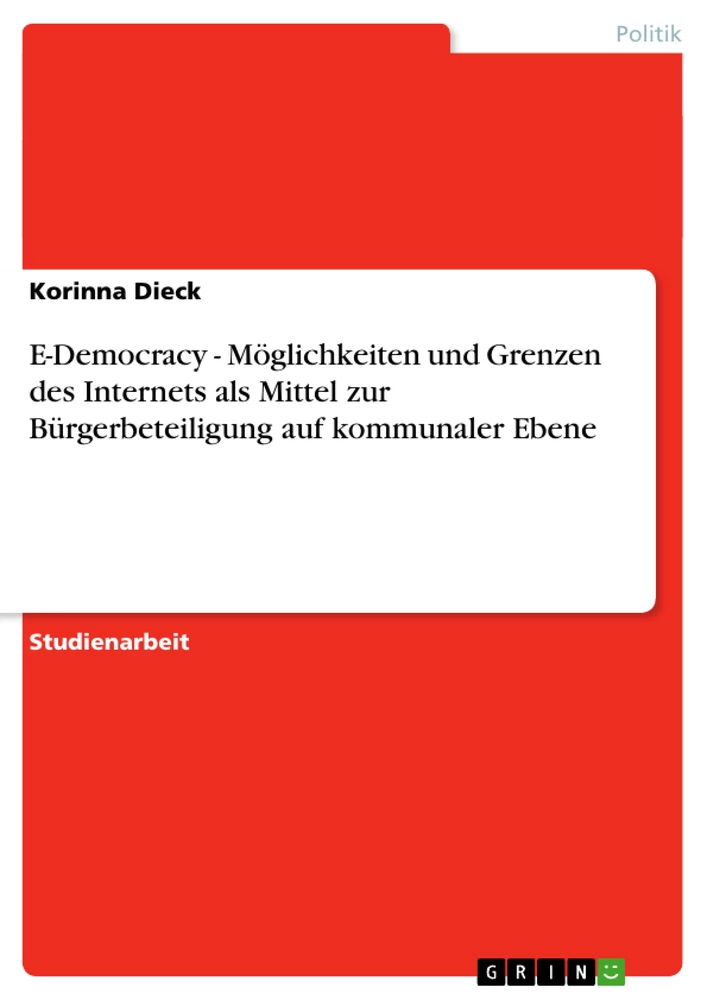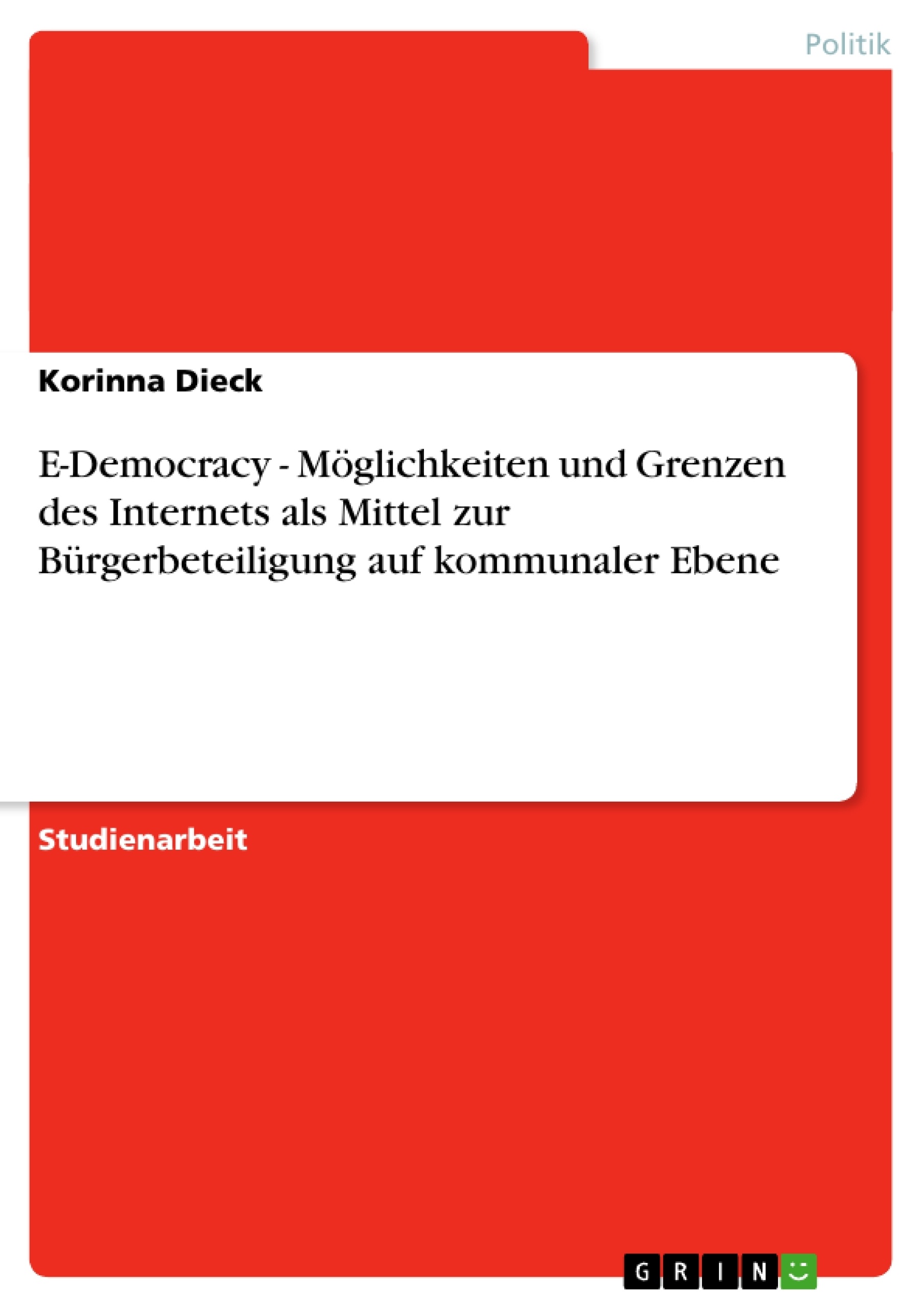Das Internet eröffnet als zusätzlicher Kommunikationskanal neuartige Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements und der breit angelegten Willensbildung. Die Politik wird im Internet zwar nicht neu erfunden, doch sie wird in den nächsten Jahren immer mehr im Internet stattfinden und über das Netz gemacht werden. 1 Von daher sind die Funktionen, die Erfolgs- und Gütekriterien, die Chancen und Gefahren zunächst dieselben wie auch bei der traditionellen Politik. Das Internet beeinflusst jedoch den Abstand zwischen den Politikern und der Bevölkerung und den gesamten politischen Prozess. In Deutschland ist der Begriff „E-Democracy“ das beherrschende Schlagwort, wenn es aus der Perspektive der Bürgerbeteiligung um Internet und Politik geht. Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit die Nutzung des Internets durch die Bürger darauf zielt, am politischen Prozess teilzunehmen, ob Online-Nutzung also die Motivation und die Fähigkeit zu politischer Partizipation positiv beeinflusst. Besonders sinnvoll erscheint der Einsatz des Internets in der Demokratie auf der kommunalen Ebene. In der Sphäre seiner alltäglichen Lebenswelt verfügt der Bürger über ein größeres Problembewusstsein und eine höhere Problemlösungskompetenz und –bereitschaft. Die kommunale Ebene ist jener Bereich, in dem eine verstärkte politische Einbindung des Bürgers erstrebenswert und am ehesten möglich ist.2 Auf kommunaler Ebene lassen sich die Potentiale des Internets besonders gut ausschöpfen: Hier kann das Internet nicht nur Prozesse der sozialen Vernetzung unterstützen, die realen Begegnungen einleiten und rein virtuelle Kontakte überwinden, sondern auch konkret für die Organisation politischer Projekte und Programme angewendet werden, so dass Informationen und Gesprächen Handlungen folgen können. 3 In dieser Seminararbeit soll geklärt werden, welche Chancen und Risiken, welche Vor- und Nachteile der Einsatz des World Wide Webs auf der kommunalen Ebene birgt. Wie wirkt sich die Internetnutzung auf den Willensbildungsprozess aus? Kann das Internet das bürgerschaftliche Engagement stärken? In einem Exkurs sollen die Ergebnisse der Studie „Elektronische Bürgerbeteiligung in deutschen Großstädten 2004“ der Initiative EParticipation vorgestellt werden, die aufzeigt, welche Tendenzen die „E-Participation“ in der Kommunalpolitik zeigt. In einem abschließenden Ausblick werden zukünftige mögliche Entwicklungen dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Begriffsklärung „bürgerschaftliches Engagement“ und „E-Democracy“.
- 3. Nutzungsformen des Internets in der Kommunalpolitik:
- Informations- und Interaktions-Systeme........
- 4. Grenzen und Risiken des Internets in der Bürgerbeteiligung Kommunale
- ...4
- ....15
- 5. Exkurs: Ergebnisse der Studie der Initiative E-Participation: „Elektronische Bürgerbeteiligung in deutschen Großstädten 2004“
- ..............
- .................21
- 6. Ausblick......
- 7. Literaturliste........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen des Internets als Mittel zur Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene. Sie analysiert, wie das Internet den Willensbildungsprozess beeinflusst und ob es das bürgerschaftliche Engagement stärken kann.
- Chancen und Risiken des Internets in der kommunalen Politik
- Auswirkungen der Internetnutzung auf den Willensbildungsprozess
- Potenzial des Internets zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
- Vergleichende Analyse von E-Participation-Strategien in deutschen Großstädten
- Zukünftige Entwicklungen in der E-Democracy
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Bedeutung des Internets für die politische Kommunikation und Bürgerbeteiligung. Kapitel 2 definiert die Begriffe „bürgerschaftliches Engagement“ und „E-Democracy“. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Nutzungsformen des Internets in der Kommunalpolitik, insbesondere mit Informations- und Interaktions-Systemen. Kapitel 4 untersucht die Grenzen und Risiken des Internets in der Bürgerbeteiligung. Ein Exkurs in Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Studie „Elektronische Bürgerbeteiligung in deutschen Großstädten 2004“ der Initiative E-Participation. Der Ausblick in Kapitel 6 beleuchtet zukünftige Entwicklungen in der E-Democracy.
Schlüsselwörter
E-Democracy, Bürgerbeteiligung, Kommunalpolitik, Internet, Willensbildung, Partizipation, Informations- und Interaktionssysteme, Risiken und Grenzen, E-Participation, Studie, Ausblick.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „E-Democracy“?
Er beschreibt die Nutzung des Internets und digitaler Medien zur Unterstützung demokratischer Prozesse und zur Steigerung der Bürgerbeteiligung.
Warum ist die kommunale Ebene besonders für E-Democracy geeignet?
Bürger haben in ihrem direkten Lebensumfeld ein höheres Problembewusstsein und eine größere Bereitschaft, sich an konkreten Projekten zu beteiligen.
Welche Chancen bietet das Internet für die Bürgerbeteiligung?
Es dient als zusätzlicher Kommunikationskanal, fördert die soziale Vernetzung und ermöglicht eine breit angelegte Willensbildung unabhängig von Ort und Zeit.
Welche Risiken gibt es bei der elektronischen Partizipation?
Zu den Risiken gehören die digitale Spaltung (nicht jeder hat Zugang), Datenschutzbedenken und die Gefahr einer rein virtuellen Kommunikation ohne reale Taten.
Was war das Ergebnis der Studie zur E-Participation 2004?
Die Studie untersuchte Tendenzen in deutschen Großstädten und zeigte auf, wie weit Informations- und Interaktionssysteme bereits verbreitet waren.
- Quote paper
- Dipl.-Journ. Korinna Dieck (Author), 2005, E-Democracy - Möglichkeiten und Grenzen des Internets als Mittel zur Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41017