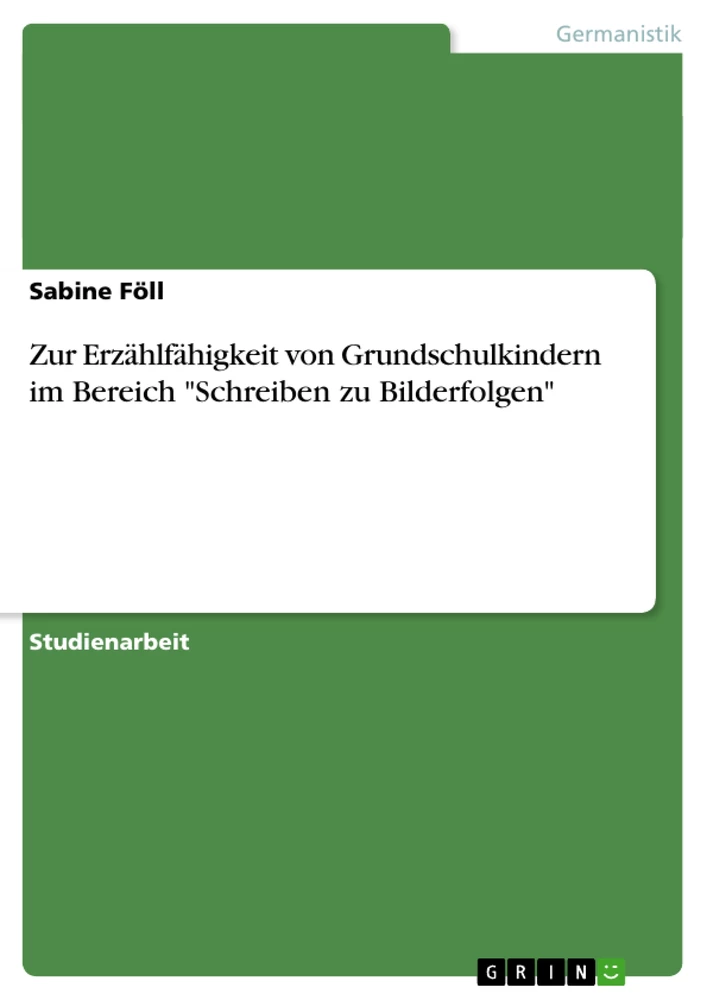Schriftliches Erzählen hat in der Schule seinen festen Platz. Praktisch vom erfolgreichen Schriftspracherwerb an bis hin zur Abschlussprüfung wird es in jeder Klasse ständig prakti-ziert. Dabei können die unterschiedlichsten Schreibanlässe Ausgangspunkt einer Erzählung sein. Diese Arbeit beschäftigt sich mit einem davon: dem Erzählen zu Bilderfolgen.
In der ersten Hälfte der Seminararbeit sollen einige theoretische Grundlagen geklärt werden, die für einen Umgang mit Erzählungen jeglicher Art im Unterricht unbedingt notwendig:
Zu Beginn möchte ich versuchen, den Begriff „Erzählen“ etwas zu erläutern, wobei ein tiefes Eintauchen in diese weitreichende Thematik nicht möglich sein wird; dies würde den Umfang dieser Seminararbeit sprengen.
Obwohl Erzählen seit Kindesbeinen an zum Alltag eines jeden Menschen gehört, kann nicht jeder automatisch gut erzählen. Die Erzählfähigkeit eines Menschen muss sich erst ausbil-den. Eine Gruppe um DIETRICH BOUEKE konnte als Resultat einer groß angelegten Unter-suchung zum Erzählverhalten von Kindern ein Modell entwerfen, welches die stufenartig er-folgende Entwicklung der Erzählfähigkeit aufzeigt. Die Darstellung dieses Modell soll im An-schluss an die Annäherung an den „Erzähl“-Begriff folgen. Jedoch sei auch hier vorwegge-nommen, dass in diesem Rahmen nur ein oberflächlicher Überblick darüber gegeben werden kann
Das darauffolgende Kapitel beschäftigt sich mit der Stellung des mündlichen und schriftli-chen Erzählens in der Schule. Dabei wird die häufig geäußerte Kritik über die diskriminieren-de Behandlung des mündlichen Erzählens gegenüber dem schriftlichen Erzählen aufgezeigt.
Das 5. Kapitel wendet sich schließlich dem Erzählen zu Bilderfolgen zu. Dabei steht die Fra-ge im Mittelpunkt, ob Bildergeschichten ein geeigneter Schreibanlass für schriftliche Erzäh-lungen sind oder nicht. Um selber einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, wie Kinder zu Bildergeschichten erzählen (können), habe ich vor einigen Wochen zwei Mädchen aus meinem Bekanntenkreis im Alter von 8;10 und 9;1 Jahren gebeten, mir zu der Bilderge-schichte „Der unschuldige Hund“ von Hans Kossatz eine Erzählung aufzuschreiben.
Eine kurze Analyse dieser Texte, bei der ich die narrativen Fähigkeiten der Kinder untersu-chen möchte und diese anschließend im Entwicklungsmodell von BOUEKE ET AL. einzu-ordnen versuche, sollen den Abschluss meiner Arbeit bilden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Begriff „Erzählen“
- 3. Entwicklung der Erzählfähigkeit
- 4. Erzählen in der Schule
- 4.1 Schriftliches vs. mündliches Erzählen
- 4.2 Schriftliche Erzählformen
- 5. Bildergeschichten
- 5.1 Formen
- 5.2 Bildergeschichten als Schreibanlässe
- 5.3 „Der unschuldige Hund“ von Hans Kossatz
- 6. Analyse zweier Schülertexte
- 6.1 Zielsetzung
- 6.2 Ninas Erzählung
- 6.3 Sandras Erzählung
- 7. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Erzählfähigkeit von Grundschulkindern anhand des Schreibanlasses „Bildergeschichten“. Die Arbeit beleuchtet theoretische Grundlagen des Erzählens, vergleicht mündliches und schriftliches Erzählen im schulischen Kontext und analysiert Schülertexte, um die Entwicklung der Erzählfähigkeit im Modell von Boueke et al. zu verorten.
- Der Begriff „Erzählen“ und seine verschiedenen Facetten.
- Die Entwicklung der Erzählfähigkeit bei Kindern.
- Der Vergleich von mündlichem und schriftlichem Erzählen im Unterricht.
- Bildergeschichten als Schreibanlass für Kinder.
- Analyse der narrativen Fähigkeiten von Grundschulkindern anhand konkreter Schülertexte.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema schriftliches Erzählen im Unterricht ein und benennt das Erzählen zu Bilderfolgen als spezifischen Schreibanlass. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit theoretischen Grundlagen des Erzählens, der Entwicklung der Erzählfähigkeit und der Analyse von Schülertexten zu einer Bildergeschichte befasst. Die Arbeit fokussiert auf die Untersuchung der narrativen Fähigkeiten von Grundschulkindern und deren Einordnung in ein bestehendes Entwicklungsmodell.
2. Zum Begriff „Erzählen“: Dieses Kapitel beleuchtet den vielschichtigen Begriff „Erzählen“ und die Schwierigkeiten, eine allgemeingültige Definition zu finden. Es werden unterschiedliche Perspektiven vorgestellt, die den Begriff mal eng (auf selbsterlebte Ereignisse beschränkt) und mal weit (inklusive erfundener oder gehörter Ereignisse) fassen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Erzählbarkeit und dem subjektiven Empfinden von „Erzählenswertigkeit“, welches sowohl vom Erzähler als auch vom Zuhörer abhängt. Der Wunsch des Erzählers zu kommunizieren und die „Erzählenswertigkeit“ der Geschichte werden als zentrale Aspekte hervorgehoben.
3. Entwicklung der Erzählfähigkeit: Dieses Kapitel beschreibt die stufenartige Entwicklung der Erzählfähigkeit bei Kindern. Es wird auf ein Modell von Dietrich Boueke verwiesen, welches die Entwicklung der Erzählfähigkeit detailliert darstellt. Obwohl die Arbeit nur einen oberflächlichen Überblick über das Modell gibt, wird dessen Bedeutung für das Verständnis der kindlichen Erzählentwicklung betont. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit, die jeweilige Entwicklungsstufe beim Umgang mit Kindererzählungen zu berücksichtigen.
4. Erzählen in der Schule: Dieses Kapitel behandelt die Rolle des mündlichen und schriftlichen Erzählens im Unterricht. Es wird die häufig kritisierte Benachteiligung des mündlichen Erzählens im Vergleich zum schriftlichen Erzählen angesprochen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung beider Formen für die Entwicklung der Erzählkompetenz von Kindern und die Notwendigkeit, beide Formen gleichermaßen im Unterricht zu fördern.
5. Bildergeschichten: Dieses Kapitel widmet sich der Thematik des Erzählens zu Bilderfolgen. Es untersucht die Eignung von Bildergeschichten als Schreibanlass für schriftliche Erzählungen. Die Autorin präsentiert zwei Schülertexte zu der Bildergeschichte „Der unschuldige Hund“ von Hans Kossatz als Grundlage für die spätere Analyse. Diese Auswahl dient dazu, einen direkten Einblick in die Erzählfähigkeiten von Grundschulkindern zu geben und die theoretischen Überlegungen praktisch zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Erzählfähigkeit, Grundschulkindern, Schreiben zu Bilderfolgen, mündliches Erzählen, schriftliches Erzählen, narratives Lernen, Erzählentwicklung, Bildergeschichten, Schülertextanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Erzählfähigkeit von Grundschulkindern
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Erzählfähigkeit von Grundschulkindern, insbesondere anhand des Schreibanlasses „Bildergeschichten“. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Erzählens, vergleicht mündliches und schriftliches Erzählen im schulischen Kontext und analysiert Schülertexte, um die Entwicklung der Erzählfähigkeit im Modell von Boueke et al. zu verorten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Begriff „Erzählen“ und seine Facetten, die Entwicklung der Erzählfähigkeit bei Kindern, der Vergleich von mündlichem und schriftlichem Erzählen im Unterricht, Bildergeschichten als Schreibanlass für Kinder und die Analyse der narrativen Fähigkeiten von Grundschulkindern anhand konkreter Schülertexte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Zum Begriff „Erzählen“, Entwicklung der Erzählfähigkeit, Erzählen in der Schule (mit Unterkapiteln zu schriftlichem vs. mündlichem Erzählen und schriftlichen Erzählformen), Bildergeschichten (mit Unterkapiteln zu Formen, Bildergeschichten als Schreibanlässe und Analyse von „Der unschuldige Hund“), Analyse zweier Schülertexte (mit Unterkapiteln zu Zielsetzung, Ninas Erzählung und Sandras Erzählung) und Schluss.
Wie wird der Begriff „Erzählen“ definiert?
Die Arbeit beleuchtet die Vielschichtigkeit des Begriffs „Erzählen“ und die Schwierigkeiten, eine allgemeingültige Definition zu finden. Sie präsentiert unterschiedliche Perspektiven, die den Begriff mal eng (auf selbsterlebte Ereignisse beschränkt) und mal weit (inklusive erfundener oder gehörter Ereignisse) fassen. Die Bedeutung der Erzählbarkeit und die subjektive „Erzählenswertigkeit“ werden als zentrale Aspekte hervorgehoben.
Wie wird die Entwicklung der Erzählfähigkeit dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die stufenartige Entwicklung der Erzählfähigkeit bei Kindern, wobei auf ein Modell von Dietrich Boueke et al. verwiesen wird. Obwohl nur ein oberflächlicher Überblick gegeben wird, wird die Bedeutung des Modells für das Verständnis der kindlichen Erzählentwicklung betont. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit, die jeweilige Entwicklungsstufe beim Umgang mit Kindererzählungen zu berücksichtigen.
Welche Rolle spielt das mündliche und schriftliche Erzählen im Unterricht?
Die Arbeit behandelt die Rolle von mündlichem und schriftlichem Erzählen im Unterricht und spricht die häufig kritisierte Benachteiligung des mündlichen Erzählens an. Sie betont die Bedeutung beider Formen für die Entwicklung der Erzählkompetenz von Kindern und die Notwendigkeit, beide Formen gleichermaßen im Unterricht zu fördern.
Welche Bedeutung haben Bildergeschichten in der Arbeit?
Bildergeschichten werden als Schreibanlass für schriftliche Erzählungen untersucht. Die Arbeit präsentiert zwei Schülertexte zu der Bildergeschichte „Der unschuldige Hund“ von Hans Kossatz als Grundlage für die Analyse. Diese Auswahl dient dazu, einen direkten Einblick in die Erzählfähigkeiten von Grundschulkindern zu geben und die theoretischen Überlegungen praktisch zu veranschaulichen.
Welche Schülertexte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei Schülertexte (von Nina und Sandra) zu der Bildergeschichte „Der unschuldige Hund“ von Hans Kossatz, um die narrativen Fähigkeiten von Grundschulkindern zu untersuchen und in das Entwicklungsmodell einzuordnen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erzählfähigkeit, Grundschulkindern, Schreiben zu Bilderfolgen, mündliches Erzählen, schriftliches Erzählen, narratives Lernen, Erzählentwicklung, Bildergeschichten, Schülertextanalyse.
- Citar trabajo
- Sabine Föll (Autor), 2004, Zur Erzählfähigkeit von Grundschulkindern im Bereich "Schreiben zu Bilderfolgen", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41034