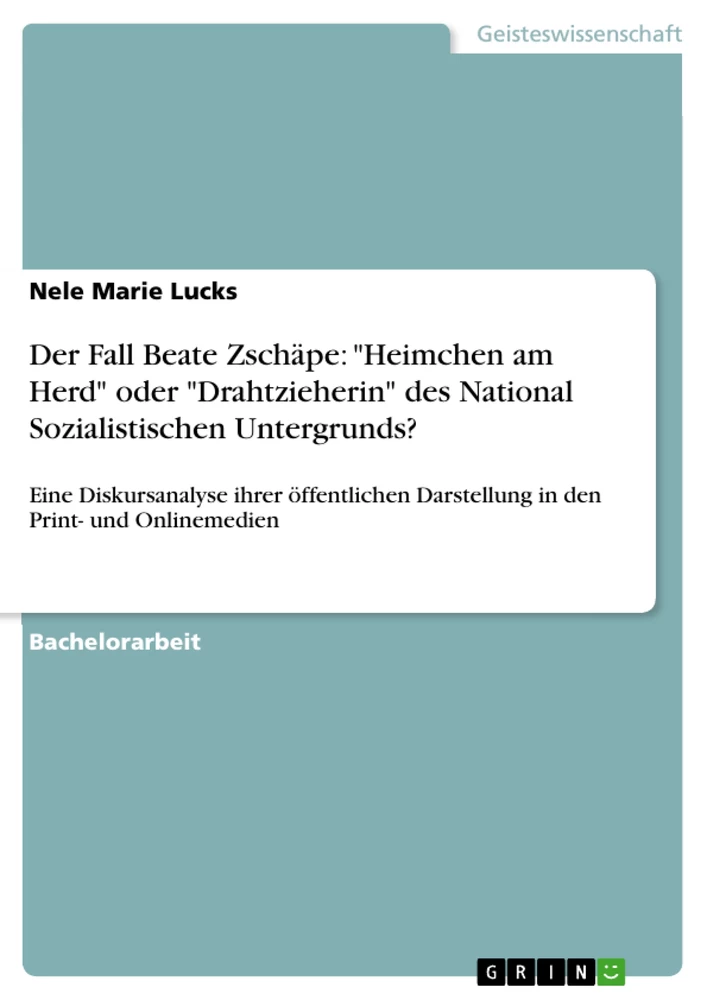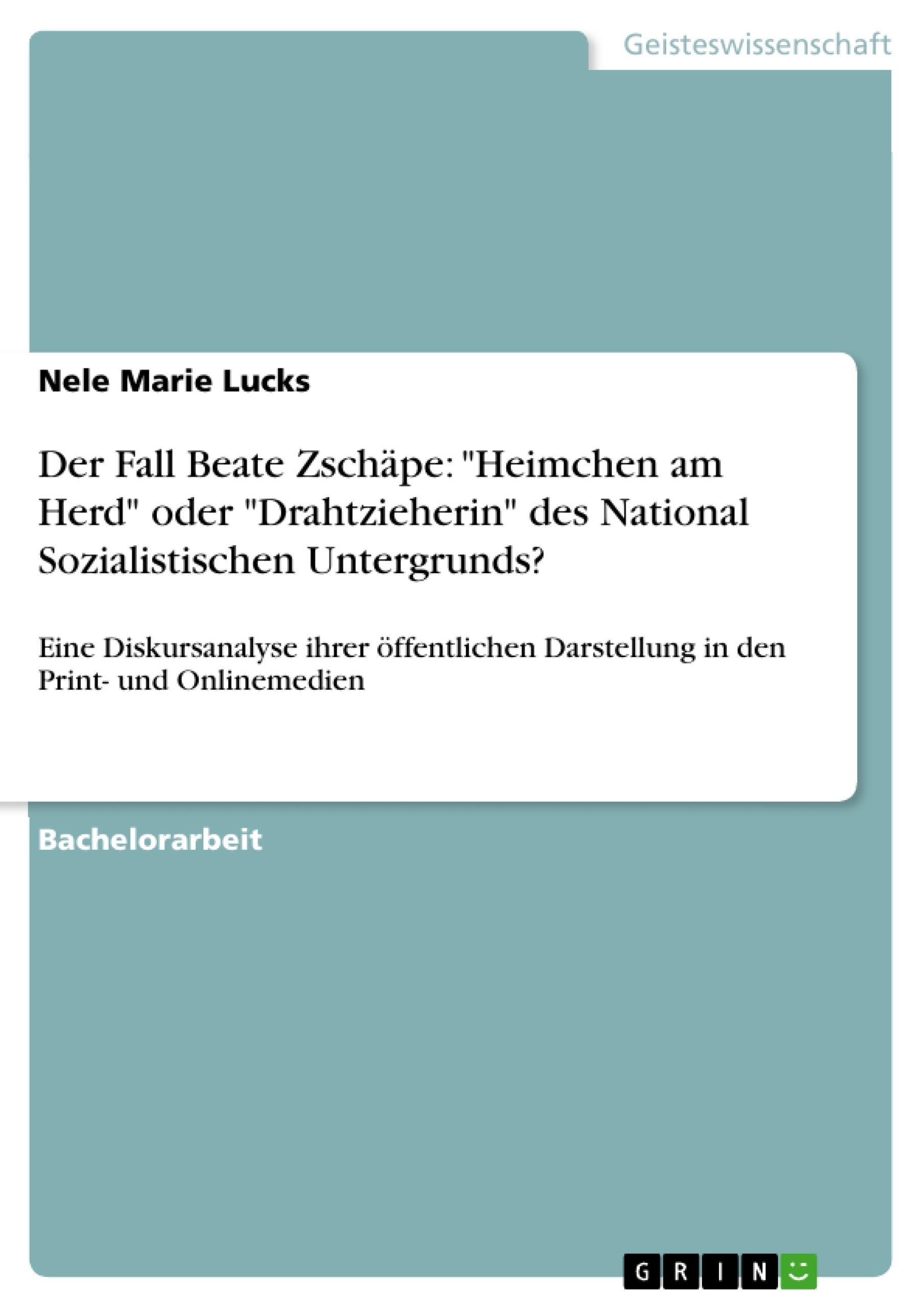Mit Spannung erwartete die Öffentlichkeit den ersten Tag des „Jahrhundertprozesses“ am 6. Mai 2013 in München. Vor Gericht steht die 38-Jährige Beate Zschäpe, die das einzige weibliche Mitglied der Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) war. Beschuldigt wird die Angeklagte der Mittäterinnenschaft an zehn Morden, zwei Sprengstoffanschlägen, eine Brandstiftung mit versuchter Tötung und der Beihilfe zu 15 Raubüberfällen. Schon durch die Verschiebung des Prozessauftaktes auf den 6. Mai 2013, ausgelöst durch die Kritik am Akkreditierungsverfahren der ausländischen Journalisten, wurde die Brisanz am „Fall Beate Zschäpe“ deutlich. In dieser Arbeit soll die besondere Rolle von Beate Zschäpe in den überregionalen Wochen- und Tageszeitungen herausgearbeitet und analysiert werden. Durch die erhöhte mediale Berichterstattung über den Fall und die Person Zschäpe, stellen sich die Fragen mit welchen diskursiven und stilistischen Mitteln wird Beate Zschäpe neben Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt dargestellt und welche Bilder stellen die Medien her? Welche Geschlechterbilder werden hierbei aufgegriffen und inwieweit lassen sich diese differenzieren? Zudem soll die Frage geklärt werden, ob die Medien sich von den vorherrschenden Geschlechter-Diskursen leiten lassen und immer noch ein Klischeebehaftetes Bild von rechten und kriminellen Frauen wiederspiegeln oder hat sich diese Sichtweise geändert? Im ersten Teil dieser Arbeit soll auf die verschiedenen Geschlechterideologien in der rechten Szene eingegangen werden. Die hier erläuterten Geschlechterbilder, wurden von der Soziologin und Rechtsextremismus-Expertin Renate Bitzan entwickelt. Es kristallisieren sich das polare und das egalitäre Geschlechterverhältnis heraus, die sich in ein traditionell-bürgerliches und ein modern-bürgerliches Modell differenzieren lassen. Um ein Grundwissen über die Zwickauer Terrorzelle zu bekommen, wird folgend zusammenfassend erläutert, wie diese entstand und welche Taten sie beging. Mit dem Suizid von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt am 4. November 2011 und der Brandstiftung in der gemeinsamen Wohnung, die Beate Zschäpe am gleichen Tag beging, offenbarte sich der Hintergrund der rechtsextremistischen Taten, die bislang nur als „Döner- Morde“ bekannt waren. Nach einem Banküberfall konnte die Polizei den Aufenthaltsort von Mundlos und Böhnhardt ausfindig machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschlechterideologien in der rechten Szene
- 2.1. Rechtsextremismus
- 2.2. Einführung in den Forschungsstand
- 2.3. Polares Geschlechtermodell
- 2.4. Egalitäres Geschlechtermodell
- 3. Zwischenfazit
- 4. Die Darstellung krimineller Frauen in den Medien
- 5. Methode
- 5.1. Wissenssoziologische Diskursanalyse
- 5.2. Diskursbegriff
- 6. Empirische Untersuchungen
- 6.1. Planung und Durchführung der Erhebung
- 6.1.1. Das Material
- 6.1.1.2. Vorstellung der analysierten Zeitungen
- 6.1.2. Der Zeitraum
- 6.1.3. Theoretische Verallgemeinerung am Einzelfall
- 6.2. Vorgehensweise zur Analyse
- 6.2.1. Das Prinzip der Sequenzialität
- 6.2.2. Diskursstränge
- 7. Analyse
- 7.1. Analyse Online-Ausgabe BILD
- 7.2. Analyse Zeit Online
- 7.3. Analyse Online-Ausgabe taz
- 7.4. Analyse Print-Ausgabe Die Welt
- 8. Erstellung der Gesamtanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die mediale Darstellung von Beate Zschäpe im Kontext des NSU-Prozesses. Ziel ist es, die diskursiven und stilistischen Mittel zu analysieren, mit denen Zschäpe in Print- und Onlinemedien präsentiert wird, und die dabei konstruierten Geschlechterbilder zu untersuchen. Es wird die Frage beleuchtet, inwieweit die Medien von vorherrschenden Geschlechterdiskursen beeinflusst sind und ob Klischees über rechte und kriminelle Frauen reproduziert werden.
- Die Rolle von Beate Zschäpe im NSU und ihre mediale Darstellung
- Analyse der Geschlechterideologien in der rechten Szene
- Untersuchung der diskursiven Strategien in der Berichterstattung über Zschäpe
- Die Konstruktion von Geschlechterbildern in den Medien
- Der Einfluss von Geschlechterdiskursen auf die mediale Berichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext des NSU-Prozesses und die zentrale Rolle von Beate Zschäpe. Sie formuliert die Forschungsfrage, die sich mit der medialen Darstellung Zschäpes und den verwendeten diskursiven Strategien auseinandersetzt. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der medialen Konstruktion von Zschäpes Rolle und den damit verbundenen Geschlechterbildern in den Fokus. Die Brisanz des Falles wird durch die Verzögerung des Prozessauftaktes unterstrichen.
2. Geschlechterideologien in der rechten Szene: Dieses Kapitel analysiert die Geschlechterideologien innerhalb der rechtsextremen Szene. Es wird auf die Arbeit von Renate Bitzan Bezug genommen, die polare und egalitäre Geschlechtermodelle in der rechtsextremen Szene beschreibt. Das Kapitel dient als theoretischer Rahmen für die Analyse der medialen Darstellung von Zschäpe und legt die Grundlage für die Interpretation der Geschlechterbilder, die in den Medien konstruiert werden. Die Unterscheidung zwischen traditionellen und modernen bürgerlichen Modellen wird hier genauer betrachtet und ihre Relevanz für das Verständnis der Rolle der Frau im Rechtsextremismus herausgearbeitet.
4. Die Darstellung krimineller Frauen in den Medien: Dieses Kapitel behandelt die etablierten Darstellungsweisen krimineller Frauen in den Medien. Es legt den Fokus auf bereits bestehende Klischees und Stereotype, die in der Berichterstattung über weibliche Straftäterinnen vorkommen können. Dieses Kapitel dient als Vergleichsrahmen für die spätere Analyse der medialen Darstellung von Beate Zschäpe. Es wird untersucht, ob und inwiefern die Berichterstattung über Zschäpe diese Stereotypen reproduziert oder subvertiert. Der Einfluss von gesellschaftlichen Geschlechtervorstellungen auf die mediale Rezeption wird hier thematisiert.
5. Methode: Das Kapitel erläutert die wissenschaftliche Methode der wissenssoziologischen Diskursanalyse, die in dieser Arbeit angewendet wird. Es definiert den Diskursbegriff und beschreibt die Vorgehensweise bei der Analyse von Texten. Die Auswahl dieser Methode wird begründet und ihre Eignung für die Untersuchung der medialen Darstellung von Beate Zschäpe herausgestellt. Der Fokus liegt auf der systematischen Analyse der verwendeten Sprache und deren Einfluss auf die Konstruktion von Bedeutung.
6. Empirische Untersuchungen: Dieses Kapitel beschreibt die Planung und Durchführung der empirischen Untersuchung. Es wird detailliert auf das verwendete Material, den Zeitraum und die analytische Vorgehensweise eingegangen. Das Kapitel erläutert die Auswahl der Medien und die Kriterien für die Auswahl der analysierten Artikel. Die Methodologie der sequenziellen Analyse und die Identifizierung von Diskurssträngen werden genauer erläutert und ihre Bedeutung für die Analyse der medialen Darstellung von Beate Zschäpe hervorgehoben.
7. Analyse: Dieses Kapitel präsentiert die Analyse von ausgewählten Artikeln aus verschiedenen Medien (BILD, Zeit Online, taz, Die Welt). Es werden einzelne Artikel detailliert analysiert und die darin verwendeten diskursiven Strategien, sowie die Konstruktion von Zschäpes Rolle und den damit verbundenen Geschlechterbildern herausgearbeitet. Jedes Unterkapitel konzentriert sich auf ein spezifisches Medium und dessen spezifische Darstellung von Beate Zschäpe, die jeweils im Kontext des gesamten Kapitels diskutiert werden.
8. Erstellung der Gesamtanalyse: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Einzelanalysen zusammen und synthetisiert sie zu einer umfassenden Gesamtanalyse der medialen Darstellung von Beate Zschäpe. Es integriert die Ergebnisse der Kapitel 6 und 7 und stellt die zentralen Erkenntnisse über die Konstruktion von Zschäpes Rolle und den verwendeten Geschlechterbildern dar. Das Kapitel zieht aus den Einzelanalysen Schlussfolgerungen und bündelt diese zu einem Gesamtbild.
Schlüsselwörter
Beate Zschäpe, Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), Rechtsextremismus, Geschlechterideologien, Medienanalyse, Diskursanalyse, Wissenssoziologie, mediale Darstellung, Geschlechterbilder, Klischees, Terrorismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Mediale Darstellung von Beate Zschäpe im Kontext des NSU-Prozesses
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die mediale Darstellung von Beate Zschäpe im Kontext des NSU-Prozesses. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der diskursiven und stilistischen Mittel, mit denen Zschäpe in Print- und Onlinemedien präsentiert wird, und der dabei konstruierten Geschlechterbilder.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht, inwieweit die Medien von vorherrschenden Geschlechterdiskursen beeinflusst sind und ob Klischees über rechte und kriminelle Frauen in der Berichterstattung über Beate Zschäpe reproduziert werden.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet die wissenssoziologische Diskursanalyse zur Analyse der medialen Texte. Es wird die sequenzielle Analyse von Diskurssträngen angewendet, um die Konstruktion von Bedeutung und die verwendeten diskursiven Strategien zu untersuchen.
Welche Medien werden analysiert?
Die Analyse umfasst ausgewählte Artikel aus den Online-Ausgaben von BILD und der taz, der Online-Ausgabe von Zeit Online und der Print-Ausgabe von Die Welt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Geschlechterideologien in der rechten Szene, Zwischenfazit, Die Darstellung krimineller Frauen in den Medien, Methode, Empirische Untersuchungen, Analyse und Erstellung der Gesamtanalyse. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Wie werden Geschlechterideologien in der rechten Szene behandelt?
Das Kapitel zu Geschlechterideologien in der rechten Szene analysiert polare und egalitäre Geschlechtermodelle im Rechtsextremismus, basierend auf der Arbeit von Renate Bitzan. Es dient als theoretischer Rahmen für die Interpretation der in den Medien konstruierten Geschlechterbilder.
Wie werden die empirischen Untersuchungen durchgeführt?
Die empirischen Untersuchungen beschreiben detailliert das verwendete Material (ausgewählte Zeitungsartikel), den Zeitraum der Analyse und die Vorgehensweise. Die Methodologie der sequenziellen Analyse und die Identifizierung von Diskurssträngen werden erläutert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel "Analyse" präsentiert detaillierte Analysen ausgewählter Artikel aus verschiedenen Medien. Das Kapitel "Erstellung der Gesamtanalyse" fasst die Ergebnisse zusammen und synthetisiert sie zu einer umfassenden Gesamtanalyse der medialen Darstellung von Beate Zschäpe, einschließlich der konstruierten Geschlechterbilder.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Beate Zschäpe, Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), Rechtsextremismus, Geschlechterideologien, Medienanalyse, Diskursanalyse, Wissenssoziologie, mediale Darstellung, Geschlechterbilder, Klischees, Terrorismus.
Welche Rolle spielt Beate Zschäpe in der Arbeit?
Beate Zschäpe ist der zentrale Fokus der Arbeit. Die Arbeit analysiert, wie ihre Rolle im NSU-Kontext von den untersuchten Medien dargestellt und welche Geschlechterbilder dabei konstruiert werden.
- Citation du texte
- BA Nele Marie Lucks (Auteur), 2013, Der Fall Beate Zschäpe: "Heimchen am Herd" oder "Drahtzieherin" des National Sozialistischen Untergrunds?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/411897