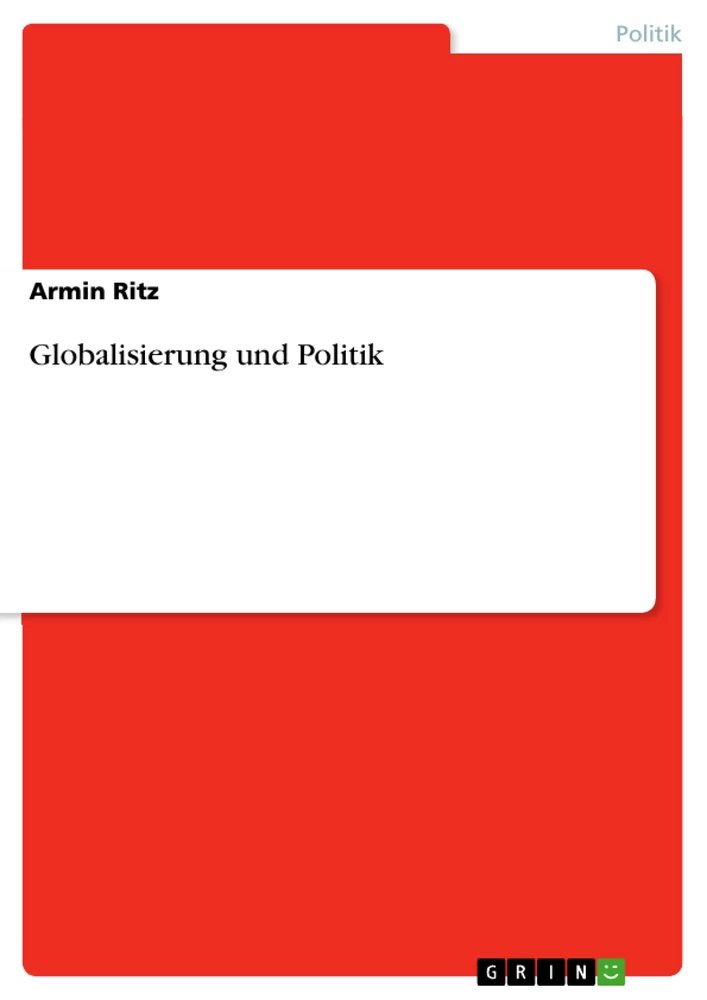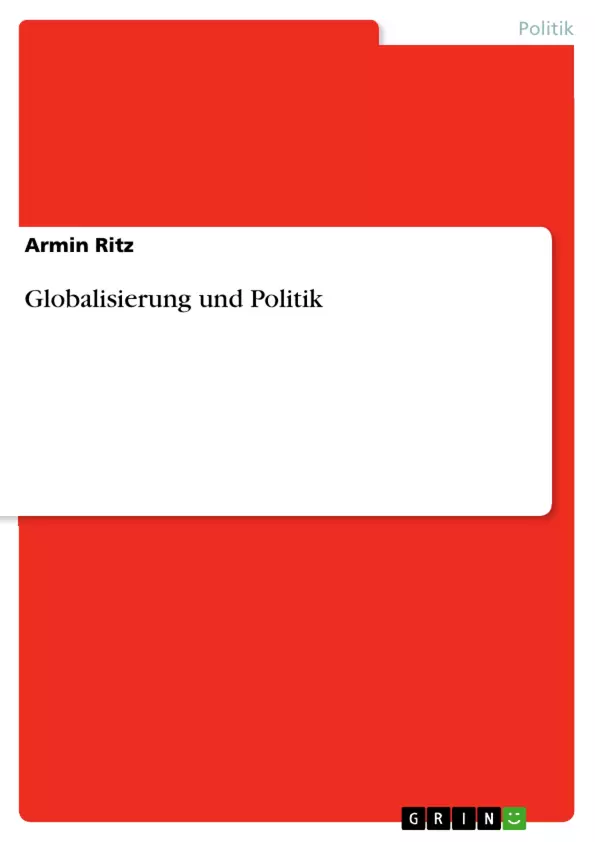Jeremy Bentham hat 1780 zum ersten Mal den Begriff internationale Beziehungen geprägt. Das erfolgte zu einem Zeitpunkt, als das koloniale England mit seiner aufkommenden Industrie Märkte benötigte, die über seinen politischen Einflussbereich hinausgingen. Damals war das westfälische System souveräner Staaten, mit dem das christliche Imperium des Mittelalters abgelöst worden war, bereits mehr als hundert Jahre alt.
In den letzten Jahrzehnten wird immer mehr von Globalisierung gesprochen. Ist auch damit ein Begriff entstanden, der sich angesichts der Realitäten erst verspätet durchgesetzt hat?
Inhalt
1. Vielschichtiges Phänomen
2. Neues an der Globalisierung
3. Kritische Stimmen
4. Staatliche Reaktionen nach der Industrialisierung
5. UNO als Forum politischer Zusammenarbeit
6. UNO-Tätigkeiten in weiteren Bereichen
7. Zunahme regionaler Organisationen
8. Transregionale Spezialorganisationen
9. Zukunft mit Fragen
10.Literaturhinweise
1. Vielschichtiges Phänomen
Jeremy Bentham hat 1780 zum ersten Mal den Begriff internationale Beziehungen geprägt. Das erfolgte zu einem Zeitpunkt, als das koloniale England mit seiner aufkommenden Industrie Märkte benötigte, die über seinen politischen Einflussbereich hinausgingen. Damals war das westfälische System souveräner Staaten, mit dem das christliche Imperium des Mittelalters abgelöst worden war, bereits mehr als hundert Jahre alt.
In den letzten Jahrzehnten wird immer mehr von Globalisierung gesprochen. Ist auch damit ein Begriff entstanden, der sich angesichts der Realitäten erst verspätet durchgesetzt hat?
Für Experten gibt es drei Stufen grenzüberschreitender Beziehungen:
- Als international werden jene bezeichnet, bei denen Staaten die zentrale Rolle spielen.
- Für transnational gelten Verhältnisse, wenn neben Staaten multinationale Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen auf der Weltbühne an Einfluss gewinnen.
- Unter global wird schliesslich verstanden, dass auch der einzelne Bürger nicht bloss als Objekt, sondern als Subjekt an grenzüberschreitenden Aktivitäten beteiligt ist.
Dennoch bleibt umstritten, was Globalisierung letztlich bedeutet. Unter dem Strich lässt sich sagen, der Begriff bringe zum Ausdruck, dass für soziale Interaktionen staatliche Grenzen an Bedeutung verlieren.
Der Tatsache wird nach wie vor kontrovers begegnet. Die einen sehen darin die Möglichkeit, individuelle Freiheit und materielles Wohlergehen weltweit zu verbreiten. Andere möchten das Rad der Geschichte zurückdrehen, um vergangenes Glück ihrer Gemeinschaft wiederherzustellen. Progressive, aber kritisch eingestellte Kräfte befürchten, dass das heutige Modell der Globalisierung den Unterschied zwischen Arm und Reich verschärft und zu einem untragbaren Verschleiss von Ressourcen führt. Neo-Marxisten sind weiterhin überzeugt, dass wir den baldigen Zusammenbruch des internationalen Kapitalismus erleben werden. Alt gediente Realisten behaupten schliesslich, die Aufregung um die Globalisierung sei übertrieben, denn an den grundlegenden Strukturen des internationalen Staatensystems habe sich wenig verändert.
Für Historiker, die politischen Kontroversen zu entgehen suchen, ist Globalisierung nicht ein völlig neues Phänomen, weil Ansätze dafür schon viel früher bestanden hätten.
Einige von ihnen gehen Jahrtausende zurück, indem sie etwa daran erinnern, dass die Nachkommen unserer afrikanischen Vorfahren über Asien, Europa und Nordamerika um das Jahr 12 000 v. Chr. bis nach Südamerika gelangten, um den letzten Kontinent der Erde zu besiedeln. Natürlich handelte es sich um Jäger und Sammler, die kaum Kontakte zu den von ihnen verlassenen Gebieten aufrechterhielten.
Andere erinnern daran, dass sich um das Jahr 10 000 v. Chr. die ersten Nomaden sesshaft machten. Das erfolgte zunächst im eurasischen Raum, wo die Bedingungen für die Landwirtschaft günstig waren. Damit waren Nahrungsmittel leichter herzustellen, was die Herausbildung differenzierter Gesellschaften ermöglichte:
- die sesshaften Bauern blieben tragendes Element,
- mehr und mehr entstand eine Klasse von Handwerkern, welche die für die Produktion benötigten Instrumente zu verbessern suchten,
- gleichzeitig bildeten sich Kasten von Kriegern heraus, um Bauern und Handwerker vor Übergriffen der Nomaden zu schützen.
Das führte zu hierarchischen Verhältnissen, an deren Spitze meist religiöse Autoritäten standen, die von wachsenden Bürokratien unterstützt wurden.
In der Folge kam es zur Gründung von Städten an den Ufern grosser Flüsse. Um den Wohlstand zu fördern, suchten die Führungsschichten nicht nur ihr Land gegen Nomaden zu schützen, sondern über das angestammte Gebiet hinaus neue Ländereien zu erobern. So begann um 3’500 v. Chr. das Zeitalter der antiken Imperien. Einige von ihnen waren nur von kurzer Dauer, andere konnten sich über Jahrtausende erhalten.
Zunächst entstanden solche Imperien in Mesopotamien, Ägypten, Persien, Indien und China. Erst später kam in Europa das römische Reich hinzu. Nach dessen Niedergang gelang es dem Islam ab dem 7. Jahrhundert n. Chr. ein ausgedehntes Einzugsgebiet zu erobern, das weit über den Mittelmeerraum hinausging. Auf dem südamerikanischen Kontinent entstanden die Grossreiche der Azteken und der Inkas. All diesen Imperien war gemeinsam, dass sie versuchten, sich möglichst weit auf alle ihnen damals bekannten Erdteile auszudehnen, um Sicherheit und Versorgung ihrer Völker zu verbessern.
Am besten gelang das jenen, die für Landwirtschaft, Verteidigung und Herrschaftssysteme technologische Fortschritte zu erzielen vermochten. So wurden ausgeklügelte Bewässerungssysteme entwickelt und die Transportsysteme auf Binnenflüssen und den angrenzenden Meereswegen verbessert. Die Erfindung des Rades erleichterte den Landverkehr und war auch für das Kriegsgeschäft von Bedeutung. Das fast gleichzeitige Entstehen der Schrift in Ägypten, Mesopotamien und China machte die Verwaltung grosser Räume einfacher. Mit steigendem Reichtum baute man spektakuläre Heiligtümer und Paläste für die regierenden Schichten. Nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Medizin, der Mathematik und der Astronomie kam es zu Errungenschaften von bleibender Bedeutung.
Diesbezüglich erwies sich das chinesische Imperium als eines der erfolgreichsten. Nach langen internen Wirren gelang es der Qin Dynastie im Jahre 221 v. Chr., weite Bereiche im Nordosten Chinas zu einigen. Unter den Nachfolgern wurde das Reich der Mitte weiter vergrössert. Bis in das christliche Mittelalter gehörte China zu der fortschrittlichsten Macht der damaligen Welt. Zunächst führten Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft zu stark diversifizierten Erzeugnissen, unter denen sich exotische Produkte wie Gewürze, Tee und Öle befanden. Bald gingen jedoch die Innovationen einer immer opulenteren Gesellschaft über die Landwirtschaft hinaus.
Seit dem Beginn der neuen Zeitrechnung bis zum ausgehenden Mittelalter wurden viele epochale Erfindungen in China gemacht. Bereits um das Jahr eins n.Chr. entwickelte man in China den magnetischen Kompass. Hundert Jahre später hat ein chinesischer Höfling das Papier erfunden. Das führte um 750 n. Chr. zum Buchdruck, worauf im 9. Jahrhundert bereits Papiergeld im Umlauf war. Danach wurden Masse und Gewichte vereinheitlicht, das Schiesspulver erfunden, die ersten mechanischen Uhren hergestellt und Erdgas für die Erzeugung von Energie genutzt.
Wie viele seiner imperialen Vorgänger suchte China prioritär einen möglichst autarken Wirtschaftsraum zu schaffen. Doch entstanden bald Handelsbeziehungen zu anderen Mächten. Denn Chinas hervorragende Produkte waren stark begehrt. Bereits im Jahre 50 v. Chr. gelangte chinesische Seide nach Rom. Neben neuen Landwirtschaftsprodukten waren auch seine Porzellanwaren sehr begehrt. Für die Ausdehnung des Handels brauchte das Reich der Mitte nicht besonders aktiv zu sein, weil es nur marginal auf Importe angewiesen war (Steger, 2009).
Schon zur Zeit der ersten Imperien wurde grenzüberschreitender Handel häufig von religiösen Minderheiten betrieben. Obwohl Imperien stets eine kulturelle Einheit herzustellen suchten, gelang es religiösen Bewegungen immer wieder, politische Grenzen zu überschreiten. Das war für den chinesischen Konfuzianismus der Fall, der als Moralphilosophie bis nach Japan gelangte, ohne dass dieses je unter die Fuchtel des chinesischen Grossreiches geraten wäre. Das Gleiche gilt für den Buddhismus, der von Indien ausging, sich aber anschliessend vor allem ausserhalb der indischen Grenzen verbreitete. Bewusst wirkte in diese Richtung ebenfalls das Christentum, während kurz darauf der islamische Monotheismus territoriale Abgrenzung stärker in den Vordergrund stellte. Dennoch gehörten religiöse Gemeinschaften zu den transnationalen Vorreitern, die mit ihren Ritualen und Pilgerfahrten über politische Grenzen hinweg dauerhafte Verbindungen herzustellen vermochten.
Neben Handelsbeziehungen und religiösen Gruppen spielte auch schon die Migration eine wichtige Rolle. Nach der Besiedlung der Kontinente durch Jäger und Sammler handelte es sich meistens um das Aufbrechen ganzer Völkerstände, die mit ihren militärischen Führern neue Ländereien zu erobern suchten, um sich bessere Lebensbedingungen zu verschaffen. Waren sie erfolgreich, hielten sie - wie die ihnen vorausgegangenen Jäger und Sammler - kaum Verbindungen zu ihren ursprünglichen Herkunftsgebieten aufrecht. Meistens versuchten sie, ihre eigenen Herrschafts- und Glaubenssysteme durchzusetzen. Dennoch waren sie häufig bereit, kulturelle Elemente der eroberten Voelker zu übernehmen. Das betraf neben politischen oder wirtschaftlichen Aspekten manchmal sogar religiöse Themen.
In dieser Hinsicht zeichnete sich namentlich das Mongolenreich aus, das im 13. Jahrhundert n. Chr. eine der damals grössten Ausdehnung erlangte. Die überlegenen Ritter der Nomadenstämme waren für äusserst brutale Eroberungsmethoden bekannt, stellten aber eine erstaunliche Offenheit gegenüber den von ihnen besiegten Völkern an den Tag. Sie duldeten nicht nur das Weiterbestehen lokaler Glaubensbekenntnisse, sondern pflegten auch in ihren Handelsbeziehungen ein sehr freizügiges System.
Allerdings ist das kurzlebige Mongolenreich für ein Phänomen bekannt geblieben, mit dem selbst die heutige Globalisierung konfrontiert bleibt. Die Beulenpest, die von seinem zentralasiatischen Ursprungsland ausging, erreichte um 1330 China und breitete sich in den folgenden Jahrzehnten bis nach Portugal, Marokko und Jemen aus. Ihr fielen schätzungsweise ein Drittel der betroffenen Bevölkerungen zum Opfer, was auf die von den Mongolen stark begünstigte Mobilität zurückgeführt wird.
Für viele Historiker ist die Geschichte der antiken Imperien zwar interessant, wird jedoch für die heutige Globalisierung kaum als relevant betrachtet. Zum eigentlichen Ausgangspunkt wird von ihnen der europäische Kolonialismus betrachtet, der um 1500 n. Chr. in Spanien und Portugal seinen Anfang nahm. Neu an dieser Epoche war, dass die Akteure nicht mehr mächtige Imperien waren, sondern eher kleine Monarchien, die untereinander in Konkurrenz standen. Dass gerade diese in den Vordergrund gelangten, ist umso bemerkenswerter, als China nach wie vor technologisch überlegen war. Ein Grund dafür war der Entscheid der chinesischen Imperatoren, sich nach der Bedrängung durch die Mongolen aus dem Fernhandel zurückzuziehen und sich auf interne Belange zu konzentrieren. Hinzu kam die muslimische Herrschaft im Mittelmeerraum, die zur Folge hatte, dass den Europäern ihre früheren Handelsverbindungen zum Orient erschwert wurden (Osterhammel, Peterson; 2006).
Deshalb suchten die europäischen Monarchien neue Wege, um den Zugang zu den asiatischen Handelsrouten wiederherzustellen. Vorreiter waren die portugiesischen und spanischen Herrschaftshäuser. Die Portugiesen hatten bereits seit Jahrzehnten mit ihren Schiffen Erkundungsfahrten nach den westafrikanischen Küsten unternommen. Deshalb sprach der Papst, der sich als Herrscher über den Erdkreis verstand, schon 1481 alles, was südlich der kanarischen Inseln entdeckt würde, der portugiesischen Krone zu. Auf einer dieser Erkundungsreisen erreichte Bartolomeo Diaz 1487 die Spitze von Südafrika, wurde aber wegen Stürmen und einer meuternden Besatzung zur Rückkehr gezwungen.
Das spanische Königshaus, das erst 1492 sein gesamtes Territorium von den Muslimen zurückerobern konnte, verfolgte besorgt die Erfolge seines Nachbarn. Es heuerte den genuesischen Kapitän Christoph Kolumbus an, der eine kürzere Route über den Westen nach Indien versprach. Der etwas prahlerische Abenteurer, der von der portugiesischen Krone abgelehnt worden war, stiess bei den spanischen Herrschern auf Gehör, weil er aus einer erfahrenen Seeschifffahrtsrepublik stammte, die im Wettstreit mit der Stadtrepublik Venedig erfolgreich gewesen war. Kolumbus landete 1492 mit seinen Schiffen nicht in Indien, sondern auf dem damals unbekannten Kontinent Südamerika. Er hatte sich in seinen Berechnungen geirrt, glaubte aber hartnäckig, bis an die Grenzen von Indien vorgestossen zu sein. Nur wenig später konnte sein Landsmann Vespucci beweisen, Kolumbus hätte zwar nicht Indien erreicht, aber einen neuen Kontinent entdeckt.
Nach Indien gelangte 1497 der Portugiese Vasco da Gama, dem über Westafrika die Umschiffung des Kaps der guten Hoffnung gelang, worauf er im ostafrikanischen Malindi einen muslimischen Lotsen fand, der ihm bei der Überquerung des indischen Ozeans half. Die staatlich finanzierte Expedition, die mit der kürzlich entdeckten Artillerie begleitet war, besetzte nicht weite Gebiete, sondern gab sich mit der Errichtung kleiner Stützpunkte für den Handel zufrieden.
Als die Portugiesen merkten, wie erfolgreich die spanische Expedition nach dem Westen gewesen war, suchten auch sie sich ein Stück der entdeckten Gebiete zu sichern. Sie verlangten von Papst Alexander VI. eine revidierte Aufteilung der neuen Welt. Zumindest teilweise entsprach der mit Spanien verbundene Papst dem portugiesischen Begehren, als er 1493 im Vertrag von Tordesillas dem portugiesischen König Brasilien zusprach. Gross war die Enttäuschung der Portugiesen, als sie in der neuen Kolonie weder Gold noch Silber fanden. Deshalb begannen sie mit dem Aufbau von Zuckerplantagen, die sie von ihren afrikanischen Erkundungsreisen kannten. Zu diesem Zweck führten sie Sklaven aus Westafrika ein, die für die harte Arbeit auf den Plantagen besser geeignet waren. Damit begann der berüchtigte Sklavenhandel, der später auch von anderen Kolonialherren nachgeahmt wurde und mit dem über 10 Mio. Schwarze als Sklaven nach den neu eroberten Gebieten verschleppt wurden.
Von Anfang an waren die Spanier in ihren Gebieten Südamerikas auf enorme Mengen von Gold und Silber gestossen. Nachdem sie der indigenen Bevölkerung alle ihre Schätze abgenommen hatten, zwangen sie diese, in Bergwerken unter unsäglichen Bedingungen weitere Mengen zu fördern. So konnte sich Spanien zu der damals grössten Macht aufschwingen, denn Gold und Silber waren auch in den asiatischen Imperien sehr begehrt. Zum ersten Mal entstand ein wirtschaftlicher Interaktionsraum, der alle Kontinente der Welt umfasste.
Das brachte neue Neider wie England, die Niederlande und Frankreich auf den Plan:
- Die Niederländer waren mit den Mechanismen der spanischen Expansion vertraut, weil sie lange unter der Herrschaft der südländischen Krone gestanden hatten. Schon vor der Entdeckung Südamerikas pflegten sie intensive Handelsbeziehungen mit Polen und den baltischen Ländern und hatten sich so mit der Seeschifffahrt vertraut gemacht.
- Als Insel war England noch mehr auf Seewege angewiesen. Nachdem Heinrich VII. mit dem katholischen Rom gebrochen hatte, bekämpfte Elisabeth I. energisch die Zuständigkeit der römischen Päpste für die Aufteilung der neuen Welt. Deshalb unterstützte sie Piraten, die das Seeschifffahrtsmonopol der iberischen Monarchien untergraben sollten. Auf ihrer Seite hatte Elisabeth Hugo Grotius, den holländischen Begründer des modernen Völkerrechtes, der die Freiheit der Meere als Recht für alle Nationen postulierte.
- Ebenfalls die französische Monarchie begann sich immer mehr für Eroberungen in der neuen Welt zu interessieren, auch wenn sie etwas spät in den Wettbewerb unter den europäischen Königshäusern eingetreten war.
Alle drei Herrscherhäuser richteten ihr Augenmerk zunächst auf Nordamerika und die Karibik, welche von den Spaniern und Portugiesen nicht, oder nur wenig besetzt worden waren. Die Niederländer gründeten um das heutige New York herum eine Kolonie und eroberten eine Reihe karibischer Inseln. England setzte sich in weiten Teilen von Kanada und an der Ostküste der Vereinigten Staaten fest, konnte aber auch verschiedene Inseln der Karibik unter seine Herrschaft bringen. Ähnliches taten die Franzosen, die sich das heutige Quebec in Kanada sowie Ohio und Louisiana in den USA aneigneten und ebenfalls auf einigen Inseln der Karibik und an der Nord-Ostküste Südamerikas Fuss zu fassen vermochten.
Spanien und Portugal verwalteten ihre Kolonien als Monopole der Krone. Sämtliche Wirtschaftsangelegenheiten wurden von den königlichen Metropolen dirigiert. Die englischen und niederländischen Herrscherhäuser setzten dagegen auf ein anderes Modell. Sie vergaben Lizenzen an privat finanzierte Gesellschaften, die neben dem Monopol des Handels auch hoheitsrechtliche Befugnisse wie die Justizverwaltung und die Schaffung eigener Armeen erhielten. So wurde in England im Jahre 1600 die „East Indian Company“ gegründet, die sich vor allem auf den Handel mit Indien spezialisierte. Die Niederländer folgten 1602 mit der „Vereinigte Ostindische Kompanie“, deren wichtigste Basis das heutige Indonesien wurde (Wendt; 2007)
Nachdem England 1588 die spanische Armada besiegt hatte, stieg London mehr und mehr zur führenden Kolonialmacht auf. Während des Sieben-Jährigen Krieges (1756 – 1763) nahm es den Franzosen ihre Besitzungen in Nordamerika und Indien ab. Seine Monopolgesellschaften betätigten sich auf allen Kontinenten der Welt tätig. Schon Ende des 17. Jahrhunderts war das Vereinigte Königreich zum Zentrum der globalen Macht geworden und hatte alle anderen Kolonialmächte überflügelt.
Mitte des 18. Jahrhunderts kam es in England zur ersten Phase der Industrialisierung. Verschiedene Historiker sehen darin die eigentliche Vorstufe der heutigen Globalisierung. Marxistisch orientierte Theoretiker behaupten, diese wäre ohne die vorausgegangene Kolonisierung nicht möglich gewesen (Wallerstein; 1976). Dem steht die Tatsache gegenüber, dass Spanien und Portugal als Begründer des europäischen Kolonialismus erst eine bescheidene Industrialisierung erreichten, nachdem sie alle ihre Kolonien verloren hatten.
Die englische Industrialisierung ging von technologischen Erfindungen aus, die zwar einen gesellschaftlichen Hintergrund hatten, für die aber Pioniere als Einzelkämpfer eine zentrale Rolle spielten. Meilensteine waren die Erfindung der Dampfmaschine und des mechanischen Webstuhls, die zu massiven Steigerungen der Arbeitsproduktivität führten. Verbesserte Methoden für die Gewinnung von Eisenerz machten die Entwicklung der Eisenbahnen möglich, während gleichzeitig mit dampfbetriebenen Schiffen die Transportkosten über weite Distanzen drastisch gesenkt werden konnten.
Recht haben allerdings die vom Sozialismus inspirierten Weltsystem- Theoretiker, dass der Kolonialismus für die Engländer zur Förderung ihrer Industrie sehr hilfreich war. Nachdem die Vereinigten Staaten 1776 vom Vereinigten Königreich unabhängig geworden waren und sich wenige Jahrzehnte später ebenfalls die lateinamerikanischen Kolonien von ihren spanischen und portugiesischen Mutterhäusern zu lösen vermochten, suchte England mehr denn je, seinen kolonialen Einfluss in Asien und Afrika auszubauen. Als die englische „East Indian Company“ in Zahlungsschwierigkeiten geraten war, übernahm die Krone ihre Aktien und begann ab 1858 das enorme Gebiet, zu dem neben Indien auch das heutige Pakistan und Bangladesch gehörten, direkt zu verwalten.
Für seine kolonialen Ambitionen profitierte England von den Niederlagen Frankreichs während der napoleonischen Kriege. Damit gelang es ihm, die gesamten niederländischen Besitzungen in Süd-Ost Asien zu übernehmen, auch wenn später Indonesien und Malakka wieder an das niederländische Königsreich zurückgegeben wurden. Doch behielten die Engländer nicht nur Ceylon und Mauritius, sondern konnten sich auch in Burma festsetzen und in Singapur und Hongkong weitere Stützpunkte errichten. Schon vor den napoleonischen Kriegen hatten sie Australien unter ihre Herrschaft gebracht.
Als Frankreich wieder erstarkte, setzte zwischen London und Paris der Zweikampf für die Beherrschung Afrikas ein. Seit dem 16. Jahrhundert hatten sich Handelskompanien verschiedener europäischer Mächte darauf beschränkt, an den Küsten Umschlagsplätze für den Sklavenhandel zu errichten. Die zunehmende Schwäche des osmanischen Reiches nützte Frankreich aus, um 1830 Algerien zu besetzen sowie Tunesien und Marokko unter seinen Einfluss zu bringen. Etwa gleichzeitig vermochte es, verschiedene Gebiete in Westafrika zu erobern.
Indessen war Grossbritannien schon damals auch in Afrika führend. Nach den napoleonischen Kriegen übernahm es von den Niederländern Südafrika, das seit dem 17. Jahrhundert von den Holländern als Stützpunkt für ihren Handel mit Südostasien benützt und später besiedelt worden war. Danach eroberten die Engländer ausgedehnte Landstreiche an der Ostküste Afrikas und waren ebenfalls an der Westküste nicht weniger erfolgreich. Grossbritanniens Höhepunkt erfolgte 1882 mit der Besetzung Ägyptens, was schon Napoleon erfolglos versucht hatte.
Im 19. Jahrhundert wollten nicht nur Grossbritannien und Frankreich zu neuen Kolonien kommen. Auch andere aufstrebende Industriestaaten hegten den gleichen Ehrgeiz. Auf der Berliner Konferenz von 1884-1885 einigte man sich darauf, den Rest des afrikanischen Kontinents untereinander aufzuteilen. So konnte sich Belgien definitiv das umfangreiche Gebiet des Kongos sichern, während Deutschland die heutigen Gebiete von Namibia, Togo, Kamerun und Tansania zugesprochen erhielt.
Russland hatte bereits im 16. Jahrhundert mit der Ausweitung nach Sibirien begonnen und konnte im 19. Jahrhundert wegen des schwindenden Einflusses seiner osmanischen und persischen Nachbarn in zentralasiatische Gebiete, das Kaspische und das Schwarze Meer vordringen. Die Japaner ihrerseits vermochten Taiwan und Korea unter ihre Kontrolle zu bringen. Sogar die ehemalige Kolonie der USA begann sich Ende des 19. Jahrhunderts in koloniale Abenteuer zur verstricken. Nachdem die Amerikaner kubanische Aufständische gegen eine unbarmherzige Repression der spanischen Kolonialherrscher unterstützt hatten, anerkannten sie zwar die Unabhängigkeit der Insel, konnten sich aber einen weitgehenden Einfluss sichern. Als es den USA unter ähnlichen Umständen gelang, 1898 die Spanier aus den Philippinen zu vertreiben, übernahmen sie dort auch formell die Herrschaft.
Gleichzeitig gingen die kolonialen Rivalitäten zwischen England und Frankreich in Asien weiter. Unter Napoleon III. vermochten die Franzosen, das heutige Vietnam, Kambodscha und Laos an sich zu reissen. Dagegen bauten die die Engländer dank ihrer Wirtschafts- und Finanzkraft einseitige Vorteile mit den osmanischen und persischen Grossreichen aus. Nach dem Opiumkrieg zwangen sie dem unabhängigen China einen ungleichen Vertrag auf, der für ihre Handelsinteressen von grosser Bedeutung war. Japan, das sich über Jahrhunderte hermetisch abgeschlossen hatte, wurde wenig später vom amerikanischen Admiral Matthew C. Perry mit Kanonen gezwungen, gemäss dem englischem Vorbild in China seine Häfen für den Handel mit der Aussenwelt zu öffnen.
So beherrschten die industriell fortgeschrittenen Länder zu Beginn des 20. Jahrhunderts direkt oder indirekt die Hälfte des Erdoberteils und über 40% der Weltbevölkerung. Dahinter standen verschiedene Motive. Zwar ging es nicht mehr so sehr um christliche Missionierung, dennoch spielte die vermeintliche Berufung für die Zivilisierung der zurückgebliebenen Völker eine Rolle. Wie schon bei den Spaniern und Portugiesen ging es aber vor allem um handfeste Interessen, indem man sich Rohstoffe und neue Absatzmärkte zu verschaffen suchte. Weil die Arbeitslosigkeit mit den industriellen Produktionsmethoden stieg, konnte man sich auch ein Ventil für die Emigration verarmter Massen schaffen. Und nicht zuletzt war der koloniale Wettlauf von machtpolitischem Prestigedenken geprägt.
Die weltumspannende Kolonialherrschaft wurde aber bald darauf durch den ersten Weltkrieg erschüttert. Die Kriegsverlierer mussten ihre Kolonien abgeben, während sich die Gewinner immer mehr mit Bewegungen nationaler Selbstbestimmung konfrontiert sahen. Die grosse Wirtschaftskrise liess Zweifel an der Überlegenheit der westlichen Industrienationen aufkommen. Nachdem Deutschland, Italien und Japan mit dem unseligen Konzept des Lebensraums zu politisieren begannen, brach der 2. Weltkrieg aus, worauf innert weniger Jahrzehnten praktisch alle Kolonien ihre Unabhängigkeit erlangten.
2. Neues an der Globalisierung
Als Ende der 1980er Jahren immer mehr von Globalisierung gesprochen wurde, meldeten einige Skeptiker Zweifel an, dass etwas völlig Neues im Entstehen sei. Sie verwiesen auf das „goldene Zeitalter“ des 19. Jahrhunderts, als sich der Warenhandel um das 25fache erhöht hatte und über 11% des Weltproduktes ausmachte. Auch konnte ihrer Ansicht nach unter dem Goldstandard zwischen 1870-1914 jedermann irgendwo auf der Welt sein Geld investieren, ohne Inflations- und Währungsrisiken befürchten zu müssen. Grenzüberschreitende Kapitalflüsse hätte es proportional schon damals im gleichen Umfang gegeben, wie das wieder erst im ausgehenden 20. Jahrhundert der Fall gewesen sei. Deshalb meinten sie, man könne weder von einer quantitativen noch einer qualitativen Veränderung sprechen, zumal Einbrüche wie in der Zwischenkriegszeit immer wieder zu befürchten seien (Hirst, Thompson; 1999).
Mit der Krise von 2008, welche die Weltwirtschaft an den Rand des Zusammenbruches brachte, wurde letzteres Argument in Erinnerung gerufen. Trotzdem bleibt die Tatsache, dass wir heute im Vergleich zum 19. Jahrhundert in einem recht unterschiedlichen Umfeld leben. Denn niemand wird bestreiten, dass es in den letzten Jahrzehnten zu enormen Veränderungen gekommen ist, die vor hundert Jahren noch nicht zu erahnen waren.
Nach Ende des zweiten Weltkrieges setzte in den westlichen Demokratien ein starkes Wachstum ein. Die OECD-Staaten konnten zwischen 1945 und 1973 eine jährliche Zunahme ihres BIP um 5% verzeichnen. Doch blieb die Welt in einen marktwirtschaftlichen und einen kommunistischen Block gespalten. Die ehemaligen Kolonien, die in dieser Zeit ihre Unabhängigkeit erlangten – ein wesentlicher Unterschied zum 19. Jahrhundert – bekundeten zunächst grosse Mühe, sich wirtschaftlich zu entfalten. Sowohl beim Handel als auch bei den Auslandinvestitionen ging die wirtschaftliche Dynamik nicht über das Dreieck Nordamerika, Westeuropa, Japan und Ozeanien hinaus.
Allerdings vermochten schon i n den 1960er Jahren die kleinen asiatischen Tiger (Singapur, Südkorea, Hongkong und Taiwan) mit einfachen Produkten ihre Exporte massiv zu erhöhen. In den 1980er Jahren setzte im kommunistischen China eine neue Wirtschaftspolitik ein, die zu hohem Wachstum und zu progressivem Vordringen auf die internationalen Märkte führte. Anfangs der 1990er Jahre begannen auch Indien, Südafrika und Brasilien ihre Wirtschaft zu entwickeln. Zur selben Zeit war der kommunistische Sowjetblock zusammengebrochen, worauf marktwirtschaftliche Prinzipien weiteren Einfluss gewannen. Als Folge davon hat die ökonomische Verflechtung unter den Staaten stark zugenommen.
War der Welthandel im 19. Jahrhundert jährlich um 4% gewachsen - und während der grossen Weltwirtschaftskrise um mehr als 50% zurückgegangen -, erreichte er nach dem zweiten Weltkrieg Zuwachsraten von 7% pro Jahr. Anfänglich konzentrierte sich dessen Zunahme fast ausschliesslich auf die industrialisierten Nationen. Seit den 1980er Jahren ist das aber bei weitem nicht mehr der Fall. Vor allem die asiatischen Länder vermochten ihren weltweiten Exportanteil von 14% auf 30 % zu steigern. Jener der alten Industrieländer ging von 75% auf 50% zurück. Inzwischen ist China zum grössten Exporteur der Welt aufgestiegen.
Neben dem Warenaustausch ist seit den 1980er Jahren mehr als je zuvor der Handel mit Dienstleistungen gestiegen. Seine Wachstumsraten lagen mit jährlich 8,3% über jenen der Warenexporte. In diesem Bereich konnten zwar die alten Industrieländer lange ihre Vormachtstellung verteidigen. So hatten sie noch zu Beginn der Jahrtausend-Wende einen Marktanteil von fast 80%. Seither ging dieser aber auf 70% zurück, was bedeutet, dass auch andere Länder in diesen Bereich vorzustossen beginnen.
Ähnliche Entwicklungen sind bei den direkten Auslandinvestitionen zu verzeichnen. Betrugen diese 1970 bloss 13 Mrd. USD pro Jahr, haben sie sich seither mehr als verzehnfacht. Ihre Zuwachstraten lagen damit über den Warenexporten und dem Handel mit Dienstleistungen. Bis zu Beginn der 1990er Jahren sind solche Investitionen vor allem unter den alten Industriestaaten getätigt worden. Noch heute stammen die meisten Gelder von ihnen. Praktisch die Hälfte davon geht aber in letzter Zeit in die Entwicklungs- und Schwellenländer.
Gerade Schwellenländer treten jedoch immer mehr selber als Auslandinvestoren auf. Ihr Anteil an der Gesamtsumme macht inzwischen mehr als ein Drittel aus. China investiert massiv in der südlichen Hemisphäre der Welt, um sich Rohstoffe und Absatzmärkte zu sichern. Auch andere Länder des Südens sind zu gewichtigen Auslandinvestoren geworden. Die enormen Staatsfonds, die von Erdölexporteuren oder sonst reich gewordenen Ländern angehäuft worden sind, werden heute von den alten Industrieländern umworben, um von ihnen Investitionen und Kredite zu erhalten. China beginnt aggressiver denn je westliche Unternehmen zu kaufen, um an ihre Technologie heranzukommen.
Im Zuge der Globalisierung verlieren traditionelle Statistiken an Aussagekraft. Die eigentlichen Motoren des heutigen Wirtschaftsgeschehens sind transnationale Unternehmen. Deren Zahl ist seit 1970 von 7’000 auf über 80’000 gestiegen. Die grössten unter ihnen erwirtschaften jährliche Umsätze, die das Bruttosozialprodukt von mehr als der Hälfte der Staaten übertreffen. Sie sind für zwei Drittel des Welthandels verantwortlich, wobei über ein Drittel dieser Transaktionen innerhalb der gleichen Konzerne stattfindet.
Transnationale Unternehmen sind zu den wichtigsten Auslandinvestoren geworden. Sie investieren nicht mehr nur für die Erschliessung von Rohstoffen oder zur Eroberung neuer Absatzmärkte, sondern schaffen immer mehr interkontinentale Wertschöpfungsketten. Ihre Produktionsprozesse erstrecken sich über eine Vielzahl von Ländern. Aus einem beziehen sie Grundmaterialien, in einem anderen werden diese weiterverarbeitet, worauf in einem dritten das Endprodukt hergestellt wird, das anschliessend über die ganze Welt vermarktet wird (Scherrer, Kunze; 2011).
Als in den 1970er Jahren transnationale Unternehmen vermehrt über die Grenzen der alten Industriestaaten hinaus aktiv wurden, reagierten die Entwicklungsländer zunächst mit Ablehnung. Sie befürchteten politische Machenschaften und den damit verbundenen Verlust ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Inzwischen hat sich die Stimmung völlig umgekehrt. Heute ist die südliche Hemisphäre sehr interessiert, solche Unternehmen mit steuerlichen und anderen Begünstigungen anzuziehen. Am häufigsten werden Exportzonen geschaffen, in denen weder Import- noch Exportzölle zu entrichten sind, eine gute Infrastruktur zur Verfügung steht, tiefere Arbeitslöhne bestehen und oft auch weniger strenge Auflagen bezüglich Umweltschutz gemacht werden. Das bereitet Gewerkschaften in den alten Industrieländern einige Sorgen, so dass vermehrt auch der lang gepredigte Freihandel bei demokratisch gewählten Regierungen unter Druck gerät.
Indessen dürften gerade solche grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten bewirken, dass es seit dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 nicht zu einem überbordenden Protektionismus gekommen ist. Der Ruf nach solchen Massnahmen verstärkt sich allerdings in letzter Zeit. Weil transnationale Produktionsprozesse immer mehr Länder miteinander verketten, wird es jedoch für alle Beteiligten schwieriger, sich von ausländischer Konkurrenz abzuschotten (Scholte; 2008).
Neben der realwirtschaftlichen Entwicklung haben auch die internationalen Finanzströme enorm zugenommen. Dass sie proportional nicht über dem unter dem Goldstandard erreichten Niveau liegen, ist auch statistisch nicht mehr zu belegen. Die täglichen Umsätze auf den Devisenmärkten, die 1980 noch kaum 100 Mrd. USD betrugen, haben mittlerweile die fast unvorstellbare Zahl von 3 000 Mrd. USD überstiegen. Viele Zentralbanken haben Mühe, den Spekulationen gegenüber ihrer Währung wirksam zu begegnen.
Mittlerweile kann sich ein Kontoinhaber in den meisten Ländern über einen Automaten mit Geld bedienen. Wer mit einer Kreditkarte ausgerüstet ist, hat es noch leichter, seine Hotelrechnungen und andere Ausgaben für Geschäfts- und Ferienreisen zu begleichen. Der früher beschwerliche Geldwechsel an Bankschaltern wird über elektronische Systeme in Sekundenschnelle abgewickelt.
Die grössten Banken verfügen über weltweite Netze von Filialen. Sie haben den Grossteil ihrer Tätigkeiten transnational ausgerichtet. So ist es in zahlreichen Ländern möglich, ein Konto in einer fremden Währung zu eröffnen. Einlagen von ausländischen Kunden haben seit den 1970er Jahren über drei tausend Mal zugenommen. Gleichzeitig sind grenzüberschreitende Kredite auf über 1 400 Mia. USD gestiegen. In der gleichen Höhe werden von den Banken internationale Anleihen organisiert. Auch beim transnationalen Handel mit Aktien sind ähnliche Zuwachsraten zu verzeichnen.
Es waren namentlich Staaten, welche – wie beim Handel - die stetige Zunahme grenzüberschreitender Finanzgeschäfte erleichtert haben. Hatte man nach dem zweiten Weltkrieg auf Betreiben von Keynes noch an Kontrollen des Kapitalverkehrs festgehalten, wurden diese ab den 1970er Jahren zunehmend aufgegeben. Schon 1974 verzichteten die Vereinigten Staaten einseitig auf Kapitalverkehrsbeschränkungen, 1979 folgte ihnen das Vereinigte Königreich. Für Kontinentaleuropa war der sozialistische Präsident Frankreichs, François Mitterand, der nicht ganz freiwillige Vorreiter, weil er sich kurz nach Amtsantritt wegen wirtschaftlicher Probleme seines Landes auf den gleichen Weg begeben musste. 1992 wurde in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft mit der Schaffung des Binnenmarktes die Regel des freien Kapitalverkehrs auf alle Mitgliedstaaten ausgedehnt. Der IMF hat darauf Ländern der Dritten Welt, die wegen Zahlungsbilanzschwierigkeiten Kredite benötigten, das gleiche Rezept verschrieben.
Anstatt nachhaltig Probleme zu lösen, führte das zu Finanzkrisen in Lateinamerika, Asien und Osteuropa.Schon seit den 1970er Jahre waren solche in verschiedenen Entwicklungsländern vorgekommen. In den 1990er Jahren wurden aber vor allem jene Staaten hart betroffen, die sich auf die Kapitalliberalisierung eingelassen hatten (Mexiko, Südostasien, Russland, Brasilien, Argentinien). Ende 2007 verlagerte sich dann der Krisenherd nach den entwickelten Ländern, als in den USA wegen unvorsichtiger Hypothekarverbriefungen die Immobilien-Blase platzte. Damit kam umgehend das gesamte internationale Bankensystem in Turbulenzen, worauf weltweit ein wirtschaftlicher Abschwung folgte. Alte Industriestaaten mussten zur Rettung ihrer Banken erhebliche Steuermittel aufbringen, was ihre Schuldenlast erhöhte, die schon vorher zu hoch war. Im Euro-Raum kamen verschiedene Länder untergrossen Druck, der noch heute andauert.
Mit der Krise ist das Vertrauen in die internationalen Finanzmärkte schwer erschüttert worden. Für einfache Bürger, die um ihre Ersparnisse zu fürchten hatten, war schwer nachvollziehbar, warum Banken, die ihren Kadern Spitzengehälter bezahlten, mit Steuergeldern unterstützt werden mussten.Aber auch die meisten Regierungen kamen nach der Euphorie der Liberalisierung zur Einsicht, dass die internationalen Finanzmärkte stärker überwacht werden müssen.
Dass dazu im Rahmen der G-20, in die neben den alten Industriestaaten der G-7 eine Reihe aufstrebender Entwicklungsländer aufgenommen wurden, ein multilateraler Ansatz verfolgt wird, ist nicht nur richtig, sondern auch notwendig. Zwar sind noch bei weitem nicht alle Probleme gelöst, doch ist klar, dass verschiedene Schwellenländer zu wichtigen Finanzakteuren geworden sind. Dafür genügt bereits der Hinweis, dass von den zwanzig Ländern mit den grössten Devisenreserven weniger als die Hälfte aus den alten Industrieländern stammen.
Einige meinen, mit der Krise sei die Globalisierung an den Rand des Absturzes geraten. Die Prognose ist wohl zu pessimistisch, auch wenn der wirtschaftliche Rückschlag nicht zu bestreiten ist. Zwar besteht kein Zweifel, dass der Globalisierungsprozess von der Wirtschaft ausgegangen ist, er hat aber inzwischen viele andere Bereiche erfasst. Das hat namentlich mit technologischen Innovationen zu tun, die - wie die Geschichte lehrt - kaum rückgängig gemacht werden können.Dabei geht es vor allem um bahnbrechende Neuerungen im Kommunikations- und Verkehrswesen, von denen die Welt nachhaltig verändert worden ist.
Im Frachtgeschäft über weite Distanzen sind die Kosten über die Hälfte gesunken. Um ein Fernsehgerät von Asien nach Europa zu bringen, macht der Transport nur mehr 1% des Warenwertes aus. Flugreisen sind inflationsbereinigt fünf Mal billiger geworden als vor einem halben Jahrhundert. Kostete ein 3-minütiges Telefongespräch zwischen New York und London 1950 noch 50 USD, sind dafür heute weniger als 30 US-Cents zu entrichten.
Mit Mobiltelefon und Internet ist es in den letzten Jahrzehnten zu einer Kommunikationsrevolution gekommen. Heute gibt es weltweit über 6 Milliarden Anschlüsse für Mobiltelefone, zwei Milliarden Haushalte verfügen über einen Internet-Anschluss. Zwar sind die Länder des Südens noch im Verzug, holen aber stark auf. Mobiltelefone ermöglichen armen Bauern in Afrika, sich über Wetterbedingungen und Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte zu informieren. Das Internet gibt immer mehr Leuten Zugang zu einer bisher nie dagewesenen Informationsflut. Über Satelliten gelangen täglich Informationen aus den letzten Ecken der Welt in die Stuben von Millionen Fernsehzuschauer.
Vor ein paar Jahren wurde vielerorts befürchtet, dass es damit zu einer weltweiten Amerikanisierung der Kultur kommen würde.Aber auch das dürfte eine Fehlannahme gewesen sein. Zwar wird Kultur immer mehr zu einem Geschäft, das heute fast 12% des weltweiten BIP ausmacht. Der Grossteil davon wird von einem Dutzend nördlicher Unternehmen erwirtschaftet, die sich um die Behauptung ihrer Oligopole bemühen. Indessen weht ihnen aus dem Süden immer mehr Konkurrenz entgegen. Hollywood bleibt zwar das Zentrum der Filmindustrie, doch das indische Bollywood holt bei Marktanteilen kräftig auf. Südamerikanische „telenovelas“ erreichen weit über ihre Grenzen hinaus Millionen von Zuschauern. Den grossen Nachrichtensendern wie CNN und BBC ist mit der katarischen Al Jazeera ein Konkurrent entstanden, der sich häufig als Star wichtiger Informationen profiliert. Sowohl bei der klassischen wie bei der modernen Musik erlangen Artisten aus der südlichen Hemisphäre weltweite Erfolge. Und in den letzten zwanzig Jahren sind fast die Hälfte der Nobelpreise für Literatur an Schriftsteller des Südens gegangen. Das alles deutet darauf hin, dass sich globalisierte Kultur zwar ausdehnt, aber nicht im Sinne der Homogenisierung, sondern viel mehr in Richtung einer zunehmend multikulturellen Erfahrungswelt.
Dazu trägt auch der Tourismus bei. Im 19. Jahrhundert waren als Touristen nur ein paar Aristokraten, Abenteurer und Kolonialbeamte unterwegs. Grenzüberschreitender Tourismus blieb auf eine kleine Schicht von Privilegierten beschränkt.Nach dem zweiten Weltkrieg hat sich das rasant verändert. Machten 1950 noch knapp 25 Mio. Menschen ausserhalb ihres Landes Ferien, ist deren Zahl inzwischen auf über eine Milliarde gestiegen. Noch immer stammt die Mehrzahl der Touristen aus den alten Industriestaaten. Waren diese zunächst mit dem Automobil auf dem eigenen Kontinent unterwegs, stillen sie heute ihren Erlebnisdrang in immer weiteren Entfernungen.Trotz exotischer Reize bewegt sich der Massentourismus häufig in abgeschirmten Enklaven, wo man sich unter seinesgleichen trifft.Da aber der Tourismus in den alten Industrieländern wegen hoher Kosten darauf angewiesen ist, reiche Kunden aus dem aufstrebenden Süden anzuwerben, dürfte es unter dem Strich doch zu einer positiven Bilanz interkultureller Erfahrungen kommen. Tatsache ist, dass der Tourismus über 10% des weltweiten BIP ausmacht.
Ungenügend hat die wirtschaftliche Globalisierung bisher ihr Versprechen erfüllt, das weltweite Wohlstandsgefälle zu verringern. Das Millennium - Ziel, die absolute Armut bis 2015 auf die Hälfte zu reduzieren, ist zwar erreicht worden. Doch haben dazu vor allem die aufstrebenden Länder China, Indien und Brasilien beigetragen, denen es gelungen ist, über eine Milliarde Menschen aus der extremen Armut zu befreien. Über zwei Milliarden Menschen der Welt müssen jedoch weiterhin mit 3 USD pro Tag auskommen, was nichts anderes als eine klägliche Lebensgrundlage ist.Mehr als eine Milliarde Menschen leiden an Hunger und haben keinen Zugang zu gesundem Wasser. Trotz unbestreitbaren Fortschritten ist die Schere zwischen den reichsten und den ärmsten Ländern nach wie vor von einem erschreckenden Ausmass. Lag der Unterschied des Pro-Kopf Einkommens zwischen den ärmsten und reichsten Teilen der Welt 1820 bei 1:3, 1913 bei 1: 10, kletterte er 1980 auf 1:45 und hat sich danach auf 1:80 gesteigert.
Es kann deshalb nicht überraschen, dass viele arme Menschen ihrer verzweifelten Lage mit Eimigration zu entfliehen suchen. Die Zahl der Migranten wird auf über 250 Mio. Menschen geschätzt, was weniger als 3% der Weltbevölkerung entspricht. Zumindest in dieser Hinsicht haben die Skeptiker recht, dass die heutige Globalisierung hinter dem Niveau des 19. Jahrhunderts zurückgeblieben ist, als 10% der Weltbevölkerung nach anderen Ländern auswanderte. Damals handelte es sich mehrheitlich um arme Leute aus den industrialisierenden Ländern Europas, die sich vor allem in den unabhängig gewordenen Ländern Nord- und Südamerikas ein besseres Schicksal suchten. Weil gleichzeitig die Sklaverei nicht mehr zu halten war, wurden Millionen von Menschen des Südens als unterbezahlte Arbeitskräfte innerhalb der Kolonien verschoben.
Heute haben wir es mit einer völlig anderen Situation zu tun.Während den starken Wachstumsphasen nach dem zweiten Weltkrieg haben dieIndustriestaaten massiv Arbeitskräfte für niedrigere Arbeiten angeworben. Seitdem aber die Infrastruktur in diesen Ländern weitgehend vollendet ist und einfachere Herstellungsprozesse in Niedriglohnländer ausgelagert werden, wird die Zuwanderung immer stärker kontrolliert. Offen gehalten werden die Türen meistens nur mehr für gut ausgebildete Kader, während arme Leute vor Stacheldrahten mit grossen Risiken versuchen, sich als illegale Migranten einzuschleusen. Sofern das ihnen gelingt, erwartet sie meistens ein erbärmliches Schicksal. Trotzdem überweisen wenig geliebte Migranten von hart erarbeiteten Ersparnissen jährlich an ihre zurückgebliebenen Familien Summen, welche drei Mal so hoch sind als die von den reichen Ländern geleistete Entwicklungshilfe.
Ein weiteres globales Problem stellt sich mit der Umweltverschmutzung. Heute gibt es zu grossen Sorgen Anlass, im 19. Jahrhundert gab es dafür noch kein Bewusstsein. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert vermochten Bürgerbewegungen, es auf die Ebene der Politik zu heben. Ausgangspunkt waren stark verschmutzte Flüsse und Seen, die in nördlichen Ländern sichtbar wurden. Verantwortlich dafür waren schlecht entsorgte Industrieabfälle und die aufkommende Wegwerfmentalität der Konsumgesellschaft. Industrielle Produktionsmethoden und der stark gestiegene Privatverkehr verursachte eine immer grössere Luftverschmutzung. Mit der Zeit konnten auf lokaler Ebene, aber auch in Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten Verbesserungen erreicht werden. Gelöst wurde damit das Problem nicht, denn inzwischen ist man nicht nur in der in der nördlichen, sondern auch in der südlichen Hemisphäre mit ähnlichen Sorgen konfrontiert.
In den 1980er Jahren setzte in Nordeuropa ein weitflächiges Waldsterben ein. Entsetzt beobachteten Bewohner, wie Bäume in ihren Wäldern grau wurden und abzusterben begannen.Das führte zu einer emotionalen Debatte, weil in diesen Regionen seit Jahrhunderten ein intimes Verhältnis zum Wald bestand.
Für Forstexperten hatte das Phänomen mit der Luftverschmutzung zu tun. Verantwortlich dafür hielten sie Emissionen von Schwefeldioxiden aus Kraftwerken und den Ausstoss von Stickstoffdioxiden des Strassenverkehrs. Denn die beiden Elemente würden sich in den Wolken vermischen und zu saurem Regen führen. Hitzig geführte Debatten über Ursachen und Folgen liessen grüne Parteien entstehen, welche bald demokratisch gewählte Parlamente unter Druck setzten. Es kam zur verschärften Vorschriften für Filter in Rauchabzügen, der Einführung des bleifreien Benzins und der Katalysatoren für Motoren. Zurzeit scheint das Waldsterben überwunden zu sein. Womit das genau zu tun hat, bleibt umstritten.Das Waldsterben machte aber deutlich, dass sich die dafür verantwortlich gemachten Stoffe weit über ihre Emissionsquellen verbreiteten und keine staatlichen Grenzen kannten.
Wenig später erregte das Thema der Ozonschicht weltweit die Gemüter.Die Ozonschicht in der Stratosphäre schützt vor ultravioletten Strahlen der Sonne, die für das Leben auf der Erde gefährlich sind. Schon 1974 warnten die amerikanischen Forscher Mario Molina und Sherwood Rowland, dass der Gebrauch von Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) in der Industrie zur Verdünnung der Ozonschicht führen könnte. Solche Stoffe wurden seit den 1960er Jahren in grossen Mengen für die Herstellung von Spraydosen, Kühlschränken und Schaumstoffen verwendet. Britische und amerikanische Messungen bestätigten wenige Jahre später, dass die Ozonschicht tatsächlich verdünnt worden sei. Umgehend alarmierte die medizinische Fachwelt, dass sich damit die Risiken für Hautkrebs und Augenleiden stark erhöhen würden.
Darauf kam es zu einer raschen Reaktion der Politik. Im Protokoll von Montreal einigten sich die Industriestaaten 1987, den industriellen Gebrauch von Fluorchlorkohlenwasserstoffen progressiv abzubauen und ab 1999 völlig zu verbieten. Den Entwicklungsländern wurden längere Fristen eingeräumt, sie erhielten zudem finanzielle Unterstützung. Das zügige Vorgehen fiel leichter, weil technologische Alternativen bereits vorhanden waren. Nach der Jahrhundertwende begann sich die Ozonschiecht zu stabilisieren. Um wieder ihr normales Niveau herzustellen, dürfte es aber noch Jahrzehnte dauern, da emittierte FCKW - Substanzen sehr langlebig sind.
In den letzten Jahrzehnten ist die Biodiversität weltweit um mehr als 30% zurückgegangen. Hauptsächliche Ursachen dafür sind die zunehmende Urbanisierung und die Rodung von Wäldern für intensive Landwirtschaft. Auch die übermässige Ausbeutung natürlicher Ressourcen sowie die generelle Verschlechterung der Umwelt tragen dazu bei. Der Erhalt der Ökosysteme, die sich über Jahrtausende entwickelt haben, ist für das menschliche Wohlergehen von zentraler Bedeutung. Denn sie sorgen für sauberes Wasser, die Fruchtbarkeit des Bodens und produzieren viele Hilfsstoffe für pharmazeutische Produkte.
Die „Dienstleistungen“ der Natur zugunsten der Menschen werden von Experten auf über 30‘000 Mrd. USD pro Jahr geschätzt. Da die meisten von ihnen keinen Marktpreis haben, ist man sich dessen in der öffentlichen Meinung kaum bewusst. Deshalb hat auch das 1992 von den Staaten in Rio de Janeiro vereinbarte Abkommen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bis heute seine Ziele weitgehend verfehlt.
Zur grössten Herausforderung ist der Klimawandel geworden. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die Erdoberfläche um ein Grad erwärmt. Das ist deutlich mehr als in vorausgegangen Zyklen. Kaum ein Wissenschaftler hat noch Zweifel, dass dafür menschliches Verhalten verantwortlich ist. Seit der Industrialisierung werden in Fabriken, im Verkehr, aber auch in Privathaushalten grosse Mengen von Kohle, Erdöl und Erdgas verbrannt. Damit gelangen Kohlendioxide in die Luft, die sich dort zu einer Decke verdichten, womit Sonnenwärme von der Erde teilweise nicht mehr ins All reflektiert werden kann. Der Ausstoss von Kohlendioxid, der inzwischen über 30 Milliarden Tonnen pro Jahr beträgt, ist nicht der einzige Faktor, der zur Erwärmung der Erdoberfläche beiträgt. Weniger gross, aber doch beträchtlichsind daneben Schadstoffe wie Methan und Lachgase. Methan stammt weitgehend von der Viehzucht und dem Reisbau. Lachgase gehen auf Stickstoffe zurück, die für die künstliche Düngung der Böden benutzt werden.
Die Erwärmung der Erde hat schon heute zur Folge, dass es vermehrt zu Unwetterkatastrophen kommt, die Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Gleichzeitig verlängern sich Dürreperioden, die vor allem auf der südlichen Hemisphäre zu Mangel an Wasser und Nahrungsmitteln führen. Daneben schmelzen die Gletscher und das Eis an den Polen, womit der Meeresspiegel steigt. Sollte sich dieser - gemäss Prognosen - bis zum Ende des Jahrhunderts über 50 Zentimeter erhöhen, würden nicht nur die meisten Inseln im Pazifik, sondern auch viele Küstengebiete von Wasser überflutet werden.
Schon 2006 hatte der britische Ökonom Nicholas Stern prognostiziert, dass sich das Bruttosozialprodukt der Welt wegen der Klimaerwärmung bis zu 20% verringern könnte, wenn nicht rasch Gegenmassnahmen ergriffen würden. Über solche konnten sich die Staaten über Jahrzehnte nicht einigen. Zum einen meinten Klimaskeptiker, es handle sich um ein zyklisches Problem, das von der Natur selbst gelöst würde. Zum anderen stellten sich die Entwicklungsländer auf den Standpunkt, die Industrieländer müssten vorangehen, weil sie für die meisten Emissionen verantwortlich seien. Erst Ende 2015 konnten diese Gegensätze an der Konferenz in Paris überwunden werden. Dort haben sich über 190 Staaten dem Kompromiss angeschlossen, dass alle, aber nicht alle im gleichen Ausmass, Anstrengungen unternehmen müssen, um die Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf 2 Grade, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad zu beschränken. Für den Weg, der zu diesem Ziel führt, steht allerdings noch vieles offen.
Nicht nur bei der Umwelt, sondern auch im sicherheitspolitischen Bereich hat sich die Situation im Vergleich zum 19. Jahrhundert völlig verändert. Früher führte man Kriege mit Gewehren und Kanonen. Indessen wurden schon während des ersten Weltkrieges chemische Waffen eingesetzt. Schon damals arbeiteten mehrere Länder fieberhaft an der Entwicklung biologischer Waffen. Die grosse Zäsur erfolgte jedoch nach dem zweiten Weltkrieg, als die Atombombe erfunden wurde. Seit ihrem ersten Einsatz in Hiroshima und Nagasaki ist sie wegen ihrer schrecklichen Auswirkungen nie mehr zur Anwendung gekommen. Als im Korea-Krieg Mac Arthur darauf zurückgreifen wollte, ist ihm das von Präsident Eisenhower verweigert worden, weil er um das Ansehen seines Landes fürchtete. Waren die über Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Bomben tausende Male wirksamer als jede bisher bekannte Waffe, ist deren Zerstörungskraft mit der Entwicklung der Wasserstoffbombe in das Millionenfache gestiegen. Die Zauberlehrlinge hatten eine Waffe erfunden, mit der in Sekunden die gesamte Menschheit vernichtet werden kann. SelbstRealisten erkannten bald, dass militärisch ein völlig neues Zeitalter ausgebrochen sei. Schon in den 1950er Jahren schrieb George F. Kennan, Nuklearwaffen könnten nicht mehr als rationales Mittel der Kriegsführung betrachtet werden.
Als nach den USA auch die Sowjetunion, das Vereinigte Königreich, Frankreich und China in den Besitz von Nuklearwaffen kamen, wurde ihnen bald klar, dass es im gegenseitigen Interesse lag, deren Verbreitung zu verhindern. Unter ihrem Druck entstand 1968 der Atomsperrvertrag, der den legitimen Besitz von Atomwaffen auf die fünf Mächte beschränkte, die vor dem 1. Januar 1967 erfolgreich einen Test durchgeführt hatten. Alle anderen Vertragsstaaten hatten auf den Erwerb und die Entwicklung solcher Waffen zu verzichten, sollten aber technologische Unterstützung für die zivile Nutzung der Nuklearenergie erhalten. Recht vage verpflichteten sich die Nuklearstaaten, in „naher Zukunft“ Verhandlungen über die Verminderung ihrer nuklearen Waffenbestände aufzunehmen. Der sehr ungleiche Vertrag ist inzwischen von 187 Staaten ratifiziert worden und wurde 1995 im Konsens auf unbeschränkte Zeit verlängert. Das erfolgte, obwohl die Atommächte ihren Verpflichtungen zur Abrüstung nur wenig nachgekommen waren. Die drei kleineren Nuklearmächte standen weniger in der Kritik, da sie gegenüber den beiden Supermächten USA und UdSSR über viel geringere Waffenarsenale verfügen.
Die Supermächte begannen in den 1970er Jahren mit den SALT-Verträgen ihr Wettrüsten auf hohem Niveau zu stabilisieren. 1987 konnten sie sich auf die Zerstörung ihrer Mittelstreckenraketen einigen. Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion kam es zwischen den USA und Russland zu den START-Verträgen, mit denen progressiv die Obergrenzen für Sprengkörper und Trägersysteme herabgesetzt wurden. Das erste START-Abkommen von 1991 sah noch Höchstwerte für Sprengköpfe von 6000 vor, mit dem letzten Abkommen von 2010 sollen diese auf 1550 reduziert werden. Nach wie vor feiern manche Sicherheitsexperten den Atomsperrvertrag als Erfolg. Die hohe Zahl der Mitgliedstaaten ist in der Tat bemerkenswert. Zunehmend wir jedoch klar, dass sich das „know how“ zur Herstellung von Nuklearwaffen rasch verbreitet. Indien und Pakistan, die den Atomsperrvertrag nie ratifiziert haben, sind offen zu Nuklearmächten geworden. Von Israel, ebenfalls einem Nicht- Mitglied des Vertrages, ist bekannt, dass es über Nuklearwaffen verfügt. Aber auch Mitgliedstaaten des Vertrages, die auf nukleare Bewaffnung verzichtet hatten, versuchten im Geheimen mehrmals, solche Waffen zu entwickeln. Ein allgemeines Verbot der Atomwaffen liegt noch in weiter Ferne, dagegen sind biologische und chemische Waffen verboten worden, doch wird auch bei diesen weiterhin an verschiedenen Orten der Welt geschummelt.
Das ist umso schwerwiegender, als mit Recht befürchtet wird, dass selbst terroristische Gruppen in den Besitz von Massenvernichtungswaffen kommen könnten. Kein Zweifel, Terrorismus hat es schon seit Jahrhunderten gegeben.Meistens war er lokal beschränkt, wobei es darum ging, unliebsame Herrscher auszuschalten. Deshalb sind viele Terroristen später zu nationalen Helden geworden. Heute ist es mit dem islamistischen Terrorismus zu einer neuen Dimension gekommen. Dieser operiert weltweit, verfolgt religiöse Ziele und konzentriert sich mit moderner Technik bewusst auf undifferenzierte Massenanschläge. Sein Hauptfeind ist die westliche Welt, doch verursacht er unter Muslimen viel mehr Opfer als bei den von ihm gebrandmarkten „Kreuzrittern“ des Westens.
Neben dem islamischen Fundamentalterrorismus gibt es weiterhin terroristische Organisationen, die mehr lokal tätig sind.Viele von ihnen haben jedoch mit den islamischen Fundamentalisten gemeinsam, dass sie sich die Mittel für ihre Tätigkeiten mit kriminellen Machenschaften zu verschaffen suchen. Sie beteiligen sich damit an der Ausweitung transnationaler Kriminalität, die ebenfalls zu einem ernsthaften Sicherheitsproblem der heutigen Welt geworden ist. Kriminelle Organisationen verschiedener Art profitieren von technologischen Errungenschaften, um mit grenzüberschreitendenden Geschäften finanzielle Gewinne zu erzielen. Ihr jährlicher Umsatz wird vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung auf über 900 Mia. USD geschätzt. Im Vordergrund stehen der Drogen- und Waffenhandel, aber auch mit Prostitution, gefälschten Marken und dem Handel mit raren Spezies und antiker Kunst werden Milliardengewinne gemacht.
Die Bekämpfung der transnationalen Kriminalität stellt Ursprungs- wie Bestimmungsländer vor Probleme. Es wird vermutet, dass zwei Drittel der kriminellen Gewinne über Geldwäscherei in den normalen Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Banken in Bestimmungsländern sehen sich vor schwierige Entscheide gestellt, um nicht ihren Ruf zu schädigen. In den Ursprungsländern haben kriminelle Organisationen häufig kaum Probleme, mit Schmiergeldern ihre Ziele zu erreichen. Reicht das nicht aus, gibt es solche, die über genügend Waffen verfügen, um mit ihren Regierungen eigentliche Kriege zu führen.
Heute sind noch die Schlepper von Flüchtlingen sowie die Attacken im Cyber-Raum hinzugekommen. Bei Letzteren geht es häufig um gewöhnliche Kriminalität, mit der Geld erpresst wird. Staatlich gelenkte Angriffe versuchen dagegen, in sicherheitspolitische und wirtschaftliche Interessen anderer Staaten einzudringen, um diese zu schädigen oder auszuspionieren.
3. Kritische Stimmen
All das zeigt, dass Globalisierung mehr als nur ein ökonomisches Phänomen ist.Auf diesen Bereich konzentrieren sich dennoch kritische Stimmen, weil er zweifelsohne am Anfang der Entwicklung stand. Leidenschaftlich wird namentlich die Frage diskutiert, ob mit dem Neoliberalismus eine zukunftsträchtige Globalisierung zu gestalten ist.
Bis zu den 1970er Jahren orientierte sich der Erfolg der fortgeschrittenen Länder weitgehend an der sozialen Marktwirtschaft. Mit staatlichen Transferzahlungen suchte man, möglichst viele am wirtschaftlichen Wachstum teilnehmen zu lassen. Nachdem die Wohlfahrtstaaten des Nordens damit über Jahrzehnte gut gefahren sind, stiess das Modell an finanzielle Grenzen und begann an Attraktivität zu verlieren. Mit der Machtübernahme von Ronald Reagan in den USA und von Margaret Thatcher im Vereinigten Königreich trat die reine Marktwirtschaft wieder in den Vordergrund. Als viele lateinamerikanische Länder unter Schuldenkrisen litten und IWF-Kredite benötigten, trieben konservative Machthaber des Nordens den Konsens von Washington voran, der auf folgenden Prinzipien beruhte:
- staatliche Haushaltsdefizite sind so rasch als möglich abzubauen;
- öffentliche Unternehmen, die nicht profitabel sind, sollen privatisiert werden;
- um Wachstum zu fördern, sind Märkte sowohl für Waren als auch für Kapital zu liberalisieren;
- Subventionen für Nahrungsmittel und Energieträgern müssen selbst für ärmere Schichten eliminiert werden, damit der Markt zu einer wirksamen Allokation der Ressourcen beitragen kann.
Das Ergebnis war ein verlorenes Jahrzehnt für zahlreiche Länder Lateinamerikas. Nicht viel besser wurde es, als wenige Jahre später die asiatischen Wunderländer in finanzielle Schwierigkeiten gerieten. Bald darauf standen auch andere Schwellenländer vor den gleichen Problemen. Da die meisten Krisen regional blieben, wurstelte man sich mit Hilfspaketen durch, die nicht immer zum erhofften Erfolg führten.
Ob das alles nur auf den Konsens von Washington zurückzuführen ist, darf bezweifelt werden. Dass staatliche Schuldenwirtschaft auf die Dauer in den Abgrund führt, liegt auf der Hand. Seit der Finanzkrise von 2007- 2008, die mit dem Platzen der Immobilienblase in den USA begann, wurde jedoch klar, dass fortgeschrittene Länder zwar den Konsens von Washington predigten, ohne sich selber daran zu halten. So wurden von ihnen landwirtschaftliche Subventionen aufrechterhalten, welche die Marktchancen südlicher Länder beeinträchtigten. Auch mit dem Postulat ausgeglichener Staatshaushalte ging man eher locker um. Heute befinden sich mehrere Länder mit der höchsten Staatsverschuldung im Norden, während Länder, die sich der Rosskur des Washington-Konsens unterziehen mussten, besser dastehen.
Dafür lastet auf neoliberaler Politik einige Verantwortung. Es wurden freie Kapitalbewegungen durchgesetzt, ohne sich darum zu kümmern, die eigenen Haushaltsdefizite unter Kontrolle zu halten. Internationale Banken profitierten von laxen Rahmenbedingungen, um spekulative Gewinne zu erzielen, ohne für eine effiziente Allokation finanzieller Mittel zu sorgen. Auf dem Höhepunkt des Finanzdebakels mussten eine Reihe von Banken mit Steuergeldern gerettet werden.
Gelassen geben sich nach wie vor Ultra-Liberale, denn für sie wurde der Kapitalismus schon immer von Krisen begleitet, die nach einem bereinigenden Gewitter stets zu neuen Fortschritten geführt hätten.
Dennoch ist heute die Euphorie um die Globalisierung merklich abgeflacht. Befürworter müssen mehr als zuvor aus der Defensive argumentieren, während Gegner und Kritiker eine bessere Konjunktur erleben.
Für die Gegner ist klar, dass die Globalisierung schädlich ist. Ihre Vertreter auf der rechten Seite sehnen sich nostalgisch nach dem vergangenen „Glück der souveränen Nationalstaaten“ zurück. Denn sie glauben, nur so sei der Zusammenhalt und Wohlstand „freier Bürger“ zu erhalten. Auch wenn sie meistens mehr emotional als rational argumentieren, gelingt es rechtsnationalen Populisten seit einiger Zeit in demokratischen Wahlen Stimmenanteile zu gewinnen. So kam der medial begabte Abtreibungsgegner Pat Buchanan schon in den republikanischen Vorwahlen der USA 1992 und 1996 zu überraschenden Erfolgen. Sein Slogan lautete, die amerikanische Souveränität und die soziale Gerechtigkeit seien den Göttern der globalen Wirtschaft geopfert worden. Die damals geschaffene Welthandelsorganisation (WTO) betrachtete er als eine „namenlose, gesichtslose und vaterlandsverstossende Bürokratie“. Damit konnte er unter wenig qualifizierten Arbeitern, die früher links gestimmt hatten, sich aber durch die Auslagerung einfacher Produktionsprozesse nach Billiglohnländern bedroht sahen, einige Sympathien gewinnen.
Auch in Westeuropa ist es zu ähnlichen Entwicklungen gekommen. In Frankreich, das wegen seiner revolutionären Tradition gerne glaubt, der Geschichte vorauszugehen, vermochte 2002 Jean-Marie le Pen, der populistische Führer des „Front National“, in die Endrunde der Präsidentschaftswahlen zu kommen. Obwohl er schliesslich nicht gewählt wurde, konnte er nicht ohne Grund sagen: „Das Frankreich der Fabriken, der Handwerker, des Einzelhandels und der Bauernschaft steht hinter mir“. Ebenfalls in anderen Ländern Westeuropas haben Parteien mit rassistischen Parolen starke Erfolge erzielt. Zwar vermochten sie nirgendwo die Macht zu übernehmen. Wo aber Proporzsysteme herrschten, mussten sich Mitte-Rechts Regierungen mehr als einmal mit ihnen verständigen, um parlamentarische Mehrheiten zu erreichen.
Während amerikanische Nationalisten das Phantom einer Weltregierung an die Wand malen, wollen ihre europäischen Gesinnungsgenossen vor allem den kontinentalen Einigungsprozess rückgängig machen (Leggewie, 2003). Unter diesem Banner ist der „Front National“ bei den Wahlen für das europäische Parlament vom Frühling 2014 zur stärksten Partei in Frankreich aufgestiegen. Auf ähnlicher Ebene operiert die „United Kingdom Party of Independence“ (Ukip) in England, die sich erfolgreich auf den Austritt Englands aus der europäischen Union konzentriert hat. Das sind aber weitem nicht die einzigen Länder, in denen patriotische und fremdenfeindliche Parteien in Europa gegenwärtig Wahlerfolge erzielen.
Seit dem Ausbruch der Flüchtlingskrise greifen rechtsnationale Splittergruppen vermehrt zu gewalttätigen Ausschreitungen. Obwohl ihr Ausmass keineswegs mit dem islamischen Fundamental-Terrorismus zu vergleichen ist, gibt es zwischen den beiden eine Dialektik, die sich gegenseitig verstärkt. Denn der islamische Extremismus reiht sich ebenfalls in die radikale Ablehnung der Globalisierung ein. Dabei geht es ihm aber nicht darum, das aus Europa stammende Konzept der nationalen Souveränität wiederherzustellen. Im Gegenteil, sein Ziel ist eine globale Ordnung, die den moralischen Zerfall überwindet und auf muslimische Wertvorstellungen zurückkommt.
Unter jenen, die mit der heutigen Globalisierung Probleme haben, figurieren auch Bewegungen auf der linken Seite des politischen Spektrums. Sie kritisieren jedoch mehr einzelne Aspekte, betreiben aber weniger grundsätzliche Opposition. Denn in ihrem Umfeld war man schon immer „international“ ausgerichtet. Für Linke ist die heutige Globalisierung zwar schlecht, sie meinen aber, dass sie besser gestaltet werden kann. Diese Ansicht wird von unzähligen Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) sowohl aus dem Norden wie aus dem Süden verfochten. Seit 2001 begeben sich Tausende von ihnen an das jährliche Weltsozialforum („Forum Social Mundial“), das meistens gleichzeitig mit dem Weltwirtschaftsforum („World Economic Forum“) veranstaltet wird. Während sich sportlich gekleidete Wirtschaftsführer Ende Januar schon über Jahrzehnte nach dem winterlichen Davos begeben, strömt inzwischen eine Schar von Globalisierungskritikern nach Porto Alegre oder nach anderen südlichen Gefilden.
Auf dem Weltsozialforum sind kaum Wirtschaftskapitäne oder hochrangige Politiker aus dem Norden anzutreffen. Dagegen kommt es dort regelmässig zu einem bunten Jahrmarkt von Meinungen. In folkloristischen Trachten kämpfen landlose Bauern aus dem Süden für Besitzrechte, während ihre weit besser gestellte Kollegen aus Europa gegen das Imperium von McDonald wettern. Gewerkschaftsvertreter streben nach grenzüberschreitender Harmonisierung, kommen aber nicht immer auf einen gemeinsamen Nenner. Menschenrechtsgruppen aus allen Richtungen prangern Verletzungen an, obwohl einzelne Situationen unterschiedlich beurteilt werden. Engagierte Umweltschützer, mehrheitlich aus dem Norden, plädieren für eine grüne Wirtschaft, womit sie bei südlichen Zuhörern oft auf Skepsis stossen. Religiöse Gruppen tanzen auf vielen Hochzeiten und befürworten Toleranz, mit der manche selber Probleme haben.
Gemeinsam ist aber allen, dass eine bessere Welt nicht über den neoliberalen Weg zu erreichen ist. Ihre Hauptforderung lautet, es müsse auf globaler Ebene zu mehr sozialer Gerechtigkeit kommen. Unter dem Strich ist man sich weitgehend einig, dass dazu grundlegende Menschenrechte beachtet werden müssen, auf allen Ebenen demokratische Entscheidungsprozesse einzuführen sind, eine nachhaltige Entwicklung anzustreben ist, gleichzeitig aber auch die kulturelle Vielfalt respektiert werden muss und keine Diskriminierung von ethischen oder religiösen Minderheiten geduldet werden darf.
Unter den immer zahlreicheren NGOs wird jedoch nicht nur Rhetorik betrieben, manche bemühen sich auch konkret, um den Globalisierungsprozess nach ihrem Verständnis zu verbessern.
- Einige von ihnen treiben etwa das Konzept des „ fair trade“ voran, mit dem man im grenzüberschreitenden Handel direktere Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten herstellen will. Damit wollen sie Produzenten in der Dritten Welt zu anständigen Löhnen verhelfen. Das Bemühen ist nicht ohne Erfolg geblieben, denn nicht nur Drittwelt-Läden, sondern auch Grosskaufhäuser bieten vermehrt solche Produkte an und geben so ihren Kunden die Möglichkeit, mit dem Geldbeutel für gerechtere Handelsbeziehungen abzustimmen.
- Auf der gleichen Linie liegen die Bestrebungen, dem Konsumenten genauere Angaben über die Herstellungsbedingungen von Produkten zu liefern. Zertifikate sollen sicherstellen, dass der Käufer weiss, ob der Fussball, den er für seinen Sohn kaufen will, nicht mit Kinderarbeit hergestellt worden ist, oder ob ein von ihm begehrtes Möbelstück aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammt. Auch solche Angaben werden häufiger gemacht, obwohl nicht immer Klarheit besteht, wie sie erstellt worden sind. Sie weisen jedoch darauf hin, dass es Kunden gibt, die sich dafür interessieren.
Eine weitere Forderung von NGOs ist die Einführung einer Steuer auf Finanztranskationen. Die Idee geht auf den Ökonomen James Tobin zurück, der 1981 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Als nach der Abwertung des amerikanischen Dollars andere Währungen häufig unter den Druck von Devisenspekulationen gerieten, regte Tobin in den 1970er Jahren an, für grenzüberschreitende Kapitalverschiebungen eine Steuer von 0,2 bis 1% einzuführen. Die Absicht dahinter war, schwächeren Ländern, die besonders stark unter Währungsschwankungen zu leiden hatten, mehr Autonomie für ihre Wirtschaftspolitik zurückzugeben.
In der euphorischen Phase des Neoliberalismus ist die Idee des Nobelpreisträgers nie ernst genommen worden. Erst 25 Jahre später griff sie Ignacio Ramonet, der linksgerichtete Herausgeber des „Le Monde Diplomatique“ wieder auf. Er machte die einfache Rechnung, dass über eine solche Steuer selbst bei einem minimalen Ansatz mehr Mittel für die Hilfe an die Armen zu erschliessen wären als die gesamte Entwicklungshilfe der reichen Länder. Ramonet stiess damit bei Globalisierungskritikern auf grosses Echo, umgehend wurde in Frankreich die Nicht-Regierungsorganisation Attac gegründet (nach dem französischen Wort „attaquer“ = angreifen), die sich rasch zu einer effizienten Lobby entwickelte.
Bis heute wird die Tobin-Steuer von Industrieländern mit dem Argument abgelehnt, dass sie nur Sinn macht, wenn sich alle Länder daran beteiligen würden, da sie sonst leicht zu umgehen wäre. Nachdem aber die Krise von 2008 gezeigt hat, dass die Volatilität der Finanzmärkte durch kurzfristige Kapitalspekulationen verschärft wurde, scheint sich diese Haltung etwas aufzuweichen. So hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel - die für ihre vorsichtige Haltung bekannt ist - dem französischen Präsidenten Hollande zugestanden, bei der Steuer mitzumachen, falls sich zumindest mehrere Euro-Länder daran beteiligen würden.
Globalkritische NGOs operieren auf verschiedenen Ebenen. Einige verfügen über genügend Mittel, um sich fachliche Expertise anzuwerben, die auch bei internationalen Verhandlungen ernst genommen wird. Andere haben bei der Entwicklungs- und humanitären Hilfe lange Erfahrungen auf dem Terrain gesammelt und sind zu Partnern der öffentlichen Entwicklungshilfe geworden. Bei den Menschenrechten gibt es Organisationen, die über vernetzte Informationen verfügen, womit sie nicht nur frühzeitig Verletzungen von Regierungen, sondern auch das Verhalten von transnationalen Unternehmen anzuprangern vermögen.
Für alle diese Organisationen gilt jedoch, dass sie nur zu Einfluss und zu den notwendigen Spenden kommen, wenn sie von einem breiten Publikum wahrgenommen werden. Wiederholt greifen sie deshalb auf spektakuläre Aktionen zurück, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu lenken. Beim Umweltschutz ist das schon seit langem der Fall, in letzter Zeit ist aber gerade die neoliberale Politik vermehrt zur Zielscheibe solcher Aktionen geworden. An der Ministerkonferenz der WTO von 1999 in Seattle kam es zu einem gewaltigen Aufmarsch globalisierungskritischer Gruppen, die sich meistens friedfertig verhielten, jedoch Gruppen von Randalierern nicht zu kontrollieren vermochten. Noch tragischer verlief der G-8 Gipfel von 2001 in Genua, wo eine übermässige Reaktion der Polizei zu einem Todesopfer führte. Gegnerische Demonstrationen an IWF-Tagungen sind inzwischen fast zu einer Routine geworden, so dass das Echo in den Medien etwas zurückgegangen ist.
Nach der Finanzkrise von 2008 ist mit „Occupy“ eine neue Bewegung entstanden. „Occupy“ agiert ausschliesslich über moderne Kommunikationsmittel und ruft ohne feste Organisation zu spontanen Besetzungen („occupy“) öffentlicher Plätze auf. Angefangen wurde damit im September 2011 in New York, als über 1000 Leute ein Zeltlager im Zucotti Park gegenüber der wichtigsten Börse der Welt errichteten. Das Motto ihres Protestes lautete: „we are the 99 percent“ (wir sind die 99 Prozent), was zum Ausdruck bringen sollte, dass von der Globalisierung praktisch nur ein Prozent profitieren würde. Die Bewegung breitete sich rasch auf Städte in über 90 Ländern aus. Häufig wurden ihre Zeltlager zunächst geduldet, später aber aus Gründen der öffentlichen Sicherheit geräumt. Trotzdem flackert die Bewegung immer wieder auf, denn mit den enormen Lohnunterschieden besetzt sie ein Thema, das vielerorts politisch heikel geworden ist.
Auf diesem Hintergrund spüren auch einige Marxisten wieder Frühlingsluft. Sie nennen sich zwar Neo-Marxisten, verharren aber auf dem Standpunkt, dass alle Probleme auf das Wesen des Kapitalismus zurückgehen, ohne dessen Überwindung nichts zu lösen sei. Es fällt ihnen zurzeit leicht, mit der Kritik am Raubtier-Kapitalismus Bücher zu veröffentlichen, die weiten Absatz finden. Auch sind sie gern gesehene Gäste am Weltsozialforum und bei linkspopulistischen Regierungen des Südens, die für ihre Probleme gerne imperialistische Kräfte verantwortlich machen. Häufig wird dabei ein Anti- Amerikanismus betrieben, der mehr und mehr antiquiert erscheint. Von China, der letzten grossen Bastion einer kommunistischen Einheitspartei, die erfolgreich auf den Markt setzt, werden ihre Vertreter eher stillschweigend übergangen.
Kritik an der Globalisierung der letzten Jahre äussern nicht nur rechtsnationale Populisten und linke Bewegungen, sondern auch Experten, die sich zur Markwirtschaft bekennen. Darunter befinden sich Ökonomen, die mit ihren von Keynes inspirierten Ansichten während des neoliberalen Triumphzuges aus der Mode gekommen waren. Bemerkenswerterweise hat noch vor dem Ausbruch der Finanzkrise der eine oder andere von ihnen den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft erhalten.
Zu diesen gehört Joseph Stiglitz, der an der einflussreichen Universität Columbia lehrt. In den 1990er Jahren war er Mitglied des Wirtschafsteams von Präsident Clinton und leitete danach zwischen 1997 und 2000 als Vizepräsident die Forschungsabteilung der Weltbank. Stiglitz erhielt 2001 den Nobelpreis für seine Arbeiten über lückenhafte Leistungen der Märkte, die er auf ungleiche Informationen zurückführte. Als von den Amerikanern bestimmter Vizepräsident der Weltbank nahm er die Aufgabe der Institution, die Armut in der Welt zu bekämpfen, sehr ernst, geriet dabei aber bald mit dem ebenfalls von den Amerikanern beherrschten Internationalen Währungsfonds (IWF) in Konflikt. So kritisierte Stiglitz scharf die Politik des IWF gegenüber Entwicklungs- und Schwellenländern, die mit Finanzschwierigkeiten zu kämpfen hatten. War dem IWF ursprünglich die von Keynes inspirierte Aufgabe übertragen worden, kurzfristige Liquiditätsengpässe mit internationalen Krediten zu überwinden, bemängelt Stiglitz, dass der IWF seit dem Konsens von Washington eine völlig verfehlte Richtung eingeschlagen habe. Mit der Konzentration auf tiefe Inflation, staatlichen Haushaltsausgleich und einem überstürzten Tempo von Privatisierungen und Liberalisierungen habe der Fonds eine Politik verfolgt, die Probleme nicht löste, sondern sie verschärfte (Stiglitz, 2002).
Am überzeugendsten legte Stiglitz das für die südostasiatische Krise dar, die Ende 1997 ausgebrochen war. Die davon betroffenen Länder hatten drei Jahrzehnte eines erfolgreichen Wachstums hinter sich, das weitgehend mit eigenen Sparquoten finanziert worden war. Die Behörden verfolgten makroökonomische Stabilität, die Staatshaushalte waren meistens ausgeglichen. Nachdem sie aber auf Wunsch des IWF den Kapitalmarkt geöffnet hatten, erhielten ihre Unternehmen kurzfristige Darlehen westlicher Banken. Als plötzlich das Gerücht aufkam, diese Unternehmen hätten sich unter dem Wohlwollen der Regierungen zu stark verschuldet, setzte über Nacht ein gewaltiger Kapitalabfluss ein, was ihre Währungen unter Druck brachte. Der IWF eilte mit Milliarden zur Hilfe, setzte diese aber unter die Bedingung, nicht abzuwerten und die Zinsen zu erhöhen. Das hatte zur Folge, dass niemand mehr investierte und gleichzeitig wegen überbewerteten Währungen die Exporte zurückgingen. Letztlich musste doch abgewertet werden, ohne dass es zu dem vom IWF befürchteten Inflationsschub kam. Für Stiglitz war es bezeichnend, dass Länder wie Malaysia und Südkorea, die sich den Bedingungen des IWF widersetzt hatten, viel rascher aus der Krise herausfanden als jene, die den Vorschriften des IWF gefolgt waren.
Paul Krugman ist ein weiterer amerikanischer Ökonom, der die Vorteile der Globalisierung nicht in Frage stellt, aber ebenfalls dafür plädiert, dass diese anders zu gestalten sei. Der in Princeton wirkende Professor erhielt 2008 den Nobelpreis, nachdem er das Platzen der Immobilien-Krise in den USA vorausgesagt hatte. Sein akademischer Ruf ging auf Untersuchungen in den 1970er Jahren zur internationalen Handelstheorie und deren räumlichen Konsequenzen zurück. In der Zunft der Ökonomen herrscht seit Smith und Ricardo das Credo, internationaler Handel sei für alle Beteiligten von Vorteil, wenn komparative Vorteile genutzt würden. Dieses Modell konnte aber für Krugman nicht erklären, dass ein Land sowohl Autos exportiert wie auch importiert. Seine Antwort lautete, dass Märkte nicht perfekt funktionieren, sondern von grossen Unternehmen beeinflusst werden, denen es mit Massenproduktion gelingt, die Kosten zu senken und dank tieferen Transportkosten weltweit zu operieren. Folglich würden einzelne Länder Wettbewerbsvorteile und Wohlstandsgewinne erzielen, die anderen verwehrt bleiben. Daraus folgerte er, dass das zu einer ungleichen Verteilung von Einkommen führt, die sich auf das Entwicklungspotential einzelner Länder wie auch der gesamten Weltwirtschaft nachteilig auswirkt.
Als Krugman den Nobelpreis erhielt, wurde ihm umgehend die Frage gestellt, wie er die ausgebrochene Finanzkrise einschätze. Er meinte, diese sei furchterregend, weil sie in zu einer grossen Depression wie in den 1930er Jahren führen könnte. Schon seit Jahren hatte er in zahlreichen Veröffentlichungen, öffentlichen Debatten und wöchentlichen Leitartikeln in der „New York Times“ die Wirtschaftspolitik von Präsident Bush Jr. und der amerikanischen Notenbank kritisiert. Für ihn wurde damit eine gezielte Umverteilung der Einkommen zu den Reicheren gefördert, die sich auf die Dauer schädlich auf das allgemeine Wohlergehen auswirken würde.
Seit der Krise von 2008 hat sich Krugman auf die Frage konzentriert, wie aus dem Schlamassel herauszukommen sei. Obwohl er immer klar mit der demokratischen Partei sympathisierte, hielt er selbst mit Kritik an Präsident Obama nicht zurück. Dieser habe zu stark auf monetäre Impulse gesetzt und zu wenig mutig fiskalische Massnahmen ergriffen. Die Tiefzinspolitik der Zentralbanken in den USA und anderswo reiche nicht aus, um die schlechte Konjunktur wieder auf Kurs zu bringen. Wenn Privathaushalte, die sich wegen spekulativer Anreize der Finanzmärkte übermässig verschuldet hätten und nun ihre Schulden abzubauen suchen, ergebe sich eine verminderte Konsumnachfrage, weshalb selbst bei Nullzinsen niemand bereit sei, diese mit produktiven Investitionen auszugleichen. Folglich müssten Staaten – obwohl ebenfalls hoch verschuldet – vorläufig nicht der gleichen Austerität verfallen, sondern mit öffentlichen Investitionen dafür sorgen, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Erst nach der Überwindung des Nachfragedefizites sollten sie beginnen, ihre eigenen Schuldenberge abzubauen (Krugman, 2009, 2012).
Dani Rodrik, ein türkischstämmiger Professor an der Universität Harvard, gibt offen zu, nicht nur 2008, sondern auch schon vorher von Finanzkrisen überrascht worden zu sein. Er hatte sich vor allem mit der internationalen Handelspolitik beschäftigt, die seiner Ansicht nach seit der Schaffung der Welthandelsorganisation (WTO) viel zu forsch im Interesse der industriellen Welt vorangetrieben worden sei. Viele Entwicklungsländer hätten sich dafür einspannen lassen, weil sie hofften, den Exporterfolgen der asiatischen Länder nacheifern zu können. Wissentlich sei dabei unterschlagen worden, dass sich kein Land ohne staatliche Unterstützung zu industrialisieren vermochte. Das sei sowohl für das kontinentale Europa wie die USA der Fall gewesen, wo man überall versuchte, den Rückstand gegenüber den Vorreitern mit Schutzzöllen aufzuholen. Ebenfalls die asiatischen Erfolgsländer hätten ihre industrielle Entwicklung nur einzuleiten vermocht, weil Regierungen den Unternehmen mit Krediten, Subventionen und Importbeschränkungen unter die Arme griffen. Nach der Uruguay-Runde habe man aber solche Massnahmen weitgehend untersagt. Auf Betreiben der alten Industrieländer sei die Liberalisierung des Handels auf Dienstleitungen ausgedehnt worden, wobei man wusste, dass diesbezüglich die unterentwickelten Länder weniger konkurrenzfähig wären. Auch beim Schutz des geistigen Eigentums hätten westliche Länder Normen durchgesetzt, um Monopolstellungen ihrer grossen Unternehmen zu stützten. Dagegen erhielten die unterentwickelten Länder bei den Agrarprodukten kaum Zugeständnisse, weil die Industriestaaten nicht bereit waren, sich der Konkurrenz südlicher Länder zu stellen.
Diese diskriminierende Liberalisierung begründet für Rodrik, dass die Welthandelsorganisation seit Jahren in einer Sackgasse steckt. Die 2001 eingeleitete Doha-Runde wurde zwar unter den Titel der Entwicklung gestellt, da aber die Industrieländer weiterhin auf ihrem Agrarprotektionismus beharren, verweigern sich die Länder des Südens ihrerseits Themen wie Arbeitsbedingungen und Umweltschutz, die durchaus berechtigt wären. Deshalb meint Rodrik, es wäre wohl im allgemeinen Interesse gelegen, bei der Liberalisierung der Handelspolitik gradueller voranzugehen. Man hätte weniger auf neoliberalen und verdeckt diskriminierenden Prinzipien herumreiten sollen. Viel besser wäre es gewesen, in das Regime Mechanismen einzubauen, um zurückgebliebenen Ländern zu ermöglichen, mit den gleichen Mitteln, die anfänglich von den Industriestaaten benützt worden waren, ihre eigene Entwicklung voranzutreiben. Damit würde weltweit zum Vorteil aller eine grössere Nachfrage gesichert. Deshalb plädiert der Harvard-Professor, auf dem Pfad der Globalisierung nicht überstürzt, sondern „smart“ voranzuschreiten (Rodrik; 2011).
Die drei Autoren sind bei weitem nicht die einzigen, die solche Meinungen vertreten. Seit der Krise von 2008 werden deren Veröffentlichungen zwar vermehrt gelesen, was aber nicht bedeutet, dass sie auch grösseren Einfluss erlangen. Erstaunlicherweise hat aber beim IWF und der OECD, die jahrelang stramm neoliberal ausgerichtet waren, ein gewisses Umdenken stattgefunden. Das lässt einmal mehr an Keynes sarkastische Aussage erinnern, dass die politischen Entscheidungsträger häufig mit Ideen von Experten operierten, die schon längst gestorben seien.
4. Staatliche Reaktionen nach der Industrialisierung
Es ist klar, dass es die Souveränität, wie sie im 18. Jahrhundert verstanden wurde, nicht mehr gibt. Staaten werden jedoch trotz Globalisierung nicht so schnell überflüssig werden. Seit Beginn der Industrialisierung haben gerade sie den neuen Entwicklungen Rechnung getragen. Das erfolgte namentlich mit Zusammenschlüssen in internationalen Organisationen, um grenzüberschreitende Probleme gemeinsam zu lösen.
Als erstes Beispiel wird in diesem Zusammenhang oft das Europäische Konzert genannt. Die vier europäischen Siegermächte gegen Napoleon einigten sich 1815 auf dem Wiener Kongress, die alte Gleichgewichtspolitik wiederherzustellen, um den Frieden in Europa zu sichern. Für ein halbes Jahrhundert ist ihnen das gelungen. Formell war aber das Europäische Konzert keine internationale Organisation, sondern ein blosser Konsultationsmechanismus mit periodischen Sitzungen. Ausserdem war die Heilige Allianz unter dem Habsburgerreich, Russland, Preussen und der wiederhergestellten Monarchie Frankreichs ein rückwärts gerichteter Klub, dem es darum ging, politische Veränderungen zu verhindern und die absolute Herrschaft zu erhalten. Die konstitutionelle Monarchie Grossbritanniens war daran bezeichnenderweise nicht beteiligt.
Allerdings hat der Wiener Kongress mit der Rheinschiffahrstakte die erste internationale Organisation im heutigen Sinne gegründet. Deren Ziel war es, die Flussschifffahrt für Anrainerstaaten frei und sicher zu gestalten.Zur Überwachung der Verpflichtungen und zur Schlichtung von Streitigkeiten wurde eine überstaatliche Kommission eingesetzt.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts kam es darauf zu mehreren Vereinbarungen, um den grenzüberschreitenden Verkehr im Interesse des Handels zu erleichtern.
- So wurden nach dem Vorbild der Rheinschifffahrtsakte auch für die Elbe (1821), für die Weser (1823), für die Maas (1830), für die Donau (1856) und für den Kongo (1885) Flusskommissionen mit ähnlichen Kompetenzen gegründet.
- Mit der Verbreitung der viel schnelleren Dampfschifffahrt erarbeite man gemeinsame Vorschriften, um Kollisionen von Schiffen auf hoher See zu vermeiden und Schadenersatzansprüche bei Unfällen zu regeln. Zu dem Zweck wurde 1897 das Internationale Maritime Komitee gegründet.
- Als sich der Eisenbahnverkehr über staatliche Grenzen hinaus zu entwickeln begann, schuf man 1893 in Bern ein internationales Zentralamt, das einheitliche Regeln für den Frachtverkehr – später auch für den Personenverkehr – zu erarbeiten und zu überwachen hatte.
- Anfangs des 20. Jahrhunderts kam mit der Luftfahrt ein weiterer Verkehrsträger hinzu, für den 1919 die internationale Luftfahrtkommission gebildet wurde.
Nicht nur beim Transportwesen, sondern auch bei der Nachrichtenübermittlung brachte das 19. Jahrhundert technologische Fortschritte hervor, die für den Handel sehr wichtig waren:
- Mehrere Pioniere verhalfen Mitte des 19. Jahrhunderts dem Telegrafen zum Durchbruch. Schon 1865 wurde die Internationale Telegrafen-Union gegründet, um das neue Kommunikationsmittel international zu regeln. Als in den 1870er Jahren das Telefon hinzukam, wurden ebenfalls dafür gemeinsame Regeln geschaffen.
- Etwas harziger verliefen die Bemühungen zur Vereinfachung des grenzüberschreitenden Postverkehrs. Erst 1874 gelang es, den allgemeinen Postverein zu gründen, der nach Beitritten aussereuropäischer Staaten vier Jahre später in Weltpostverein umbenannt wurde. Die Mitgliedstaaten erklärten ihre Territorien zu einem einheitlichen Postgebiet und einigten sich darauf, die Gebühren nach dem Absenderprinzip zu verrechnen.
Weitere Schritte erfolgten mit der Harmonisierung von Massen und Gewichten. 1875 errichtete man in Paris das Büro für Masse und Gewichte, das den Standard-Meter und das Standard-Kilogramm für die Eichbehörden der Mitgliedstaaten zu überwachen hatte.
Mit der Welle neuer Erfindungen erlangte der Schutz des geistigen Eigentums an Bedeutung. Obwohl uniforme Regeln nicht zu verwirklichen waren, setzte die Pariser Konvention 1883 ein internationales Büro ein, das sicherstellen sollte, dass ausländische Industriepatente in den Mitgliedstaaten nicht gegenüber einheimischen diskriminiert werden. Für geistige Urheberrechte kam es 1886 in Bern zu einer ähnlichen Vereinbarung.
Ziel all dieser Bemühungen war es, den grenzüberschreitenden Handel zu vereinfachen (Rittberger, Zangl, 2008). Dessen stetiges Wachstum verursachte aber auch neue Probleme, die zu weiteren internationalen Abmachungen führten.
- Der verstärkte Warenaustausch zu Land und zur See war periodisch von eingeschleppten Krankheiten begleitet. Deshalb einigte man sich 1907 in Paris auf ein internationales Gesundheitsamt, das die Aufgabe hatte, Informationen zu sammeln und diese möglichst rasch an die Mitgliedstaaten weiterzuleiten.
- Erhöhte Getreide-Importe aus Übersee bedrängten in Europa bäuerliche Interessen. Das 1905 in Rom gegründete internationale Landwirtschaftsinstitut sollte Mitgliedstaaten frühzeitig mit Informationen versehen, um diese besser auf die Entwicklung der Weltmärkte vorzubereiten.
- Als die Arbeiterschaft mehr demokratische Rechte erlangte, kam es in einigen Staaten zu Gesetzen für bessere Arbeitsbedingungen. Um nicht Wettbewerbsnachteile zu erleiden, suchten deren Regierungen, solche über die eigenen Grenzen hinaus zu koordinieren. Zunächst konnte dafür 1900 in Basel bloss eine private Vereinigung errichtet werden. Nach dem ersten Weltkrieg wurde diese unter dem Namen internationales Arbeitsamt in eine zwischenstaatliche Organisation umgewandelt. Ihr kommt bis heute die Besonderheit zu, dass in ihr nicht nur Regierungen, sondern auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber vertreten sind.
Die meisten internationalen Zusammenschlüsse des 19. Jahrhunderts waren technischer Natur. Dennoch kam es bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch zu Initiativen politischer Natur. Sie erfolgten, als die relativ lange Friedenspause nach dem Wiener-Kongress mit dem Krim-Krieg (1853-1856) sowie den deutschen und italienischen Einigungskriegen (1870/1871) zu Ende ging.
- Die erste Initiative war privater Natur und ging vom Genfer Bankier Henri Dunant aus. Nachdem er in Solferino, einem Schauplatz der Kriege für die italienische Einigung, das unsägliche Leid verwunderter Soldaten gesehen hatte, gründete er 1863 das Internationale Komitee des Roten Kreuzes. Mit diesem sollte eine neutrale Instanz geschaffen werden, um verwundeten Soldaten auf beiden Seiten der Fronten zur Hilfe zu kommen. Schon ein Jahr später gelang es Dunant, eine Reihe von Staaten auf eine internationale Konvention für die Respektierung solcher Rettungsdienste zu verpflichteten. Wenig später wurde diese Verpflichtung auf den Schutz von Kriegsgefangenen und der zivilen Bevölkerung ausgedehnt. Bis heute ist das Genfer Komitee eine zivilrechtliche Institution geblieben, das aber mit seinem Einsatz für humanere Kriegsbedingungen als Völkerrechtspersönlichkeit „sui generis“ anerkannt wird.
- Die zweite Initiative ging vom russischen Zar Nikolaus II. aus. Nachdem das Zarenreich im Krim-Krieg unterlegen war und mit den Rüstungsausgaben westlicher Grossmächte nicht mehr mithalten konnte, schlug Nikolaus II. eine Friedenskonferenz vor, um über Abrüstungsmassnahmen und Grundsätze für die friedliche Beilegung internationaler Streitigkeiten zu beraten. Da der Vorstoss breite Zustimmung ziviler Friedensbewegungen erhielt, kam es 1899 zur ersten Haager - Konferenz, auf die 1907 die zweite folgte. Allerdings gelang es nicht, eigentliche Abrüstungsmassnahmen zu vereinbaren. Immerhin einigte man sich auf einen ständigen Schiedsgerichtshof, den Staaten im gegenseitigen Einvernehmen anrufen konnten. Das humanitäre Genfer Recht wurde verstärkt, indem Geschosse mit giftigen Gasen sowie besonders heimtückische Waffen verboten wurden.
Die Haager - Konferenzen führten zwar nicht zum grossen Durchbruch, doch verstärkte sich unter grossen wie kleinen Staaten die Erkenntnis, dass wirtschaftlicher Fortschritt nicht mit politischen Querelen belastet werden sollte. Das genügte allerdings nicht, um bald darauf die Katastrophe des ersten Weltkrieges zu verhindern.
Mit dem unsäglichen Leid, das damit verbunden war, gerieten demokratische Politiker unter starken Druck, mehr für die Verhinderung absurder Kriege zu tun. Friedensbewegungen, die sich auf Jahrhunderte alte Vordenker stützten, erhielten immer grösseren Zulauf. Hinzu kam die bolschewistische Revolution in Russland, die mit der Diktatur des Proletariates eine völlig neue Weltordnung schaffen wollte.
Auf diesem Hintergrund wurde 1919 mit den Friedensverträgen von Paris der Völkerbund gegründet . Als dessen geistiger Vater gilt der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der mit seinem Land in den Krieg gezogen war, um zur Erhaltung des Friedens die Demokratie zu verbreiten. Er verlangte eine offene Diplomatie und das Selbstbestimmungsrecht für die Völker innerhalb der alten Grossreiche Europas. Obwohl ihm Kolonialherrschaft wenig sympathisch war, musste er sich mit Rücksicht auf seine europäischen Partner auf die Forderung beschränken, dass die Interessen kolonialer Völker ebenso zu berücksichtigen seien wie die Ansprüche der Kolonialherren. Zur Verwirklichung seiner Pläne plädierte er für einen „Verbund der Nationen“, der die politische Unabhängigkeit und die territorialen Grenzen von kleinen wie grossen Staaten sichern sollte.
Wilson inspirierte sich an dem seit langem entwickelten Ideal der kollektiven Sicherheit, das von Bürgerbewegungen schon vor und während des Krieges postuliert worden war. Als die Regierungsvertreter in Paris zusammentraten, wurde der Begriff jedoch nie in den Mund genommen. Selbst Wilson hoffte, dass eine offene Diplomatie, der Druck der öffentlichen Meinung und wirtschaftliche Sanktionen genügen würden, um einen Friedensbrecher auf den rechten Weg zurück zu bringen. Die alten Grossmächte Europas waren ihrerseits sehr darauf bedacht, von ihrer Souveränität möglichst wenig abzugeben. Das hatte zur Folge, dass die Satzung des Völkerbundes viele Kompromisse enthielt.
- Zwar beteuerte man, dass ein kriegerischer Angriff auf einen Staat als Angriff gegen alle anderen zu betrachten sei. Für militärische Operationen konnte der Rat aber nur Empfehlungen abgeben (Art. 10). Dagegen wurden die Mitgliedstaaten verpflichtet, ihre wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen mit einem Staat abzubrechen, der entgegen den Vorschriften der Satzung zu kriegerischen Massnahmen gegriffen hatte (Art. 16).
- Zudem wurde gefordert, dass Streitfragen in jedem Fall zunächst einer Schiedsgerichtsbarkeit oder einer Prüfung durch den Rat zu unterbreiten waren (Art. 12, 13, 15). Erst drei Monate nach dem Spruch der Schiedsrichter oder dem Ratsbericht sollten Konfliktparteien berechtigt sein, zu einem Krieg zu schreiten. Mit der Wartezeit hoffte man, stürmisches Vorgehen zu vermeiden, doch wurde damit die Legitimität von Kriegen nach wie vor anerkannt.
In Artikel 8 der Satzung war ausserdem vorgesehen, Abrüstungsmassnahmen einzuleiten. Der Rat erhielt den Auftrag, Vorschläge auszuarbeiten, um militärische Rüstung auf das Mindestmass zu beschränken, das mit „der nationalen Sicherheit und mit der Erzwingung internationaler Verpflichtungen durch gemeinschaftliches Vorgehen“ vereinbar sein sollte. Auch suchte man die internationale Schiedsgerichtsbarkeit zu verstärken. Dafür wurde ein ständiger Gerichtshof eingerichtet, der aber - wie schon bei den Haager-Beschlüssen – nur aktiv werden konnte, wenn er einvernehmlich von den Streitparteien angerufen wurde. Ergänzend kam bloss hinzu, dass die Hauptorgane des Völkerbundes - der Rat und die Vollversammlung - bei ihm Rechtsgutachten einholen konnten.
Die eher schwammigen Verpflichtungen blieben weit unter dem, was ein wirksames System kollektiver Sicherheit erfordert hätte. Zudem musste sich der Völkerbund in den ersten Jahren seines Bestehens häufig der Botschafterkonferenz der Siegermächte beugen (Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Japan), welche die Umsetzung der Pariser Friedensverträge zu überwachen hatte.
Trotzdem vermochte der Völkerbund in den 1920er Jahren mit Vermittlungsdiplomatie mehr als zwei Dutzend kleinerer Konflikte zu entschärfen. Die wichtigsten unter ihnen waren:
- Áland-Inseln : zahlreiche Inseln zwischen Finnland und Schweden waren mehrheitlich von schwedisch sprechenden Einwohnern bewohnt. Schweden hatte 1809 Finnland und die Áland-Inseln an die russischen Zaren verloren. Während der bolschewistischen Revolution konnte sich Finnland 1917 in einem heroischen Krieg die Unabhängigkeit erkämpfen und beanspruchte die Inseln als zu seinem Territorium gehörend. Das führte zu Spannungen, worauf die britische Regierung den Rat des Völkerbundes mit der Angelegenheit befasste. Eine von ihm eingesetzte Vermittlungskommission schlug 1921 vor, die Inseln bei Finnland zu belassen, ihnen aber eine weitgehende Autonomie einzuräumen, was von Schweden zähneknirschend akzeptiert wurde.
- Oberschlesien: nach dem Krieg beanspruchte Polen das Gebiet von Oberschlesien, das früher zu Preussen gehört hatte, wo aber eine bedeutende Minderheit von Polen lebte. Die Friedensverträge von Paris hatten eine Volksbefragung vorgesehen, die 1921 stattfand und bei der sich fast 60% für die Zugehörigkeit zu Deutschland aussprachen. Als Polen die korrekte Durchführung des Referendums in Frage stellte, wurde der Völkerbund eingeschaltet, der einen Kompromiss vermittelte, wonach der grösste Teil des Territoriums Deutschland zugeschlagen wurde, die wirtschaftlich wichtigsten Gebiete aber an Polen gingen.
- Korfu-Krise: nach dem Kriege waren die Grenzen von Albanien nicht genau festgelegt worden. Griechenland beanspruchte südliche, Jugoslawien nördliche Teile des jungen Staates. Die vom Völkerbund eingesetzte Untersuchungskommission kam zum Schluss, dass die Grenzen mit kleinen Abweichungen gemäss den Beschlüssen der Botschafterkonferenz von 1913 umgesetzt werden sollten. Als der italienische General Tennini in Ausführung dieses Beschlusses 1923 die Grenze zu Griechenland vermessen wollte, wurde er mit seinen vier Begleitern umgebracht. Mussolini, der neue Regierungschef Italiens, machte dafür die griechische Regierung verantwortlich und verlangte innert fünf Tagen eine Entschädigung von 50 Millionen Lire. Als Athen der Aufforderung nicht nachkam, besetzten italienische Streitkräfte die griechische Insel Korfu. Mussolini unterbreitete das Problem erneut der Botschafterkonferenz der Siegermächte, die jedoch die Vorschläge der Untersuchungskommission des Völkerbundes bestätigte. Griechenland hatte die 50 Millionen zu bezahlen, während sich Italien von Korfu zurückziehen musste. Die Verantwortung für die Ermordung des italienischen Vermessungsteams wurde nie geklärt.
- Nachdem es 1925 an der griechisch-bulgarischen Grenze zu Zwischenfällen gekommen war, marschierten griechische Truppen in Bulgarien ein. Das kriegsgebeutelte Bulgarien antwortete mit geringem Widerstand und wandte sich an den Völkerbund. Griechenland wurde verurteilt, musste seine Truppen abziehen und eine Entschädigung an die bulgarische Regierung bezahlen. Der Völkerbund entsandte Beobachter zur Kontrolle der Grenzen.
Die Friedensverträge von Versailles erteilten dem Völkerbund den Auftrag, die Verwaltung des Saarlandes und der erneut als unabhängig erklärten Stadt Danzig zu überwachen.
- Im Saarland erhielt Frankreich für 15 Jahre ein ausschliessliches Nutzungsrecht der Kohleminen. Danach hatte der Völkerbund ein Referendum, durchzuführen, bei dem sich 1935 mehr als 90% der Stimmen für die Zugehörigkeit zu Deutschland entschieden.
- Die alte Hansestadt Danzig, die schon zwischen 1454 und 1793 unabhängig gewesen war, kam nach den napoleonischen Kriegen zu Preussen und somit später zu Deutschland. Von den Siegermächten wurde sie nach dem Krieg mit Rücksicht auf polnische Interessen erneut als unabhängig erklärt. Ein Hochkommissar des Völkerbundes sollte bei Streitigkeiten zwischen Polen und Deutschland vermitteln. Als in der vorwiegend von Deutschen bewohnten Stadt Hitlers Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, geriet der Hochkommissar immer mehr ins Abseits und musste dem weiteren Geschehen machtlos zusehen.
Die Beispiele zeigen, dass der Völkerbund vor allem bei kleineren Problemen an den Grenzen der Kriegsverlierer und den Nachfolgestaaten der habsburgischen und osmanischen Imperien tätig werden konnte. In den letzteren waren Bevölkerungen unterschiedlicher Herkunft nach Jahrhunderten imperialer Macht stark vermischt worden. Selbst Wilson musste einsehen, dass es nicht möglich war, den zerstreuten Ethnien ein Selbstbestimmungsrecht einzuräumen. Die Pariser Friedensverträge sahen deshalb vor, dass die besiegten Mächte sowie die neu entstandenen Staaten den auf ihrem Territorium verbliebenen Minderheiten Rechte der Nicht - Diskriminierung und der Bewahrung ihrer kulturellen Identität einzuräumen hatten. Die Überwachung der Verpflichtungen wurde dem Völkerbund übertragen. Dieser Minderheitenschutz war an sich begrüssenswert, dennoch diskriminierend, weil die Siegermächte ihren eigenen Minderheiten nicht gleichwertige Rechte gewähren mussten.
Ähnlich wurde mit den Kolonialbesitzen der Kriegsverlierer umgegangen. Während jene der Siegermächte unangetastet blieben, hatten die Verlierer ihre Kolonien einem Mandatssystem des Völkerbundes zu übertragen. Zynisch hielt Art. 22 der Satzung fest, dass die Bevölkerungen dieser Kolonien, weil sie noch nicht imstande seien, sich selber zu leiten, im Sinne ihres Wohlergehens und der „heiligen Aufgabe der Zivilisation“ der Vormundschaft „fortgeschrittener Staaten“ unterstellt werden müssten.Verschiedene Gebiete, die früher zum osmanischen Reich gehört hatten, erhielten die Aussicht, bald die Unabhängigkeit zu erlangen. In den ehemaligen deutschen Kolonien Ostafrikas hatten sich die Mandatsträger zu verpflichten, die Gewissen- und Religionsfreiheit zu garantieren und den Sklaven- sowie den Waffenhandel zu unterbinden.Die schwach besiedelten früheren Kolonialgebiete Deutschlands in Südwestafrika und auf den ozeanischen Inselnkamen ohne jegliche Bedingungen unter die Aufsicht von Australien und Südafrika. Letztlich beschränkte sich der Völkerbund darauf, die jährlichen Berichte der Mandatsträger zur Kenntnis zu nehmen, ohne substanziell darauf einzugehen.
In der Absicht, den Herausforderungen der bolschewistischen Revolution in Russland zu begegnen, nahm die Satzung des Völkerbundes auch wirtschaftliche und soziale Anliegen auf. Man war sich deren Bedeutung für eine stabile Friedensordnung bewusst, doch blieb es bei wenig wirksamen Absichtserklärungen.Art. 23 sah bloss vor, dass:
- sich die Mitglieder zu bemühen hätten, humane Arbeitsbedingungen für Männer, Frauen und Kinder zu schaffen;
- der Völkerbund die Einhaltung von Verträgen betreffend Frauen- und Kinderhandel sowie des Drogen- und Waffenhandels überwachen sollte;
- man sich für mehr Freiheit der Kommunikation sowie für ein gerechtes Handelssystem einsetzen wollte.
Gemäss Art. 24 sollten alle bereits bestehenden zwischenstaatlichen Organisationen unter dem Dach des Völkerbundes vereinigt werden. Dafür war aber die Zustimmung aller in diesen Organisationen vertretenen Mitglieder notwendig. Da einige von ihnen nicht (oder noch nicht) Mitglied des Völkerbundes waren, liess sich das Vorhaben nicht verwirklichen. Nur die internationale Arbeitsorganisation und der internationale Schiedsgerichtshof, zwei neu geschaffene Institutionen, konnten unter die Obhut des Völkerbundes gestellt werden.Beide erwiesen sich als recht erfolgreich. Der internationalen Arbeitsorganisation gelang es, erste Vereinbarungen zum Schutz der Arbeitnehmer zu verabschieden. Der Haager Schiedsgerichtshof erliess bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges 66 Urteile, von denen mehr als ein Drittel auf Begehren für Rechtsgutachten der Organe des Völkerbundes zurückgingen.
In Ergänzung zu bestehenden Organisationen entwickelte der Völkerbund jedoch auf technischen Gebieten eigene Initiativen. Das war namentlich für den Gesundheitsbereich der Fall, wo man über die Sammlung von Informationen hinausging und für die Bekämpfung von Epidemien und für die Standardisierung von Medikamenten gemeinsame Normen aufzustellen begann. Eine Reihe weiterer Kommissionen erhielten den Auftrag, sich mit Problemen von Flüchtlingen, des Frauen- und Kinderhandels, des Schutzes der Meere und der kulturellen Zusammenarbeit zu beschäftigen. Schon bald wurden für diese Tätigkeiten mehr als die Hälfte des Budgets der Organisation aufgewendet.
Beim harten Kern wirtschaftlicher Probleme erwies sich der Völkerbundals machtlos. Zu Beginn gelang es ihm noch, mit koordinierten Aktionen wirtschaftliche Krisen in Österreich, Ungarn, Bulgarien und Griechenland zu überbrücken. 1927 wurde eine Wirtschaftskonferenz einberufen, an der sich auch Nichtmitglieder wie die USA und die Sowjetunion beteiligten. An ihr wurden hehre Forderungen wie die Meistbegünstigung in Handelsverträgen und dem Abbau der Zollsätze verabschiedet.Nach dem Börsenkrach in New York und dem Ausbruch der grossen Wirtschaftskrise konnte der Völkerbund den dramatischen Entwicklungen jedoch nur mehr passiv zusehen.
Damit begannen die schwierigen 1930er Jahre, während denen der Völkerbund auch bei seinen politischen Aufgaben immer mehr ins Abseits geriet. Nach Vorbereitungsarbeiten von über zehn Jahren begann anfangs 1932 in Genf die Abrüstungskonferenz, welche die in Art. 8 vorgesehenen Rüstungsbeschränkungen umsetzten sollte. Sie endete 1934 ohne jegliches Ergebnis, da die grossen Mitgliedstaaten mehr denn je zerstritten waren.England wollte die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht durchsetzen, Frankreichs ausschliessliche Priorität war, Deutschland zu weiteren Abrüstungsmassnahmen zu verpflichten. Berlin lehnte das kategorisch ab, weil ihm schon in den Pariser Friedensverträgen weitgehende Beschränkungen auferlegt worden waren.
Hinzu kam, dass in den 1930er Jahren neben wirtschaftlichen auch politische Krisen immer heikler wurden.
- Die erste hatte 1928 mit dem Ausbruch des Krieges zwischen Paraguay und Bolivien begonnen. Bei dieser ging es um das dünn besiedelte Grenzgebiet des Chaco, wo beide Parteien grosse Reserven von Rohstoffen vermuteten. Der Generalsekretär befasste den Rat mit der Krise, der aber die Regelung des Konfliktes an die Pan-Amerikanische Union übertrug. Als deren Vermittlung erfolglos blieb, verhängte der Völkerbund ein Waffenembargo für beide Kriegsparteien. Da auch dieses nichts bewirkte, machte die Vollversammlung 1933 einen Vorschlag für die Beendigung des Krieges. Als der Vorschlag von Paraguay abgelehnt wurde, hob der Völkerbund das Waffenembargo gegenüber Bolivien auf, worauf Paraguay seine Mitgliedschaft beim Völkerbund kündigte.
- Wenig später sah sich der Völkerbund mit einer weiteren Krise im aussereuropäischen Raum konfrontiert. 1931 überrannten japanische Truppen die chinesische Provinz Mandschurei, nachdem es auf einer von Japan finanzierten Eisenbahnlinie zu einem Anschlag gekommen war. Zunächst glaubte man, das Problem ähnlich wie jenes an der griechisch-bulgarischen Grenze lösen zu können. Bald kam aber die Vermutung auf, der Zwischenfall sei von den japanischen Streitkräften inszeniert worden, um Expansionsgelüste nach China zu rechtfertigen. Jedenfalls rief Japan 1932 die Unabhängigkeit der Republik Manchukuo aus. Ohne diese anzuerkennen, forderte der Rat einen Waffenstillstand und den Rückzug der japanischen Truppen. Als Japan nicht einlenkte, wurde eine Untersuchungskommission entsandt. Diese schlug vor, die Mandschurei bei China zu belassen, ihr aber eine weitgehende Autonomie mit starkem Einfluss von Japan einzuräumen. Nachdem die Vollversammlung dem Vorschlag zugestimmt hatte, verliess Japan Ende März 1933 den Völkerbund.
- Eine noch schwierigere Krise erfolgte 1935, unter der die Glaubwürdigkeit des Völkerbundes den grössten Schaden erlitt. Nach Scharmützeln an der Grenze zwischen der italienischen Kolonie Somali-Land und Äthiopien besetzte Italien weite Gebiete de s äthiopischen Kaiserreiches , das Gründungsmitglied des Völkerbundes war. Obwohl der Vorstoss der italienischen Truppen in jeglicher Hinsicht den Satzungen des Völkerbundes widersprach, reagierten Frankreich und Grossbritannien als wichtigste Mitglieder sehr verlegen. Beide befürchteten, dass mit einer harschen Reaktion Mussolini, der neue Machthaber des Landes, in die Hände Hitlers getrieben werden könnte. Grossbritanniens öffentliche Meinung stand klar auf der Seite Äthiopiens, während man in Frankreich mehrheitlich mit Italien sympathisierte. Als bekannt wurde, dass hinter den Kulissen zwischen London und Paris ein für Italien vorteilhafter Kompromiss ausgearbeitet wurde, musste der britische Aussenminister Hoare die Übung abbrechen und den Hut nehmen. Letztlich kam es nur zu milden Wirtschaftssanktionen, mit denen die Ausfuhr von Waffen nach Italien und einige Importe aus Italien untersagt wurden. Auf ein Ölembargo, das die die Regierung in Rom wahrscheinlich in die Knie gezwungen hätte, konnte man sich nicht einigen. Der äthiopische Kaiser, dessen Armee anfänglich den italienischen Invasoren heroischen Widerstand geleistet hatte, musste im Frühling 1936 seine Niederlage eingestehen, weil er vom Völkerbund allein gelassen worden war.
Neben einer schwach, manchmal sogar widersprüchlich formulierten Satzung hatte der Völkerbund von Anfang an das Handikap, dass die USA trotz Wilsons grossem Einsatz schliesslich nicht beitraten. Der republikanisch dominierte Senat verweigerte die Zustimmung, weil er nicht genügend konsultiert worden war und Artikel 10 als zu grosses Sicherheitsrisiko für die USA betrachtete. Daran änderte sich auch nichts, als sich Wilson zur Erklärung gezwungen sah, dass es bei Art. 10 bloss um eine „moralische“ Verpflichtung gehe.
Obwohl die Mehrheit der Staaten zunächst grosses Interesse am Völkerbund bekundet hatten, kam es schon wenige Jahre später zu einem Karussell von Ein- und Austritten. Zu Beginn war den Kriegsverlierern die Mitgliedschaft versagt worden. Als Deutschland 1926 aufgenommen wurde und man ihm gleichzeitig eine ständige Mitgliedschaft im Rat versprach, beanspruchten Polen, Spanien und Brasilien ebenfalls einen ständigen Sitz. Die kontinentalen Siegermächte wollten den Rat ursprünglich einzig für sich reservieren. Auf Drängen Wilsons mussten sie jedoch akzeptieren, dass neben den vier permanenten Sitzen der Grossmächte auch vier kleinere Mächte als nicht-permanente Mitglieder alle drei Jahre von der Vollversammlung in das Gremium zu wählen waren. Um diese nicht-permanenten Sitze kam es bald zu einem Gerangel, so dass deren Zahl bereits 1922 von vier auf sechs erhöht wurde. Im Vorfeld der Aufnahme Deutschlands tauchte der Vorschlag auf, für mittlere Mächte eine neue Kategorie semi-permanenter Mitglieder zu schaffen, die mit Zweidrittelmehrheit für sukzessive Perioden wiederwählbar gewesen wären. Als Spanien und Brasilien den Kompromiss ablehnten und 1926 aus dem Völkerbund austraten, blieb der Vorschlag toter Buchstabe.
In den folgenden Jahren erfolgten weitere Austritte. Wie bereits erwähnt, trat Japan 1933 aus. Im gleichen Jahr kündigte Hitler die kurze Mitgliedschaft Deutschlands, weil er sich mit seinen Plänen für die Revision der Pariser Verträge nicht durchsetzen konnte. Als weitere wichtige Macht verliess Italien 1937 den Völkerbund. In diesen Jahren traten auch mehr als ein halbes Dutzend lateinamerikanischer Staaten aus, was jeweils unterschiedliche Gründe hatte.
Nach dem Austritt Deutschlands wurde 1934 die Sowjetunion aufgenommen und ihr ein ständiger Sitz im Rat eingeräumt. Als die Sowjetunion 1939 Finnland besetzte, reagierte die Vollversammlung mit dem Ausschluss, was einer der letzten Beschlüsse des Völkerbundes war, der mit dem nähernden Ausbruch des zweiten Weltkrieges schon nur mehr von symbolischer Bedeutung war.
Neben einer schwammigen Satzung und einer bröckelnden Mitgliedschaft stand der Völkerbund seit den 1930er Jahren in einem zunehmend schwierigen Umfeld. In Deutschland, Japan und Italien kamen totalitäre Parteien an die Macht, die von den Prinzipien des Völkerbundes wenig hielten. Von den demokratischen Grossmächten des Völkerbundes blieben nur Frankreich und Grossbritannien übrig. Ihre Führungsrolle wurde dadurch geschwächt, dass sie in ihrer Aussenpolitik oft unterschiedliche Interessen verfolgten. Daneben hatten sie es mit einer kriegsmüden Wählerschaft zu tun, die davor zurückschreckte, militärische Mittel für die Lösung von Konflikten einzusetzen. Als nach dem Ausbruch der grossen Wirtschaftskrise immer mehr protektionistische Massnahmen getroffen wurden, hatte auch das Instrument der Wirtschaftssanktionen jegliche Aussicht auf Zustimmung verloren.
So versank der Völkerbund nach nur zwei Jahrzehnten im Dunkel eines der traurigsten Kapitel der Weltgeschichte. Ihm deswegen ein völliges Scheitern zuzuschreiben, greift aus heutiger Sicht zu kurz. Zwar gelang es ihm nicht, seine hehren Absichten zu verwirklichen. Trotzdem hat er einen ersten Schritt in eine Richtung gemacht, der nicht ohne Spuren geblieben ist (Armstrong, Lloyd, Redmond; 2004).
5. UNO als Forum politischer Zusammenarbeit
Schon während des zweiten Weltkriegs verständigten sich die Führer der alliierten Mächte, nach dem Krieg erneut eine internationale Organisation zur Sicherung des Friedens zu gründen. Das hatten der amerikanische Präsident Roosevelt und der britische Premierminister Churchill bereits 1941 vereinbart. Anfangs 1942 wurde von über zwei Dutzend Alliierten die Erklärung der Vereinten Nationen unterzeichnet. Im Oktober 1943 einigte man sich in Moskau auf deren Grundzüge. Ein Jahr später berieten hochrangige Experten in Dumbarton Oaks, wie die Mängel der Völkerbundsatzung zu beheben seien. Der harte Kern für die kollektive Sicherheit wurde 1944 in Jalta auf höchster Stufe zwischen Roosevelt, Churchill und Stalin ausgehandelt. An der in San Francisco einberufenen Konferenz feilschten ein Jahr später Vertreter von 50 Staaten nochmals über die letzten Details. Unter weltweitem Interesse wurde am 26. Juni 1945 die Charta der Vereinten Nationen unterzeichnet, die am 24. Oktober des gleichen Jahres in Kraft trat.
Was waren die Verbesserungen der Charta gegenüber dem Völkerbund?
- Bezüglich kollektiver Sicherheit ist die Charta klarer strukturiert. Im Völkerbund waren die Kompetenzen zwischen Rat und Vollversammlung unscharf geblieben. Beide hatten einstimmig zu entscheiden und konnten - mit Ausnahme von Wirtschaftssanktionen - nur Empfehlungen abgeben. In der Charta obliegt die Hauptverantwortung für Sicherheit und Frieden dem Sicherheitsrat (Art. 23 – 32). Dieser ist befähigt, allgemein verpflichtende Entscheidungen zu treffen. Dafür braucht es die Zustimmung der fünf ständigen Vertreter (USA, UdSSR/Russland, China, Grossbritannien und Frankreich). Die Zahl der nichtständigen Mitglieder, die zunächst auf sechs beschränkt war, wurde 1965 auf zehn erhöht[1]. Für Entscheidungen des Sicherheitsrates müssen neben den Vetomächten mindestens 4 gewählte Mitgliedstaaten zustimmen.
- In der Generalversammlung (Art. 9 – 22) verfügt jeder Mitgliedstaat über eine Stimme. Im Gegensatz zur Völkerbundsatzung muss die Generalversammlung nicht einstimmig entscheiden, sondern kann ihre meisten Beschlüsse mit einfacher Mehrheit fällen. Die Generalversammlung ist befugt, über alle in der Charta erwähnten Themen zu beraten. Für Probleme von Sicherheit und Frieden darf sie jedoch nur aktiv werden, wenn sich der Sicherheitsrat nicht damit beschäftigt. In der Regel haben Beschlüsse der Generalversammlung den Charakter von Empfehlungen. Bloss für das Budget, für die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedstaaten sowie für Wahlen in verschiedene Organe der Organisation trifft sie bindende Entscheide, für die in der Regel eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist.
- Viel eingehender als die Satzung des Völkerbundes widmet sich die Charte sozialen und wirtschaftlichen Aspekten. Nach den unsäglichen Leiden des zweiten Weltkrieges bekannte man sich ausdrücklich zu der Achtung der Menschenrechte sowie der Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschrittes. Aufgrund dieses erweiterten Sicherheitsverständnisses schuf man den Wirtschafts-und Sozialrat (Art 55 – 74)[2]. Er sollte Daten über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sammeln und Vorschläge für Verbesserungen unterbreiten. Ferner hatte er die von der Generalversammlung oder von ihm geschaffenen Programme und Hilfswerke zu beaufsichtigen und für die Koordination unter den UNO-Spezialorganisationen besorgt zu sein. Da er ebenfalls nur Empfehlungen abgeben kann, ist sein Einfluss beschränkt geblieben.
- Weil es Roosevelt nicht gelang, einen Verweis auf die Dekolonisierung in die Charta einzubringen, kam als viertes Hauptorgan der Treuhandrat hinzu (Art. 75 – 91). Zumindest schimmerte dabei das Bekenntnis durch, Kolonien möglichst rasch an die Selbstbestimmung heran zu führen. Von den 11 Territorien, die unter die Aufsicht des Treuhandrates gestellt wurden, erlangte Palau 1994 als letztes die Unabhängigkeit. Schon damals waren auch die meisten anderen Kolonien unabhängig geworden. Der Treuhandrat ist seither arbeitslos und besteht nur noch auf dem Papier.
- Die Position des Generalsekretärs wurde in der Charta insofern verstärkt, als dieser mit Art. 99 das Recht erhielt, den Sicherheitsrat auf Probleme aufmerksam zu machen, die seiner Ansicht nach Frieden und Sicherheit gefährden. Damit hat er eine bedeutende Rolle als Vermittler erhalten.[3]
- Der von der Charta geschaffene Gerichtshof[4] gleicht weitgehend jenem des Völkerbundes. Nach wie vor müssen Staaten einig sein, eine völkerrechtliche Streitigkeit dem Gerichtshof zu unterbreiten. Rechtsgutachten können nur von der Generalversammlung und vom Sicherheitsrat verlangt werden. Neu ist, dass sich Staaten im Voraus für bestimmte Bereiche der obligatorischen Gerichtsbarkeit unterstellen können, die dann gegenüber anderen Staaten gilt, die sich ebenfalls in diesem Sinne verpflichtet haben. Von dieser Möglichkeit haben bisher nur ein Drittel der Mitgliedstaaten Gebrauch gemacht.
Gegenüber dem Völkerbund war die geplante Stärkung des Sicherheitsrates das wichtigste Element. Doch kaum war die Charta in Kraft, machte der auftretende Ost-Westkonflikt gerade dieses Organ handlungsunfähig. Bereits ab 1946 begann die Sowjetunion den Sicherheitsrat mit ihrem Vetorecht zu lähmen. Bis zum Beginn der 1970er Jahre kam es im Sicherheitsrat zu 118 Vetos, von denen über 90% auf die Sowjetunion fielen. Als die Vereinigten Staaten nach der Dekolonisierung ihren überwiegenden Einfluss in der UNO verloren, musste Washington mehrheitlich zum Vetorecht greifen. Zwischen 1970 und 1990 gingen von insgesamt 111 Vetos 58 auf die USA zurück, 40 auf seine Verbündeten Frankreich und das Vereinigte Königreich. Seit dem Ende des Kalten Krieges hat die Zahl der Vetos abgenommen. Zunächst mussten mehrmals die USA in der Frage des Konfliktes zwischen Israel und Palästina zum Veto greifen. Seit dem Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges waren es vor allem Russland und China, die mit ihrem Veto den Sicherheitsrat blockierten.
Die Rivalitäten zwischen den USA und der Sowjetunion hatten zur Folge, dass es während des Kalten Krieges nur einmal zu einem Entscheid für militärische Massnahmen kam. Als Nordkorea 1950 in Südkorea einmarschierte, vermochten die Vereinigten Staaten einen entsprechenden Beschluss durchzusetzen, weil die Sowjetunion damals den Sicherheitsrat aus Protest gegen die verhinderte Aufnahme der kommunistischen Volksrepublik China boykottierte. Damit begann die noch heute gültige Praxis, dass die Abwesenheit oder die Enthaltung eines der fünf ständigen Mitglieder nicht als Veto gilt. Nach dem forschen Vorgehen der Amerikaner griff 1951 die Volksrepublik China in den Konflikt ein und die Sowjetunion kehrte in den Sicherheitsrat zurück. Darauf gelangten die Vereinigten Staaten an die Generalversammlung, um sich in der Resolution „Uniting for Peace“ wirtschaftliche Sanktionen gegen die Volksrepublik China genehmigen zu lassen. Zwei Jahre später endete der Konflikt in einem Patt, beide Seiten mussten sich auf die schon vorher gezogene Demarkationslinie zurückziehen.
Auch gelang es dem Sicherheitsrat bis zum Ende des Kalten Krieges nur zwei Mal, sich auf wirtschaftliche Sanktionen gemäss Artikel 41 zu einigen. Als die weissen Kolonialisten unter der Führung von Ian Smith einseitig die Unabhängigkeit Südrhodesiens erklärten, verbot der Sicherheitsrat 1966 Waffenexporte nach Südrhodesien sowie die Einfuhr gewisser Produkte aus der britischen Kolonie. Der zweite Anwendungsfall erfolgte 1977, nachdem die blutigen Zwischenfälle in Soweto den Sicherheitsrat wenigstens dazu brachten, ein Verbot von Waffenausfuhren gegen Südafrika zu verhängen.
Obwohl der Sicherheitsrat weitgehend blockiert war, konnte die UNO dennoch zur Linderung kriegerischer Auseinandersetzungen beitragen. Hinter den Kulissen einigte man sich auf das Instrument friedenserhaltender Massnahmen, das in der Charta nicht vorgesehen war. Mit ihm suchte man zu verhindern, dass die Supermächte in lokale Konflikte verwickelt werden. Ein erstes Beispiel war 1948 die Entsendung von Militärbeobachtern an die Grenzen zwischen Israel und Palästina, nachdem die Generalversammlung das Zwei-Staaten-Prinzip für das ehemals britische Mandat festgelegt hatte. Ein Jahr später wurde eine zweite Beobachtermission an der umstrittenen Grenze in Kaschmir zwischen den unabhängig gewordenen Staaten Pakistan und Indien eingesetzt. Der nächste, viel grössere Einsatz erfolgte 1956 am Suezkanal, als Frankreich und Grossbritannien ihre Besetzungstruppen zurückgezogen hatten. Ein noch grösseres Ausmass erreichte 1960 die Operation im Kongo, wo Blauhelme erstmals in einen internen Konflikt eingriffen, um das Auseinanderfallen der ehemals belgischen Kolonie zu verhindern.
Obwohl gerade die Operation im Kongo erhebliche Spannungen unter den Grossmächten hervorrief, was zu finanziellen Schwierigkeiten führte, waren die Prinzipien für friedenserhaltende Massnahmen mehr oder minder klar:
- Sie hatten einen Waffenstillstand zu überwachen, der von den verfeindeten Parteien direkt oder über die Vermittlung von Dritten vereinbart worden war.
- Der Einsatz von UNO-Truppen musste von den involvierten Staaten genehmigt werden.
- Die Bewaffnung der Truppen sollte ausschliesslich dem Selbstschutz und der für den Dienst notwendigen Bewegungsfreiheit dienen.
- Solange der Ost-Westkonflikt dauerte, bestand die Praxis, dass Blauhelm-Truppen nur von Mitgliedstaaten gestellt wurden, die nicht zu den fünf Veto-Mächten des Sicherheitsrates gehörten.
Bis zum Ende des Kalten Krieges hat die UNO 18 solcher Operationen durchgeführt:
Israel-Palästina (1948 – noch operationell), Kaschmir (1949 – noch operationell), Sinai (1956-1967), Libanon (1958), Kongo (1960-1964), Westneuguinea (1962-1963), Jemen (1963-1964), Zypern (1964 – noch operationell), Dominikanische Republik (1965-1966), Indien-Pakistan (1965-1966), Israel-Ägypten (1973-1979), Israel-Syrien (1974 – noch operationell), Libanon (1978 – noch operationell), Afghanistan-Pakistan (1988-1990), Iran-Irak (1988-1991), Angola (1989-1991), Namibia (1989-1990), Nicaragua (1989-1992).
Nachdem der Ost-Westkonflikt überwunden worden war, konnte der Sicherheitsrat 1991 in Übereinstimmung mit Kapitel VII eine militärische Aktion beschliessen, als der Irak den Nachbarstaat Kuwait annektierte. Die Durchführung wurde einer Koalition von Willigen unter amerikanischer Führung übertragen, die in kurzer Zeit den Irak aus dem Kuwait zurückzudrängen vermochte.
Innert 24 Stunden nach den Terroranschlägen vom 9. September 2001 in New York einigte sich der Sicherheitsrat, auch mit militärischen Mitteln gegen die von Afghanistan ausgehenden Terroraktionen der Al-Kaida vorzugehen. Dabei stützte er sich auf das Prinzip der Selbstverteidigung. Erneut kam es zu einer Koalition von Willigen unter der Ägide der USA, die allerdings nicht den erhofften Erfolg erzielte.
1994 ermächtigte der Sicherheitsrat NATO-Truppen, das Flugverbot über Bosnien-Herzegowina militärisch durchzusetzen. Ein Jahr später wurden diese zudem beauftragt, Luftschläge gegen bosnische Serben durchzuführen, um die Blauhelmtruppen der UNPROFOR in ihrer humanitären Aufgabe zu unterstützen. Als 2011 in Libyen der Aufstand gegen Gaddafi zu einem blutigen Bürgerkrieg führte, erliess der Sicherheitsrat wiederum ein Flugverbot und erlaubte den Einsatz „aller notwendigen Massnahmen“, um die Zivilbevölkerung zu schützen.
Bei diesem Entscheid berief er sich zum ersten Mal auf das Prinzip der Schutzverantwortung („responsability to protect“), das von den Staats-und Regierungschefs 2005 genehmigt worden war. Auch in diesem Fall wurde der militärische Eingriff von einer „coalition oft the willing“ übernommen (mehrere NATO-Staaten und einige arabische Länder). Koalitionen von Willigen sind praktisch zum Standardmodell geworden, da man sich – entgegen den ursprünglichen Absichten der Charta - nie darauf einigen konnte, für die UNO eigene Truppenkontingente aufzubauen.
Ebenfalls viel häufiger kam es nach dem Kalten Krieg zu wirtschaftlichen Sanktionen. Seither hat der Sicherheitsrat gemäss Art. 41 mehr als 50 solcher Beschlüsse gefällt. Betroffen davon waren über zwei Dutzend Länder. In der Regel wurde mit einem Verbot der Waffenausfuhren begonnen, das aber häufig mit weiteren Massnahmen verschärft werden musste.
Der Erfolg wirtschaftlicher Sanktionen ist durchzogen. Spätestens seit den Erfahrungen im Irak und im früheren Jugoslawien ist man zur Erkenntnis gekommen, dass umfassende Sanktionen oft mehr der Zivilbevölkerung als den politischen Eliten schaden, die sich häufig daran bereichern und noch mehr Unterstützung bei ihrer Bevölkerung finden. Deswegen greift man heute meistens zu intelligenten Sanktionen („ smart sanctions “), welche sich auf Führungskräfte und einflussreiche Privatpersonen beschränken, die mit Reisesperren und der Blockierung ihrer Vermögenswerte im Ausland belegt werden.
Gelegentlich hat der Sicherheitsrat seine Wirtschaftssanktionen dadurch verstärkt, dass er diese mit militärischen Mitteln kontrollieren liess. So erlaubte er im Fall von Irak, Schiffsladungen mit Kriegsschiffen dritter Staaten durchsuchen zu lassen. In Ex-Jugoslawien erhielten Nato-Streitkräfte den Auftrag, das verhängte Waffenembargo in der Adria zu überwachen.
Nicht nur die Wirtschaftssanktionen, sondern auch die friedenserhaltenden Massnahmen der UNO haben seit Beginn der 1990er Jahre massiv zugenommen. Auch bei solchen ist es zu etwa 50 Beschlüssen des Sicherheitsrates gekommen. Oft mussten für das gleiche Land neue Entscheide getroffen werden, um bestehende Missionen zu verlängern oder an neue Umstände anzupassen. In folgenden Gebieten kamen Blauhelm-Missionen zum Einsatz, oder sind noch heute tätig:
Irak-Kuwait (1991-2003), Angola (1991-1995), El Salvador (1991-1995), Marokko/Westsahara (1991 – noch operationell), Kambodscha (1991-1992), Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien (1992-1995), Kambodscha (1992-1993), Somalia (1992-1993), Eritrea (1992-1993), Mozambique (1992-1994), Somalia (1993-1995), Uganda-Ruanda (1993-1995), Georgien (1993-2009), Liberia (1993-1996), Haiti (1993-1996), Ruanda (1993-1996), Libyen (1994), Tadschikistan (1994-2002), Angola (1995-1997), Kroatien (1995-1996), Mazedonien (1995-1999), Bosnien-Herzegowina (1995-2002), Ostslawonien/Kroatien (1996-1998), Kroatien/Prevlaka (1996-2002), Haiti (1996-1997), Guatemala (1997), Angola (1997- 1999), Haiti (1997), Haiti (1997-2000), Kroatien (1998), Zentralafrikanische Republik (1998-2000), Sierra Leone (1998-1999), Kosovo (1999 – noch operationell), Sierra Leone (1999-2005), Ost-Timor (1999), Ost-Timor (1999-2002), Guinea-Bissau (1999 – noch operationell), Demokratische Republik Kongo (1999-2010), Eritrea/Äthiopien (2000-2008), Ost-Timor (2002-2005), Liberia (2003 – noch operationell), Elfenbeinküste (2004 – noch operationell), Haiti (2004 – 2017), Burundi (2004-2006), Sudan (2005 – noch operationell), Ost-Timor (2006-2012), Sudan/Darfur (2007 – noch operationell), Zentralafrikanische Republik/Tschad (2007-2010), Demokratische Republik Kongo (2010 – noch operationell), Sudan/Süd-Sudan – Abyei (2011 – noch operationell), Süd-Sudan(2011 – noch operationell), Libyen (2011 – noch operationell), Syrien (2012 ), Mali (2013 – noch operationell), Zentralafrikanische Republik (2014 – noch operationell).
Wie aus der Liste hervorgeht, betreffen seit den 1990er Jahren die meisten Operationen interne Konflikte. Trotz des Interventionsverbotes von Art. 2,7 der Charta schritt der Sicherheitsrat ein. Weil es zu grenzüberschreitenden Flüchtlingsströmen und zu humanitären Katastrophen kam, weitete er sein Konzept der Friedenssicherung aus. Daraus ergaben sich jedoch neue Probleme, denn das traditionelle „Peace-Keeping“ reichte nicht mehr aus. Blauhelme hatten kaum mehr Waffenstillstände zu überwachen, weil solche gar nicht existierten. In gescheiterten Staaten war es auch schwierig, die Zustimmung des betroffenen Staates einzuholen, da Regierungen umstritten oder ohnmächtig waren.
In solchen Situationen mussten Friedensoperationen völlig neue Aufgaben übernehmen. Sie hatten etwa humanitäre Hilfe zu leisten, die Zivilbevölkerung zu schützen, Streitparteien zu entwaffnen, Wahlen zu organisieren, ja sogar zweitweise ganze Gebiete zu verwalten. Zur Erfüllung solcher Mandate brauchte es nicht mehr nur Soldaten, sondern auch Polizisten und zivile Fachkräfte.
Bei den Einsätzen von 2016 standen insgesamt 124‘746 Personen im Einsatz (74% Soldaten und Militärbeobachter, 11% Polizisten, 15% ziviles Personal) . Die dafür eingesetzten Budgetmittel überstiegen 8 Mrd. USD, was drei Mal mehr als das ordentliche Jahresbudget der UNO betrug. Doch lag diese Summe immer noch bei weniger als 0,5% der jährlich weltweit getätigten Rüstungsausgaben.
Nicht alle Missionen, die seit den 1990er Jahren zum Einsatz gekommen sind, waren erfolgreich. In besonders schlechter Erinnerung sind etwa die traumatischen Erfahrungen in Somalia, Ruanda und Bosnien geblieben. Deshalb berief Generalsekretär Kofi Annan im März 2000 eine hochrangige Experten-Gruppe ein, um Vorschläge für Reformen zu erarbeiten. Diese stand unter der Leitung des ehemaligen Aussenministers von Algerien, Lakdar Brahimi, und deckte schonungslos Mängel bei Planung, Mandaten, finanziellen und personellen Ressourcen auf.
Vor allem stellten die Experten klar, dass UNO-Truppen bei Bürgerkriegen nicht immer neutral sein können. Im Notfall müssten sie auch die Fähigkeit („all necesary means“) haben, um ihren Auftrag gegenüber beiden Seiten durchzusetzen. Der Sicherheitsrat ist seither verschiedenen Empfehlungen des Brahimi Berichtes nachgekommen. Damit rückten einzelne Mandate in den Bereich von Kapitel VII vor, während man ursprünglich von „chapter six-and-a-half“ sprach.
Abrüstung war ein zentrales Thema in der Satzung des Völkerbundes, die UNO-Charta blieb dagegen weniger ambitiös. Zu gut erinnerte man sich noch daran, dass Frankreich und Grossbritannien ihre Rüstungsanstrengungen in der Zwischenkriegszeit vernachlässigt hatten, womit der Ausbruch des 2. Weltkrieges erleichtert wurde. Art. 26 der Charta beauftragte den Sicherheitsrat bloss, Pläne auszuarbeiten, die den Mitgliedstaaten „zwecks Errichtung eines Systems der Rüstungsregelung“ vorgelegt werden sollten. Da der Sicherheitsrat bald blockiert war, sind solche Pläne nie erarbeitet worden.
Noch vor dem Inkrafttreten der Charta kam es jedoch zu grundlegenden militärischen Umwälzungen. Am 26. Juni 1945 testeten die Vereinigten Staaten die erste Atombombe und setzten diese zwei Wochen später in Hiroshima und Nagasaki ein. Angesichts der fürchterlichen Konsequenzen der neuen Waffe ergriff die Generalversammlung die Initiative. An ihrer ersten Sitzung in London schuf sie eine Kommission für nukleare Energie und beauftragte diese, Vorschläge zu machen, um Atom- und andere Waffenvernichtungswaffen zu verbieten.
Das führte zunächst zu wenig Erfolg. Als neue Atommächte entstanden, unterbreite Irland der Generalsversammlung mehrmals Resolutionsentwürfe, um mindestens die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen zu verhindern. 1965 stellte sich die Generalversammlung einstimmig hinter den Vorschlag. Der in Genf tagende 18-Mächte Ausschuss wurde beauftragt, umgehend mit Verhandlungen über einen Atomwaffensperrvertrag zu beginnen.
Der 18-Mächte-Ausschuss war 1961 mit Zustimmung der Generalversammlung für Verhandlungen über die Rüstungskontrolle gegründet worden. Er setzte sich aus fünf westlichen, fünf östlichen sowie acht blockfreien Staaten zusammen. 1979 wurde er auf 40 Mitglieder erweitert und in Genfer Abrüstungskonferenz umbenannt. Die Zahl ihrer Mitglieder ist inzwischen auf 65 gestiegen. Die Konferenz ist formell von der UNO unabhängig, trotzdem aber eng mit ihr verbunden. Ihr Budget wird aus dem Haushalt der UNO bezahlt, der Generaldirektor des UNO-Büros in Genf ist zugleich ihr Generalsekretär. Doch operiert die Konferenz nach eigenen Verfahrensregeln, die sowohl für die Tagesordnung als auch für die materiellen Verhandlungen Einstimmigkeit erfordern.
Anfänglich konnten in Genf verschiedene Vertragstexte ausgearbeitet werden, die an die UNO in New York übermittelt wurden, um den Prozess der Ratifikation einzuleiten. Die Konferenz ist aber seit der Aushandlung des umfassenden Kernwaffenteststoppvertrages (1996) blockiert, weil sie sich wegen des Konsensprinzips nicht mehr auf neue Verhandlungsgegenstände einigen kann. Seither hat sich die Initiative noch stärker an die Generalversammlung in New York verlagert, geht manchmal aber auch von einzelnen Staaten aus.
Abrüstung und Rüstungskontrolle sind schon immer ein schwieriges Thema gewesen. Trotzdem ist es seit der Gründung der UNO zu einer beachtlichen Zahl von Abkommen gekommen:
Multilaterale Abkommen:
Antarktis-Vertrag (1958, verbietet im gesamten Gebiet der Antarktis Explosionen von Kernwaffen, Einrichtung von nuklearen Stützpunkten sowie die Entsorgung radioaktiver Abfälle); Teststoppabkommen (1963, untersagt nukleare Detonationsversuche in offener Umgebung – Atmosphäre, Weltraum und unter Wasser); Weltraumvertrag (1967, verpflichtet, keine Gegenstände, die Kernwaffen oder Massenvernichtungswaffen befördern, in den Weltraum zu verbringen); Atomwaffensperrvertrag (1968, ermächtigt nur die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates zum Besitz von Kernwaffen, die übrigen Staaten dürfen Kernenergie bloss für zivile Zwecke nutzen, sollen dabei aber mit Technologie-Transfer unterstützt werden); Meeresbodenvertrag (1971, keine Erprobung oder Stationierung von Kern- und anderen Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden); Biowaffenkonvention (1972, verbietet, biologische Kampfstoffe zu entwickeln, zu lagern, zu produzieren oder sich zu verschaffen); Umweltkonvention (1977, keine Anwendung militärischer Mittel zur Schädigung der Umwelt) Chemiewaffenabkommen (1993, Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und Anwendung chemischer Waffen, Verpflichtung zur Vernichtung sämtlicher Bestände); Allgemeiner Kernwaffenteststoppvertrag (1996, untersagt sämtliche Tests, auch solche unter dem Boden; noch nicht in Kraft getreten, weil nicht alle Länder, die über Kernwaffen oder Atomenergieanlagen verfügen, ratifiziert haben.
Bilaterale Verträge USA-UdSSR/Russland
SALT I (1972, Stabilisierung von Nuklearwaffen auf hohem Niveau, Anzahl Interkontinentalraketen werden für fünf Jahre eingefroren); ABM-Vertrag (1972, jede Partei darf Raketenabwehrsysteme nur auf zwei Stützpunkten errichten, 2001 von Präsident Bush gekündigt); SALT II (1979, Begrenzung der Zahl strategischer Systeme auf je 2400, wurde nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan vom amerikanischen Kongress nicht ratifiziert, beide Seiten respektierten aber die vereinbarten Höchstwerte); START I (1982/1991, Beschränkung auf je 1600 interkontinentale Raketen und schwere Bomber, Reduktion nuklearer Gefechtsköpfe auf 6000); INF-Vertrag (1987, Verbot bodengebundene Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper der Reichweite von 500 bis 5000 km, alle Bestände waren innerhalb von 3 Jahren zu vernichten); US-sowjetisches Abkommen über Chemiewaffen (1990, Zerstörung bestehender Arsenale, keine künftige Produktion, Recht auf Beibehaltung einer Reserve von je 500 Tonnen); START II (1993, Reduktion installierter Gefechtsköpfe auf je 3500, nur je 1750 Mehrfachsprengköpfe auf Interkontinentalraketen); Ablösung 2002 durch den SORT - Vertrag (bis 2020 Begrenzung strategischer Atomwaffen auf je 1700, nur einsatzbereite Sprengköpfe sollten berücksichtigt werden); START III, New Start (2010/2011, Verringerung Nuklearsprengköpfe auf 1550, Trägersysteme auf 800).
Mit diesen Verträgen sind die Arsenale nuklearer Sprengköpfe von den beiden Supermächten im Vergleich zu den historischen Höchstwerten um ca. 80% reduziert worden. Die verbleibenden 20 Prozent reichen aber immer noch aus, um die ganze Welt innert Sekunden zu vernichten.
Regionale Abkommen für nuklearfreie Zonen
Die Bedingungen dafür werden von der UNO festgelegt und müssen über einen Verifikationsmechanismus verfügen. Solche Abkommen waren bereits im Atomsperrvertrag vorgesehen. Sie gehen insofern über dessen Verpflichtungen hinaus, als ihre Mitglieder auch nicht die Stationierung von Nuklearwaffen, über die sie keine Kontrolle haben, akzeptieren dürfen. Entsprechende Verträge bestehen für fünf Regionen: Tlatelolco (1961, Lateinamerika und Karibik, 33 Mitglieder); Rarotonga (1986, Südpazifik, 13 Mitglieder); Bangkok (1997, ASEAN-Staaten, 10 Mitglieder); Semei (2009, Zentralasien, 5 Mitglieder), Pelindaba (2009, Afrika, 53 Mitglieder). Ausserdem erklärte sich im Jahre 2000 die Mongolei zu einem nuklearfreien Staat.
Konventionelle Waffen
Während des Ost-Westkonfliktes lag das Thema der Abrüstung konventioneller Waffen im Hintergrund. Immerhin wurde 1981 von der UNO-Generalversammlung ein Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen verabschiedet, die übermässige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken. Es handelte sich mehr um eine Ergänzung des humanitären Kriegsvölkerrechtes, indem für den Einsatz oder die Räumung von Landminen, Brandwaffen, nicht entdeckbarer Splitter, explosiver Munitionsrückstände schärfere Vorschriften gemacht wurden. Einzig Laserwaffen, die blind machen, wurden gänzlich verboten. 1991 richtete man am Hauptsitz der UNO ein Waffen - Register ein, bei dem die Mitgliedstaaten jährlich ihre Bestände sowie die Ein-und Ausfuhren von sieben Kategorien schwerer konventioneller Waffen melden sollten (Kampfpanzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, grosskalibrige Artilleriesystem, Kampfflugzeuge, Angriffshelikopter, Kriegsschiffe, Raketen und deren Startsysteme). 2003 wurden dem Register auch Kleinwaffen hinzugefügt. Das Meldesystem beruht auf Freiwilligkeit, in den letzten Jahren beteiligen sich aber immer mehr Mitglieder, doch bleibt es nach wie vor unvollständig. Initiativen für eigentliche Abrüstungsmassnahmen musste die UNO zunächst einzelnen Mitgliedstaaten überlassen. Nach starkem Druck von Nicht-Regierungsorganisationen ergriffen Kanada, Norwegen, Belgien und Österreich die Initiative, die 1997 in Ottawa zur Unterzeichnung des Vertrages über ein vollständiges Verbot von Antipersonenminen führte. Mit einem ähnlichen Vorgehen kam es 2008 in Oslo zu dem Übereinkommen, das den Einsatz von Streumunition verbot. Für beide Abkommen wurde die UNO zum Depositar ernannt, sie wurde auch für die Organisation periodischer Überprüfungskonferenzen verantwortlich gemacht. In der Zwischenzeit einigte man sich 2001 an der UNO in New York über ein Aktionsprogramm für Kleinwaffen, das zum Ziel hatte, den illegalen Handel zu verhindern. Zu diesem Zweck wurden die Mitgliedstaaten aufgefordert, solche Waffen bei der Herstellung zu markieren und zu registrieren, damit sie identifiziert werden können. Nach jahrelangen Bemühungen konnte die UNO 2013 ein Abkommen über den Waffenhandel verabschieden. Die Vertragsparteien werden verpflichtet, nationale Kontrollbehörden zu schaffen und bei schweren Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechtes auf Ausfuhren des im Waffenregister enthaltenen Kriegsmaterials zu verzichten. Jährlich haben sie dem vom Vertrag eingerichteten Sekretariat in Genf über ihre Bewilligungsverfahren Bericht zu erstatten.
Verifikation ist bei Abrüstungsabkommen das schwierigste Problem. Blosse Berichterstattungen der Vertragsparteien sind nicht immer glaubwürdig, auch wenn mit moderner Satellitentechnik einiges kontrolliert werden kann. Bei dem Atomsperrvertrag wurde die Verifikation der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) übertragen. Nicht-Kernwaffen Staaten haben für ihre zivilen Anlagen eine Kernmaterialbilanz zu führen, die von den IAEA-Inspektoren kontrolliert wird. Nachdem vermutet wurde, dass der Irak unter Saddam Hussein ein geheimes Nuklearwaffen-Programm betrieb, wurden die Meldepflichten und die Rechte der Inspektoren weiter ausgebaut.
Sie gehen jedoch nicht so weit wie die Kontrollen des Chemiewaffenabkommens. Die Inspektoren der „ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons “ haben das Recht, jederzeit unangemeldet in militärischen Anlagen, aber auch in Privatunternehmen der chemischen Industrie zu überprüfen, ob die Vertragsparteien ihren Verpflichtungen nachkommen.
Wie bereits erwähnt, verhängt der Sicherheitsrat seit den 1990er Jahren vermehrt Waffenembargos gegenüber Krisengebieten. Auch bei der Proliferation von Massenvernichtungswaffen ist er seither strenger vorgegangen. Die ausgedehnten Wirtschaftssanktionen gegenüber dem Irak sollten nicht zuletzt bewirken, vermeintliche Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen aufzudecken. Seit 2006 wurde auch Iran wegen verdächtigter Entwicklung von Nuklearwaffen mit Sanktionen belegt. Sie konnten anfangs 2016 weitgehend aufgehoben werden, nachdem es zwischen Teheran und den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates + Deutschland zu einer Verständigung gekommen war. Nach wie vor in Kraft sind Sanktionen gegenüber Nordkorea, das 2003 den Atomsperrvertrag gekündigt hatte. Keine Sanktionen verhängte der Sicherheitsrat gegenüber Indien und Pakistan, als sie sich zu Nuklearmächten erklärten. Das gilt ebenfalls für Israel, das seine Nuklearwaffen mit Schweigen bedeckt, obwohl jedermann weiss, dass es über solche verfügt. Offenbar berücksichtigte der Sicherheitsrat den Umstand, dass die drei Länder den Atomsperrvertrag nie ratifiziert haben.
Eine schwere Bedrohung für die Sicherheit der Menschen stellt heute der internationale Terrorismus dar . Es ist bekannt, dass Terrorismus eine lange Geschichte hat. Auch nach dem zweiten Weltkrieg gab es Aufständische und terroristische Gruppen, die mit Gewalt politische Veränderungen herbeizuführen suchten. Solange ihre Aktionen lokal blieben, konnte die UNO kaum mehr als gute Dienste und Hilfe für Flüchtlinge anbieten.
Die spektakulären Flugzeugentführungen Ende der 1960er setzten die UNO jedoch unter Zugszwang. Dass dahinter palästinensische Gruppen standen, machte das Thema nicht einfacher. Wie anderen kolonialen Völkern war von der UNO auch den Palästinensern das Recht auf Selbstbestimmung zuerkannt worden. Weil dessen Umsetzung auf friedlichem Wege nicht vorwärtskam, vertraten arabische Staaten den Standpunkt, die Palästinenser seien berechtigt, zur Erreichung ihrer Unabhängigkeit auf alle notwendigen Mittel zurückzugreifen.
Einmal mehr ging es um die Auseinandersetzung, wer ein Terrorist und wer ein Freiheitskämpfer sei. Das Dilemma verhindert bis heute, dass man sich in der UNO auf eine klare Definition des Terrorismus einigen kann. Trotzdem gelang es, für gewisse Aktivitäten internationale Abkommen zu vereinbaren. Als Antwort auf spezifische Vorfälle wurden in UNO-Sonderorganisationen und in der UNO-Generalversammlung eine Reihe solcher Abkommen ausgehandelt:
- Internationale Zivilluftfahrt Organisation (ICAO) fünf Abkommen: 1963 Massnahmen von Flugkapitänen gegen Passagiere mit terroristischen Absichten; 1970 Verpflichtung der Vertragsstaaten, Flugzeugentführer schwer zu bestrafen; 1971 Verpflichtung der Vertragsstaaten, gegen Straftäter entweder selber vorzugehen oder sie auszuliefern; 1983 Kenntlichmachung von plastischen Sprengstoffen zum Zweck ihrer Entdeckung; 1988 Protokoll zum Schutz internationaler Flughäfen.
- internationale Schifffahrtsorganisation (IMO) zwei Abkommen: 1988 Bestrafung von Bombenanschlägen und Piratenakten auf Schiffen; 1988 Zusatzprotokoll - Einbezug fester Erdölinstallationen auf dem Festlandsockel.
- Internationale Atomenergieagentur (IAEA) zwei Abkommen: 1988, physischer Schutz von nuklearem Material; 2005 Verpflichtung der Vertragsstaaten auf intensiven Informationsaustausch über den Schutz von Nuklearanlagen.
- UNO-Generalversammlung: fünf Abkommen: 1972 Strafen bei Attentaten auf völkerrechtlich geschützte Personen und Diplomaten; 1979 Verbot von Geiselnahmen; 1997 Verhinderung sicherer Häfen für Terroristen; 1999 Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus; 2005 Unterbindung von Lieferung nuklearen Materials an terroristische Gruppen.
Völkerrechtliche Verträge verpflichten nur Staaten, die sie ratifiziert haben. Und sie stellen bloss Normen auf, die von Staaten umgesetzt werden müssen. Immerhin bilden sie eine Grundlage, dass staatliche Institutionen (Polizei, Gerichte, Nachrichtendienste) nach gemeinsamen Regeln handeln können. Umso erfreulicher ist es, dass in den letzten Jahren die Zahl der Vertragsparteien merklich gestiegen ist.
Während sich der Sicherheitsrat lange darauf beschränkte, Terrorismus zu verurteilen, schlug er 1992 nach den Bombenanschlägen im Panam-Flug über Lockerbie und im Flug der Union des Transports Aériens über N‘Djamena schärfere Töne an. Er bezeichnete die Anschläge als Bedrohung von Sicherheit und Frieden und belegte Libyen, das in beiden Fällen als Drahtzieher galt, mit Wirtschaftssanktionen gemäss Kapitel VII. Gleich reagierte er 1996, als der Sudan sich weigerte, die mutmasslichen Attentäter des Mordversuches auf den ägyptischen Präsidenten Mubarak auszuliefern. 1999 verhängte er ähnliche Sanktionen gegenüber den Taliban und Al-Kaida.
Noch ein Schritt weiter ging der Sicherheitsrat, als am 11.9.2011 selbstmörderische Flugzeugentführer die World Trade Towers in New York und das Pentagon in Washington angriffen und über 3000 Menschen töteten. Innert 24 Stunden entschied der Sicherheitsrat, dass jedem Staat gemäss Artikel 51 der Charta ein Recht auf Selbstverteidigung zustehe. Das löste den militärischen Einsatz der USA und ihrer Alliierten in Afghanistan aus.
Gestützt auf Kapitel VII der Charta erliess der Sicherheitsrat anschliessend eine Reihe von Vorschriften, um Massnahmen gegen den Terrorismus zu verstärken. Das brachte ihm einige Kritik ein, weil er sich damit als weltweiter „Gesetzgeber“ betätigte, was nach Ansicht verschiedener Rechtsgelehrten über sein Mandat hinausgeht.
Das hinderte den Sicherheitsrat nicht daran, für die Umsetzung seines Entscheides einen eigenen Ausschuss einzusetzen (Counter Terrorism Committee), in dem alle 15 Mitglieder vertreten sind. Um dessen Effizienz zu verstärken, gründete er ebenfalls ein Exekutivkomitee (Counterterrorism Executive Committee), für das über 40 Experten rekrutiert wurden. Hinzu kam 2004 ein weiterer Ausschuss, der dafür sorgen soll, dass Terrorgruppen beim Erwerb von Massenvernichtungswaffen nicht geholfen wird.
Die Kritik am Sicherheitsrat ging zurück, als die Generalversammlung 2006 einstimmig der Antiterrorismusstrategie zustimmte, die von Kofi Annan unterbreitet worden war. Allerdings wurde im Dokument unterstrichen, dass beim Kampf gegen den Terrorismus die Menschenrechte beachtet werden müssen. Der Sicherheitsrat schuf darauf 2009 den Posten der Ombudsperson, die ihre Meinung äussern kann, ob Sanktionen gegen Einzelpersonen wirklich begründet sind. Kofi Annan hatte seinerseits schon 2005 im Sekretariat einen Sonderstab (Counter-Terrorism Implementation Task Force) eingesetzt, um die Aktionen internationaler Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen, zu koordinieren (Weiss & Thakur, 2010).
Kofi Annans Antiterrorismusstrategie sprach auch die Notwendigkeit an, sich mit den Wurzeln des Terrorismus zu beschäftigen. Für viele lag dabei die Armut im Vordergrund. Dass das ein wichtiger Faktor ist, ist nicht zu bestreiten. Die Erfahrungen mit Al-Kaida und dem islamischen Staat zeigen jedoch, dass es unter den Führungsschichten viele gebildete und wohlhabende Persönlichkeiten gibt. Unter den Flugzeugentführern in New York und Washington befanden sich in Europa ausgebildete Ingenieure. Das Fussvolk kommt aber meistens aus ärmlichen und diskriminierten Schichten. Selbst die jungen Europäer, die sich dem islamischen Staat anschliessen, sind häufig Muslime zweiter Generation, die Mühe haben, in Europa ihre Lebensziele zu verwirklichen.
Ende 2015 konnte sich der Sicherheitsrat auf Sanktionen einigen, mit denen die finanziellen Mittel des Islamischen Staates ausgetrocknet werden sollen. In der auf Kapitel VII gestützten Resolution wurde festgehalten, dass der Islamische Staat eine „globale und beispiellose“ Gefährdung von Frieden und Sicherheit darstelle. Deshalb ermächtigte der Sicherheitsrat ausdrücklich, gegen ihn mit „ allen notwendigen Massnahmen “ vorzugehen.
Auf Anregung des spanischen Ministerpräsidenten Zapatero und seines türkischen Kollegen Erdogan nahm UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon 2007 die Idee einer Allianz der Zivilisationen auf. Eine Sachverständigengruppe von 18 Personen wurde eingesetzt, die sich je zu einem Drittel aus ehemaligen Politikern, Wissenschaftlern und religiösen Führern aus allen Kulturkreisen zusammensetzt. Ihre Aufgabe ist es, Vorschläge auszuarbeiten, wie religiöser und kultureller Extremismus zu überwinden sei. Die Initiative der Allianz ging auf die Spannungen im Mittleren Osten zurück, wo jedoch inzwischen eine unüberwindbar scheinende Konfrontation zwischen den Glaubensbrüdern der Schiiten und Sunniten eingesetzt hat.
Religion und Kultur haben viel mit Menschenrechten zu tun. Dessen waren sich die Gründer der Vereinten Nationen bewusst, da sie die schrecklichen Morde des Hitler-Regimes an Juden und anderen Minderheiten vor Augen hatten. Deshalb verankerten sie in der Präambel und in Art. 55 der Charta ihre Überzeugung, zur Erhaltung des Friedens müsse auch ein weltweiter Schutz menschlicher Grundrechte geschaffen werden.
Mit der Umsetzung wurde der Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) beauftragt, der 1946 die Kommission für Menschenrechte einsetzte. Dieser ist es innert zwei Jahren gelungen, einen Katalog politischer und wirtschaftlicher Rechte auszuarbeiten, der 1948 von der Generalversammlung als Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde. Weil es sich um eine Resolution handelte, war die Erklärung nicht rechtsverbindlich, sie wird heute aber als Bestandteil des Völkergewohnheitsrechtes betrachtet. Im gleichen Jahr konnte ein Vertrag über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes abgeschlossen werden.
Von Anfang an bestand die Absicht, für den Inhalt der allgemeinen Erklärung einen völkerrechtlichen Vertrag auszuarbeiten. Mit dem Ausbruch des Kalten Krieges geriet das Unterfangen ins Stocken. Während der Westen vor allem auf zivilen und politischen Rechten bestand, legten die Ostblockstaaten das Schwergewicht auf die wirtschaftlichen Rechte. 1966 einigte man sich, die beiden Aspekte in zwei getrennten Verträgen zu regeln. So konnte die Generalversammlung Ende des gleichen Jahres den Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie den Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte genehmigen. Die Abkommen sind inzwischen von über 75% der Mitgliedstaaten ratifiziert worden, was angesichts der anfänglichen Meinungsverschiedenheiten beachtlich ist.
Schon ein Jahr zuvor hatte die Generalversammlung einen Vertrag über die Beseitigung jeglicher Form von Rassendiskriminierung verabschiedet. Darauf wurden weitere Verträge ausgehandelt:
1979 Beseitigung jeglicher Form von Diskriminierung der Frauen, 1984 Verbot der Folter, 1989 Rechte des Kindes, 1990 Rechte der Wanderarbeiter, 2000 Bekämpfung des Handels von Frauen und Mädchen, 2006 Rechte der Menschen mit Behinderung, 2006 gegen das Verschwinden von Personen.
Um die Abkommen durchzusetzen, sind die vorgesehenen Instrumente in der UNO eher schwach. In der Regel gibt es jeweils einen Experten-Ausschuss, dem die Vertragsparteien alle vier oder fünf Jahre zu berichten haben, wie sie den vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen sind. Viele dieser Berichte fallen nichtssagend aus oder werden gar nicht eingereicht. In Zusatzprotokollen können sich Staaten verpflichten, auch Individualbeschwerden zuzulassen, solche Protokolle sind jedoch längst nicht von allen Vertragsparteien ratifiziert worden. Der Ausschuss der Experten hat bloss festzustellen, ob eine Vertragsverletzung vorliegt, und entsprechend den ECOSOC und die Generalversammlung zu informieren. Diese sind jedoch nur befähigt, Empfehlungen abzugeben.
Müssen sich die Ausschüsse auf die vertraglich festgelegten Verpflichtungen beschränken, konnte die 1946 eingesetzte Menschenrechtskommission in allen Mitgliedstaaten die Einhaltung der Menschenrechte überwachen. Da sie sich dabei auf die allgemeinen Grundsätze der Charta stützt, durfte sie sich nur mit massiven und systematischen Verletzungen beschäftigen.
Die Menschenrechtskommission bestand anfänglich aus 18 staatlichen Vertretern, deren Zahl mit zunehmender UNO-Mitgliedschaft auf 53 erhöht wurde. Die Wahl oblag dem ECOSOC, die Amtszeit galt für drei Jahre, konnte aber verlängert werden. Die Kommission trat einmal pro Jahr im März/April für eine sechswöchige Sitzung zusammen (seit 1974 in Genf).
Mit den Resolutionen 1235 (1967) und 1503 (1970) ermächtigte der ECOSOC die Kommission, auch Berichte von Einzelpersonen oder privaten Gruppen entgegenzunehmen. Für die Überprüfung spezifischer Situationen wurden Expertenausschüsse oder Sonderberichterstatter eingesetzt, die mit der Zustimmung des betreffenden Staates Abklärungen vor Ort durchführen konnten. Über ihre jährlichen Sitzungen hatte die Kommission dem ECOSOC Bericht zu erstatten, der ihn an die Generalversammlung weiterleitete. Weil beide Organe nur zu Empfehlungen berechtigt sind, ging das gesamte Vorgehen nicht über öffentliches „naming and shaming“ hinaus.
Die Menschenrechtskommission ist 2006 aufgelöst und durch den Menschenrechtsrat ersetzt worden. Noch zuvor wurde jedoch ein weiteres Instrument geschaffen. Die Wiener Konferenz über die Menschenrechte, die 1993 nach harten Auseinandersetzungen die universale Gültigkeit der Menschenrechte bestätigen konnte, empfahl die Schaffung eines Hochkommissars für Menschenrechte. Der Vorschlag wurde von der Generalversammlung im gleichen Jahr akzeptiert.
Der Kommissar untersteht direkt dem Generalsekretär, seine Ernennung muss aber von der Generalversammlung genehmigt werden. Er ist beauftragt, die Tätigkeiten aller UNO-Menschenrechtsorgane zu koordinieren und diese nicht nur logistisch, sondern auch inhaltlich zu unterstützen. Er soll ferner Mitgliedstaaten bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen zur Seite stehen, wofür er in mehreren Ländern lokale Büros unterhält.
Die Menschenrechtskommission wurde 2006 aufgelöst, weil ihr Funktionieren unter Kritik geraten war. Das hatte vor allem mit dem Wahlmodus zu tun. Wie in der UNO üblich, kommt jeder Regionalgruppe eine bestimmte Zahl von Vertretern zu. Einige Regionalgruppen stellten häufig nur die genaue Zahl von Kandidaten gemäss ihrer Quote auf, so dass der ECOSOC diese nur bestätigen konnte. Immer wieder befanden sich darunter Länder, in denen die Menschenrechtslage kritisch war. Als Mitglieder konnten sie verhindern, dass darüber diskutiert wurde.
Nach schwierigen Verhandlungen einigte sich die Generalversammlung Ende 2015 darauf, die Kommission durch den Menschenrechtsrat zu ersetzten. Manche hätten diesen gerne zu einem Hauptorgan der UNO gemacht, wofür aber eine Änderung der Charta notwendig gewesen wäre. So schuf man ihn als Unterorgan der Generalversammlung, womit das Wahlrecht vom ECOSOC auf die Generalversammlung überging. Das Vorhaben, für die Wahl von Kandidaten eine Zweidrittelmehrheit vorauszusetzen, kam nicht durch, es wurde nur eine absolute Mehrheit in geheimer Abstimmung festgelegt. Mit Zweidrittelmehrheit kann aber ein Mitglied des Rates, in dem es zu schweren Verletzungen der Menschenrechte kommt, ausgeschlossen werden.
Die Zahl der Mitglieder wurde gegenüber 53 der Kommission auf 47 verringert. Sie werden für drei Jahre gewählt und dürfen unmittelbar nur einmal wiedergewählt werden. Der Rat hat pro Jahr 3 ordentliche Sitzungen von insgesamt mindestens zehn Wochen in Genf abzuhalten. Kommt es zu dringenden Problemen, kann er jederzeit zu Sondersitzungen einberufen werden. Verschiedene Prozeduren und Instrumente – wie Expertenausschüsse und Sonderberichterstatter – sind von der Kommission übernommen worden, wobei die entsprechenden Verfahren gestrafft wurden. Eine bedeutende Neuerung ist, dass der Rat periodisch die Einhaltung der Menschenrechte in allen UNO-Mitgliedstaaten zu untersuchen hat (Universal Periodic Review). Damit wird dem Einwand entgegengetreten, nur diskriminierend gegen einzelne Staaten vorzugehen. Alle drei bis vier Jahre muss sich jeder Staat einer solchen Prüfung unterziehen.
Auch wenn der Rat besser als die vorausgegangene Kommission operiert, bleibt seine Bilanz gemischt. Immer noch gelingt es Staaten, sich in den Rat wählen zu lassen, obwohl deren Einsatz für die Menschenrechte mehr als zweifelhaft ist. „Der wirkliche Test für die Glaubwürdigkeit des Menschenrechtsrates wird der Gebrauch sein, den die Mitgliedstaaten davon machen“, sagte 2006 Generalsekretär Kofi Annan. Vorläufig ist nicht zu behaupten, dass der Test überzeugend gelungen ist.
Nach dem Ende des Ost-Westkonfliktes begann sich ebenfalls der Sicherheitsrat, m it Menschenrechten zu beschäftigen. Früher hatte er das Thema gemieden, weil es als interne Angelegenheit der Staaten betrachtet wurde. Da in den 90er Jahren immer mehr interne Konflikte aufkamen, war nicht mehr zu übersehen, dass diese häufig auf schwere Verletzungen von Menschenrechten zurückgingen. Als Saddam Hussein im Norden und Süden des Irak kurdische und schiitische Minderheiten verfolgte, hielt der Sicherheitsrat 1991 zum ersten Mal fest, dass damit der internationale Frieden bedroht werde.
In der Folge qualifizierte der Sicherheitsrat massive Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechtes auch in anderen internen Konflikten als Bedrohung des Friedens. Immer häufiger erteilte er friedenserhaltenden Truppen den Auftrag, für den Schutz der Zivilbevölkerung zu sorgen und setzte dafür separates Personal wie Polizisten und Menschenrechtsexperten ein. In verschiedenen Fällen griff er zu Wirtschaftssanktionen, die zunächst allgemein galten. Seit Ende der 1990er Jahre konzentrierte er sich hauptsächlich auf „smart sanctions“, die einzelne Täter oder Anstifter mit Reiseverboten und der Blockierung ihrer Auslandguthaben belegten. Die dritte Stufe war die Schaffung von Sondertribunalen (Ex-Jugoslawien 1993, Ruanda 1994), die vom Sicherheitsrat beauftragt wurden, Verantwortliche strafrechtlich zu verfolgen und hinter Gitter zu bringen.
Unter der Schirmherrschaft der UNO beteiligten sich darauf zahlreiche Staaten an Verhandlung über einen ständigen Strafgerichtshof, dessen Statut 1998 in Rom unterzeichnet wurde. Der Gerichtshof ist befähigt, gegen Regierungsmitglieder oder Einzelpersonen vorzugehen, die sich an Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen beteiligt haben. Seine Zuständigkeit ist subsidiär, weil diese erst wirksam wird, wenn es ein Mitgliedstaat verfehlt, eigene Bürger oder andere Verbrecher, die auf seinem Territorium wirkten, zur Rechenschaft zu ziehen. Ausserdem kann der Sicherheitsrat auch Täter aus Staaten, die nicht Vertragsmitglied sind, an den Gerichtshof überweisen. Bisher ist das nur im Falle des Sudans und Libyens erfolgt. Das Römer Statut ist von 123 Staaten ratifiziert worden, kürzlich kündigte Burundi seinen Austritt an. Unter den Staaten, die nicht beigetreten sind, finden sich weiterhin die drei Vetomächte USA, Russland und China.
Die Spannungen zwischen Art. 2,7 der Charta, sich nicht in interne Angelegenheiten der Mitgliedstaaten einzumischen, und das gleichzeitige Postulat, für einen weltweiten Respekt grundlegender Menschenrechte zu sorgen, führten auch nach dem Kalten Krieg im Sicherheitsrat häufig zu Spannungen. Angesichts der schrecklichen Völkermorde in Bosnien und Ruanda berief Kanada eine Gruppe von 10 hochrangigen Experten aus allen Weltteilen ein, die untersuchen sollte, ob staatlichen Souveränität den Vorrang hat, wenn es zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt.
Innerhalb eines Jahres kam die Gruppe zum Schluss, dass es für die Nichteinmischung in interne Angelegenheiten Grenzen gibt. Denn für alle Staaten gelte als oberste Pflicht, jedem seiner Bürger grundlegende Menschenrechte zu garantieren. Ist ein Staat dafür nicht fähig oder willens, soll er zunächst von der internationalen Gemeinschaft auf friedlichem Wege unterstützt werden. Falls das nicht zum Ziele führt, sei es erlaubt, mit militärischen Mitteln zum Schutz der betroffenen Menschen einzugreifen. In der Schlusserklärung zum 50. Geburtstag der UNO stellten sich die Staats-und Regierungschefs hinter das Prinzip der Schutzverantwortung („responsability to protect“). Allerdings hielten sie dabei fest, dass für militärische Eingriffe immer eine Genehmigung durch den Sicherheitsrat zu erfolgen hat. Erstmals berief sich der Sicherheitsrat 2011 auf das Prinzip, als er eine Koalition von Willigen ermächtigte, zum Schutz der Zivilbevölkerung in Libyen einzugreifen. Dieser Entscheid kam jedoch nur zustande, weil sich Russland und China der Stimme enthielten. Seither ist es wegen dem Widerstand der beiden Veto-Mächte nicht mehr zu einem solchen Beschluss gekommen, obwohl dafür in mehreren Fällen gute Gründe bestanden hätten.
Schliesslich ist noch die Initiative von Kofi Annan am Davoser Weltwirtschaftsgipfel von 1999 zu erwähnen. Mit dem „Global Compact“ suchte Annan transnationale Unternehmen zu verpflichten, in ihren Niederlassungen auf der ganzen Welt international vereinbarte Normen über Menschenrechte, Arbeitsbedingungen und Umweltschutz einzuhalten. Von Gralshütern der Menschenrechte wurde der Vorstoss kritisiert, weil er rechtlich verpflichtende Normen einer freiwilligen Meldepflicht unterstellte. Kofi Annan hatte aber seit Jahren die Arbeit privater Menschenrechtsorganisationen unterstützt und wollte nun auch die Unternehmerschaft an Bord bringen. Seither haben sich dem „Global Compact“ über 13‘000 weltweit tätige Unternehmen angeschlossen. Nach wie vor wird befürchtet, dass viele von ihnen sich vor allem für ihre „Image-Pflege“ beteiligen würden. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass gut vernetzte NGOs, die Berichte staatlicher Behörden zu widerlegen vermögen, noch leichter im Stande sein dürften, beschönigenden Informationen transnationaler Unternehmen auf die Spur zu kommen.
6. UNO-Tätigkeiten in weiteren Bereichen
Art. 55 der UNO Charta fordert, dass die zwischenstaatliche Zusammenarbeit auch in wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereichen voranzutreiben sei, um das Wohlergehen aller Völker zu fördern und so eine stabilere Weltordnung zu schaffen. Aufgrund dieses Artikels ist es zur Gründung von 17 UNO- Spezialorganisationen gekommen. Diese beruhen auf gesonderten Verträgen, verfügen über eigene Organe und ein eigenes Budget. Verschiedene von ihnen haben Verwaltungsunionen des 19. Jahrhunderts oder Institutionen des Völkerbunds abgelöst. Andere sind völlig neu geschaffen worden. Ausserdem haben die Generalversammlung und der ECOSOC selber Nebenorgane eingerichtet (Programme, Fonds), denen Aufgaben im Sinne von Art. 55 übertragen worden sind. Sie stehen direkt unter ihrer Kontrolle und werden teilweise aus dem UNO-Budget, mehrheitlich aber über freiwillige Beiträge finanziert.
Obwohl die Spezialorganisationen unabhängig sind, gehören sie zur „Familie “ der Vereinten Nationen. Ihre Tätigkeitsfelder decken sich häufig mit Zuständigkeiten nationaler Fachministerien. In ihren Hauptorganen sitzen denn auch meistens Vertreter solcher Ministerien. Doch die Spezialorganisationen erhalten keine Instruktionen von einem in New-York sitzenden „Ministerpräsidenten“. Der Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) hat bloss die Kompetenz, sie zu koordinieren, wofür er aber über wenig effektive Mittel verfügt.
Es gibt jedoch universelle Organisationen, die nicht zur UNO-Familie gehören. Eine davon ist jene, die bei den westlichen Gründungsvätern der UNO weit oben auf der Prioritäten-Liste stand. Nach dem überbordenden Protektionismus der 1930er Jahre, der den Welthandel um die Hälfte einbrechen liess, ging es vor allem Roosevelt darum, wieder ein dauerhaftes System liberaler Handelsverbindungen herzustellen. 1947 berief der ECOSOC eine Konferenz über Handel und Beschäftigung nach Havanna ein. Diese einigte sich rasch auf die grundlegenden Pfeiler eines Regimes, das auf Abbau von Zöllen und mengenmässigen Beschränkungen sowie Nichtdiskriminierung (Meistbegünstigung und Inländerbehandlung) beruhen sollte. Eine zu schaffende Internationale Handelsorganisation hätte ferner das Recht erhalten, bei Marktstörungen, ungleichen Handelsbilanzen und schwankenden Rohstoffpreisen eingreifen zu können. Das ging liberalen Kräften in den USA zu weit, weshalb Truman – der Nachfolger von Roosevelt – es gar nicht wagte, die Havanna-Charta dem amerikanischen Senat für die Ratifizierung zu unterbreiten.
Damit war die internationale Handelsorganisation vor ihrer Geburt gestorben. Doch hatten die Amerikaner schon vorher begonnen, mit 23 Staaten in Genf über erste Schritte des Zollabbaus zu verhandeln. Das führte 1948 zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT). Wie dessen Titel besagt, handelte es sich bloss um einen völkerrechtlichen Vertrag, in dem periodisch neue Verhandlungsrunden vorgesehen waren. Bis 1986 fanden sieben solcher Runden statt, bei denen die Zölle auf verarbeitete Produkte schrittweise von 40% auf 6% gesenkt wurden. Parallel dazu erhöhte sich die Zahl der Vertragsparteien von ursprünglich 23 auf 128.
Anlässlich der achten, sogenannten Uruguay- Runde (1986-1993), kam man auf die Idee einer Organisation zurück. Das bisherige System, das nur den Warenhandel erfasste, wurde mit Verträgen über Dienstleistungen (GATS) sowie über Aspekte handelsrelevanter Eigentumsrechte (TRIPS) erweitert. Um die drei Verträge unter ein gemeinsames Dach zu stellen, gründete man die « World Trade Organization – WTO », die am 1.1.2005 in Kraft trat. Während die neuen Verträge über Dienstleistungen und Eigentumsrechte für fortgeschrittene Länder von grossem Interesse waren, fielen die Vorteile für Entwicklungsländer bescheiden aus. Denn bei den Agrarprodukten, wo sie über Wettbewerbsvorteile verfügen, beschloss man bloss, mengenmässige Beschränkungen und nicht-tarifäre Handelshemmnisse in Zölle umzuwandeln. Immerhin erklärten sich die Industrieländer bereit, den ärmsten Ländern für den Export ihrer Produkte möglichst freien Zugang zu gewähren, ohne dass sie deswegen Reziprozität zu beachten hätten.
Um der zunehmenden Frustration der Entwicklungsländer Rechnung zu tragen, wurden 2001 in Doha neue Verhandlungen unter dem Titel „ Entwicklungsrunde “ eröffnet. Da aber die WTO-Minister am ursprünglichen Konsens-Prinzip des GATT festhalten (obwohl sie rein rechtlich auch mit Dreiviertel Mehrheit abstimmen könnten), stecken die Verhandlungen seit Jahren in einer Sackgasse. Einer der Gründe ist, dass die meisten Industrieländer beim Agrarhandel nicht zu Konzessionen bereit sind, die von den Entwicklungsländern erwartet werden. Als Folge davon kommt es vermehrt zu regionalen Vereinbarungen über Zollunionen und Freihandelszonen, die nach GATT- und WTO-Regeln zwar zulässig sind, aber als solche nicht ein universelles Handelssystem gewährleisten.
Was jedoch in der WTO funktioniert, sind die neuen Vorschriften zur Umsetzung und zur Beilegung von Streitigkeiten. Nicht nur müssen alle Mitgliedstaaten regelmässig berichten, wie sie ihren Verpflichtungen nachkommen, auch das Sekretariat verfasst dazu einen eigenen Bericht, was den Druck auf Transparenz erhöht. Kommt es zu Streitigkeiten, sind in der WTO viel schärfere Verfahren vorgesehen als in den früheren GATT-Regeln. Zwar gab es zur Lösung von Streitigkeiten auch im GATT Experten-Panels, die aber nur mit der Zustimmung aller Vertragsparteien eingesetzt werden konnten und deren Schlussfolgerungen ebenfalls von allen Parteien genehmigt werden mussten.
Diese Prinzipien sind in der WTO auf den Kopf gestellt worden. Es wurde ein dreistufiges Verfahren vereinbart, welches grundsätzlich nicht länger als 16 Monate dauern soll. In einem ersten Schritt haben die Streitparteien zu versuchen, sich auf diplomatischem Wege zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, wird automatisch ein Panel eingesetzt, wenn nicht alle Vertragsparteien dagegen stimmen. Dessen Verdikt gilt, sofern es nicht von allen anderen Mitgliedern abgelehnt wird. Zwar kann die unterlegene Partei in einem dritten Schritt noch an eine Berufungsinstanz gelangen, deren Schlussfolgerungen endgültige Wirksamkeit erlangen, ausser sie werden wie beim Panel-Verfahren von allen anderen Vertragspartnern zurückgewiesen. Die unterlegene Partei kann zu Schadenersatz für die Verluste der Klägerin verpflichtet werden oder muss Repressalien hinnehmen. Mit anderen Worten besteht für die Regelung von Streitfällen in der WTO faktisch eine supranationale Gerichtsbarkeit.
Zwei Organisationen, die für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen ebenfalls sehr wichtig sind, wurde noch vor dem Inkrafttreten der UNO-Charta gegründet. Es handelte sich um den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Nach Verhandlungen in Bretton Woods unter amerikanischer und britischer Führung traten die beiden Institutionen schon Ende 1944 in Kraft.
Der Währungsfonds (International Monetary Fund – IMF) verfolgte das Ziel, eine stabile internationale Finanzordnung zu schaffen, um den wirtschaftliche Austausch unter den Staaten zu erleichtern. Zu diesem Zweck sollten Währungen untereinander konvertibel sein. Für alle Währungen wurde ein fester Kurs gegenüber dem Dollar festgelegt, von dem sie bloss nach oben und nach unten um 1% abweichen durften. Die amerikanische Währung war ihrerseits für 35 Dollar pro Unze an Gold gebunden. Die Amerikaner verpflichteten sich zum An- und Verkauf von Gold zu diesem Preis.
Mit dem System fester Wechselkurse sollte verhindert werden, dass es nicht mehr - wie während der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre - zu einem Abwertungs-Wettlauf kommt, um sich einseitige Vorteile zu verschaffen. Kamen Währungen unter Druck, bestand die Möglichkeit, kurzfristige Überbrückungskredite zu beantragen. Dafür mussten sich die Mitgliedstaaten beim Fonds auf eine bestimmte Quote von abrufbaren Finanzmitteln verpflichten. Diese wurden nach der Wirtschaftsgrösse, der Offenheit der Volkswirtschaft, der Leistungsbilanz und den Währungsreserven festgelegt. Hatte ein Land mit seiner Zahlungsbilanz ein strukturelles Problem, durfte es abwerten (feste, aber anpassungsfähige Paritäten). Um solches so weit als möglich zu verhindern, war es erlaubt, Kapitalverkehrskontrollen aufrecht zu erhalten.
Das System, das während zwei Jahrzehnten gut funktionierte, hat wesentlich dazu beigetragen, dass Produktion und Handel kräftig wuchsen. Gegen Ende der 1960er Jahre geriet aber die Handelsbilanz der USA in Schwierigkeiten. Die Dollarbestände ausserhalb der USA begannen die amerikanischen Goldreserven zu übersteigen. 1971 musste Washington die Goldkonvertibilität des Dollars aufgeben. Nach erfolglosen Rettungsversuchen der festen Wechselkurse (Erweiterung der Bandbreiten auf 2,5%) gingen die meisten europäischen Industrieländer zu flexiblen Wechselkursen über. Die 1969 geschaffenen Sonderziehungsrechte vermochten den Dollar nicht zu ersetzen, blieben aber als Rechnungseinheit des IWF erhalten.
Mit der Aufhebung der Goldkonvertibilität des Dollars ging die bisherige Grundfeste des IMF verloren. Doch wollte niemand in ein Chaos zurückkehren, weshalb die Statuten des Fonds 1978 geändert wurden. Waren die meisten Industrieländer zu flexiblen Wechselkursen übergegangen, hielten mehrere Entwicklungsländer an festen Paritäten gegenüber einer Leitwährung oder einem Währungskorb fest. Um im Finanzbereich weiterhin zusammenzuarbeiten, sollte der Fonds die Wechselkurse der Mitglieder überwachen und sicherstellen, dass diese nicht für Manipulationen missbraucht werden. Der Fonds wurde ermächtigt, jährlich die Wirtschafts- und Finanzpolitik in allen Mitgliedstaaten vor Ort zu untersuchen (Artikel IV Missionen).
Ziel war es, dass Krisen in einzelnen Mitgliedern nicht das gesamte internationale Finanzsystem gefährden. Schon in den 1980er Jahren, als lateinamerikanische Länder in Bedrängnis kamen, sprang der Fonds mit Kreditvergaben ein. Das wiederholte sich in den 1990er Jahren, als die asiatischen Tiger in Turbulenzen gerieten, gleichzeitig auch osteuropäische Länder nach dem Zerfall der Sowjetunion mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Einige dieser Krisen wurden durch die Liberalisierung der Kapitalmärkte, die der Fonds unterstützt hatte, verstärkt. Oft handelte es sich nicht um kurzfristige Probleme, weshalb der Fonds für die Vergabe von Krediten Strukturanpassungen forderte. Angesichts des neoliberalen Ansatzes, der damals herrschte, hatten Kreditnehmer massive Eingriffe in ihre Wirtschafts- und Handelspolitik zu akzeptieren.
Das Volumen von IMF-Krediten nahm in diesen Jahren enorm zu. Deshalb mussten die Quoten, die 1946 noch bei 7,6 Mrd. lagen, bis auf 250 Mrd. USD aufgestockt werden. Je nach der Problemlage der einzelnen Länder wurden spezielle Kreditlinien geschaffen. Bei besonderen Notlagen stellten wichtige Mitglieder dem Fonds auch über ihre Quoten hinaus zusätzliche Mittel zur Verfügung. Mit aller - zum Teil berechtigten Kritik - an den harten Konditionalitäten des Fonds, ist doch festzuhalten, dass es dank dem Fonds gelungen ist, den Zusammenbruch des internationalen Finanzsystems zu vermeiden.
Für grössere Kredite hatte der Fonds zu Beginn des 21. Jahrhunderts praktisch keine Kunden mehr. Er setzte aber seine Tätigkeiten mit den am wenigsten entwickelten Ländern fort, denen er schon früher mit Vorzugsbedingungen unter die Arme gegriffen hatte. Diese wurden nun vermehrt mit Programmen zur Armutsbekämpfung verknüpft, was im Konsens von Washington noch nicht vorgesehen war.
Nach dem Ausbruch der Finanzkrise von 2008 stellten sich die schwierigsten Schuldenkrisen erstmals nicht mehr in der südlichen Hemisphäre oder in postkommunistischen Ländern, sondern in den Industriestaaten. Um diesen zu begegnen, mussten die Quoten des Fonds 2009 auf 750 Mrd. USD erhöht werden. Hektisch bemüht sich seither der Fonds um die Eindämmung des Flächenbrandes, wobei er mit der Euro-Zone zusammenarbeitet, die davon am meisten betroffen ist.
Die Weltbank (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD), die gleichzeitig mit dem IMF gegründet wurde, hatte den Auftrag, kriegsgeschädigten Ländern beim Wiederaufbau zu helfen und auch Enzwicklungsländer zu unterstützen. Dank dem Marshall-Plan wurde das erste Ziel bereits in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre erreicht, so dass sich die Bank ausschliesslich auf die Entwicklungsländer konzentrieren konnte. Die Bank war markwirtschaftlich konzipiert worden. Wie beim Fonds hatten auch hier die Mitgliedstaaten gemäss ihrer wirtschaftlichen Grösse Quoten verfügbar zu machen, für die aber nur 20% in konvertierbaren Währungen einzuzahlen waren, der Rest stellte eine Bürgschaft dar. Mit diesen Garantien im Rücken konnte die Bank auf den privaten Finanzmärkten zu günstigen Bedingungen Gelder aufnehmen, weil sie von den internationalen Rating-Agenturen immer mit der höchsten Bonität („triple-A“) bewertet wurde.
Die IBRD funktioniert noch heute nach diesem Modell. Mit den aufgenommenen Mitteln stellt die Bank Ländern mittleren Einkommens Kredite zur Verfügung, die sich dafür interessieren, weil sie selber höhere Zinsen bezahlen müssten oder überhaupt keinen Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten fänden. Die Kredite werden nur für konkrete Projekte vergeben, wobei die Regierungen der Empfängerländer die Rückzahlung garantieren müssen. Die Laufzeit beträgt in der Regel zwischen 25 und 35 Jahren, die Zinssätze sind im Vergleich zum marktüblichen Niveau leicht reduziert.
1956 wurde zusätzlich die internationale Finanzkorporation (International Finance Corporation-IFC) geschaffen. Deren Geldmittel werden grundsätzlich über die IBRD zur Verfügung gestellt. Allerdings müssen hier die Mitgliedstaaten ihre Quoten vollständig einbezahlen. Denn die IFC kann auch ohne staatliche Rückzahlungsverpflichtung Projekte von Privaten in den Entwicklungsländern unterstützen, ja sogar zeitweise Miteigentümer solcher Unternehmen werden.
Für ärmere Länder wurde 1960 die „ International Development Association- IDA » gegründet. Sie verfügt über einen eigenen Fonds, den die reicheren Länder mit Steuermitteln speisen, die alle 4-5 Jahre aufgefüllt werden. Die IDA vergibt weiche Kredite zu Laufzeiten von 35 bis 50 Jahren, die mit Ausnahme einer Bearbeitungsgebühr von 0,75% zinsfrei sind. Erste Rückzahlungen werden erst nach 10 Jahren fällig.
Alle drei Institutionen sind formell eigenständig, stehen aber unter dem Dach der Weltbankgruppe. Die programmatischen Ziele wurden über die Jahre verschiedentlich angepasst. Bis Ende der 1960er Jahren lagen grosse Infrastrukturprojekte (Energie, Verkehr, Telekommunikation) im Vordergrund. In der 1970er Jahren, als Robert McNamara Präsident der Bank wurde, verlegten sich die Prioritäten auf die Landwirtschaft und die ländliche Entwicklung. Nach den Schuldenkrisen der 1980er Jahre beteiligte sich die Bank an den vom IWF angeordneten Strukturanpassungsprogrammen. Inzwischen wird der Schwerpunkt vermehrt auf gute Regierungsführung (good governance) gelegt.[5]
Bis zum Ende des Kalten Krieges beteiligten sich die meisten kommunistisch regierten Länder weder am GATT noch am IMF und der Weltbank. Sie erblickten darin ein Vehikel zur Förderung des von ihnen abgelehnten Kapitalismus. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion suchten praktisch alle Nachfolgestaaten den Beitritt zu den drei Institutionen, so dass sich deren Mitgliederzahl immer mehr jener der UNO-Hauptorganisation nähert: IMF 189, IBRD 189, IFC 184, IDA 173, WTO 164.
Sowohl der Währungsfonds als auch die Weltbank gehörten von Anfang zur Familie der UNO-Spezialorganisationen. Sie weisen jedoch in einem Punkt einen gewichtigen Unterschied auf. In den meisten internationalen Organisationen werden die Mitgliederbeiträge ebenfalls nach der Wirtschaftskraft der einzelnen Länder berechnet, es gilt aber das Prinzip „ein Land, eine Stimme“. Beim IMF und der Weltbank wird dagegen das Stimmrecht jedes Mitgliedes nach der Höhe seiner Quote gewichtet („one dollar-one vote“). Deshalb haben die alten Industriestaaten in den Bretton Woods Institutionen noch heute eine Stimmen-Mehrheit. Mit der steigenden Bedeutung von China und anderen Schwellenländern ändert sich das jedoch mehr und mehr, so dass auch die bisherige Tradition, wonach der Direktor des IMF jeweils ein Europäer ist, während der Präsident der Weltbank von den USA gestellt wird, nicht mehr lange zu halten sein wird.
Nach dem 2. Weltkrieg wurden an verschiedenen Universitäten des Nordens Lehrstühle für Entwicklungsökonomie geschaffen. Auf diesen sassen meistens Modernisierungstheoretiker, die zuversichtlich glaubten, der Rückstand ärmerer Länder sei rasch aufzuholen, wenn man ihnen Kapital und technisches «know how» zur Verfügung stelle.
In den 1950er Jahren entwickelten Ökonomen in Lateinamerika die sogenannte Dependenz-Theorie. Ihr wichtigster Vertreter war der Argentinier Raul Prebisch. Er untersuchte die Preisentwicklungen auf den internationalen Exportmärkten und kam zum Schluss, dass sich die „terms of trade“ von Rohstoffen gegenüber Industrieprodukten ständig verschlechterten. Deshalb meinte er, Länder die nur Rohstoffe ausführten, könnten sich nie entwickeln. Da sie für eingeführte Industrieprodukte immer mehr Rohstoffe ausführen müssten, wofür es keine Nachfrage gebe, kämen sie nur voran, wenn sie Zollabgaben in der notwendigen Höhe einführten, um Industrieprodukte im Anfangsstadium selber herstellen zu können (Importsubstitution).
Die Dependenz-Theorie fand bei Entwicklungsländern grossen Anklang. Prebisch wurde zum Direktor der UNO-Wirtschaftskommission für Lateinamerika ernannt und kam 1964 an die Spitze der neu gegründeten „ United Nations Conference on Trade and Development “ (UNCTAD). Die Entwicklungsländer, die nun in der Generalversammlung über die numerische Mehrheit verfügten, hofften mit diesem UNO-Nebenorgan ein Gegengewicht gegenüber dem GATT und den Bretton Woods Institutionen herzustellen, um „gerechtere Regeln“ für den internationalen Handel zu erwirken.
Diese Hoffnungen verstärkten sich, als die Erdölpreise 1973 um ein Vierfaches in die Höhe schnellten. Die Entwicklungsländer verlangten in der Generalversammlung die Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung. In einer Erklärung, einem Aktionsproramm und der Charta über wirtschaftliche Rechte und Pflichten formulierten sie 1974 an die Adresse der Industriestaaten umfangreiche Forderungen: verstärkte Kontrollen von transnationalen Unternehmen, mehr Entwicklungshilfe, Entlastung bei den Schulden, ein neues Seerecht, die Reform des Währungssystems und finanzielle Beteiligung der Industriestaaten an Abkommen über Rohstoffe, um deren Preise mit Ausgleichslagern zu stabilisieren.
Da Resolutionen der Generalsversammlung nur empfehlenden Charakter haben, nickten die Industriestaaten zähneknirschend zu, setzten aber auf Verzögerungstaktik. Zwar fanden Verhandlungen über ein integriertes Rohstoffprogramm statt, führten aber nicht zum erhofften Erfolg. Die wenigen noch bestehenden Abkommen für Kaffee, Kakao, Zucker und Weizen sind zu blossen Schaltern für Informationen geworden. Der einzige konkrete Erfolg war, dass das GATT den von der UNCTAD ausgearbeiteten Vorschlag für Handelspräferenzen übernahm. Mit dem Allgemeinen Präferenzsystem dürfen GATT-Mitglieder den Entwicklungsländern günstigere Zolltarife gewähren, ohne das Prinzip der Nichtdiskriminierung zu verletzen.
Nach einer Dekade der Konfrontation geriet das Postulat der neuen Weltwirtschaftsordnung in den 1980er Jahren mehr und mehr in Vergessenheit. Einige Entwicklungsländer, die aus eigener Kraft erste Erfolge auf den Weltmärkten erzielten, waren nicht mehr auf uneingeschränkte Solidarität erpicht. Andere hatten unter den erhöhten Erdölpreisen zu leiden und mussten für ihre gewachsenen Schulden stets höhere Zinsen bezahlen. Im Norden setzten Donald Reagan und Margaret Thatcher ihr neo-liberales Credo durch. Gemäss diesem brauchte es weder eine Entwicklungsökonomie noch eine neue Weltwirtschaftsordnung. Vielmehr sollten sich die Entwicklungsländer im eigenen Interesse auf die bewährten Prinzipien der freien Marktwirtschaft besinnen.
Dennoch sprachen die Länder des Südens in der UNO zum Thema der Entwicklungshilfe weiterhin mit einer Stimme. Hartnäckig versuchten sie, der UNO in New York die Hauptrolle zu übertragen. Seit Beginn gab es dort Institutionen, die nicht mit vergünstigten Zinsen, sondern mit Hilfsprojekten arbeiteten.
- 1946 übernahm die Generalversammlung die private Initiative des Amerikaners Maurice Pate und gründete das Kinderhilfswerk UNICEF. Es sollte zunächst Kindern und Müttern in kriegsgeschädigten Ländern helfen, arbeitet aber seit Jahrzehnten fast ausschliesslich in zurückgebliebenen Ländern. Ein Viertel seines jährlichen Budgets von ca. 5 Mrd. USD stammt von privaten Spenden, was die Sympathie und das Ansehen für seine Arbeit zum Ausdruck bringt.
- 1961 startete die Generalversammlung das „ World Food Programm“ ( WFP). Es hat den Auftrag, mit Nahrungsmittelhilfe den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Das Programm wurde öfters kritisiert, weil es die landwirtschaftliche Produktion in Entwicklungsländern hemmen würde. Heute kauft es mit einem Budget von 6 Mrd. USD über 80% seiner Hilfsgüter in Entwicklungsländern ein und verfügt über eine Logistik, mit der es bei Notlagen rasch zur Stelle ist.
- 1965 kam es zur Gründung des UNO-Entwicklungsprogrammes (UNDP), dessen finanzielle Mittel (ca. 5 Mrd. pro Jahr) nach wie vor weit hinter der Weltbank zurückliegen, das aber in letzter Zeit bei der Entwicklungspolitik stark an Einfluss gewonnen hat.
- Auch bei der humanitären Hilfe spielte die UNO von Anfang eine bedeutende Rolle. Bereits 1949 errichtete sie das Hilfsprogramm für palästinensische Flüchtlinge (UNWRA), das aber wegen politischen Turbulenzen in der Region permanent mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.
- Ebenfalls 1949 schuf die Generalversammlung das Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR). Es beruhte auf dem Vorbild des von Fridtjof Nansen geleiteten Amtes im Völkerbund. Seine Tätigkeiten haben in den letzten Jahren enorm zugenommen, so dass es mit jährlichen Mitteln von ca. 6,5 Mrd. USD immer wieder zu zusätzlichen Spenden aufrufen muss.
- Seit 1969 besteht der UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA), der Frauen unterstützt, um zu mehr Selbstbestimmung bei der Familienplanung zu kommen. Er verfügt über ein jährliches Budget von ca. 900 Mio. USD.
- Nach den Weltkonferenzen über Frauen, wurden mehrere Institutionen gegründet, um die Stellung der Frauen weltweit zu verbessern. 2010 hat man diese unter das gemeinsame Dach UN-Women zusammengeführt. Zurzeit steht ein Budget von knapp 300 Mio. USD pro Jahr zur Verfügung.
Die meisten Fonds und Programme sind von der Generalversammlung als Nebenorgane geschaffen worden. Obwohl die Entwicklungsländer in der Generalversammlung über eine klare Mehrheit verfügen, heisst das nicht, dass sie über diese Fonds und Programme nach ihrem Gutdünken schalten und walten können. Denn die Budgetmittel stammen zum grossen Teil von freiwilligen Beiträgen der reichen Länder und werden oft an gewisse Projekte gebunden. Somit ist Achtsamkeit geboten, die Geberländer nicht unnötig zu verärgern.
Einstimmig verlangen die Entwicklungsländer nach wie vor, dass die Entwicklungshilfe der reichen Länder auf 0,7% ihres BIP aufgestockt wird. Dieses Ziel war erstmals 1969 in einem Expertenbericht unter dem Vorsitz des ehemaligen kanadischen Premierminister Lester Pearson aufgestellt worden. An der Konferenz von Monterrey hatten die Industriestaaten zwar 2002 versprochen, ihre Entwicklungshilfe spürbar zu erhöhen. Doch das Ziel von 0,7% des BIP ist nach wie vor nicht erreicht, es wird nur von ein paar nordischen Staaten (Schweden, Norwegen, Dänemark, Niederlande, Luxemburg, UK) erfüllt, der Durchschnitt aller reichen Länder liegt weiterhin bei 0,4%.
Obwohl das UNDP seit Beginn von einer Persönlichkeit aus den Industriestaaten geführt wird, hat es immer eine eigenständige Politik verfolgt. Schon früh kritisierte es die Mega-Projekte der Weltbank, in den 1970er Jahren unterstrich es als erstes die zentrale Bedeutung der Frauen für die Entwicklung. Auch gegenüber dem Konsens von Washington äusserte es sich skeptisch und plädierte für strukturelle Anpassungen «mit einem humanen Gesicht».
Als der ehemalige amerikanische Finanzinvestor William H. Draper 1986 zum Administrator des UNDP ernannt wurde, verlangte er von seinen Mitarbeitern neue Ideen. Eine, die von aussen kam, stammte vom pakistanischen Ökonomen Mahbub U. Haq. Das von ihm unterbreite Konzept des « Human Development Index-HDI wurde von Draper weiterverfolgt. Haq verfeinerte den Vorschlag mit seinem Studienfreund aus Cambridge, dem indischen Ökonomen Amartya Sen. Beide gingen von dem Ansatz aus, dass es nicht genüge, die Entwicklung nur am BIP pro Kopf zu messen. Sie fügten der bisher üblichen Messlatte zwei weitere Parameter hinzu: die Lebenserwartung und den Bildungsstand. Seit 1990 wird der HDI vom UNDP jährlich für fast alle Länder berechnet und im «Human Development Report» veröffentlicht.
Der „Human Development Index“ fand umgehend grosse Beachtung und stimulierte neue Überlegungen. Nicht zuletzt hat er dazu beigetragen, dass die Staats- und Regierungschefs an ihrem Gipfeltreffen vom Herbst 2000 die von Kofi Annan erarbeiteten Millenniumsziele genehmigten. Zum ersten Mal einigten sich Entwicklungs- und Industrieländer auf eine gemeinsame Strategie. Im Zentrum stand die Bekämpfung der Armut, wofür acht spezifische Ziele festlegt wurden, die bis 2015 erreicht werden sollten:
1) Zahl der Menschen, die täglich mit weniger als mit 1,25 USD auskommen müssen, halbieren;
2) allen Kindern eine Grundschulausbildung ermöglichen;
3) auf allen Bildungsstufen nicht mehr zwischen Knaben und Mädchen diskriminieren;
4) die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren um zwei Drittel verringern;
5) die Sterblichkeitsrate von Müttern um drei Viertel senken;
6) die Zahl der an AIDS und Malaria erkrankten Menschen stabilisieren und mit dem Abbau beginnen;
7) den Anteil der Menschen, die über kein sauberes Trinkwasser verfügen, halbieren;
8) Entwicklungshilfe und Schuldenerlass für ärmere Länder erhöhen und ein nichtdiskriminierendes internationales Handels- und Finanzsystem aufbauen.
Mit Ausnahme des letzten Zieles handelte es sich um konkrete Vorgaben, für die sich sowohl Entwicklungs- als auch Industrieländer engagieren sollten. Das UNDP wurde zum Koordinator für die Umsetzung bestimmt, womit dessen Einfluss stark zunahm. Denn es hatte nicht nur die Aktionen der gesamten UNO-Familie zu bündeln, sondern auch Projekte an Ort und Stelle „bottom up“ zu erarbeiten. Der ideologische Graben mit den Bretton Woods Institutionen verringerte sich, weil sich diese ebenfalls aktiv für die Millenniumsziele einsetzten.
Der Erfolg der Millenniums-Strategie mag nicht überwältigend sein, er lässt sich aber sehen:
- die extreme Armut konnte um 50% verringert werden, auch wenn dafür hauptsächlich China und Indien verantwortlich waren, während das Ziel in Afrika nicht erreicht wurde;
- die Beteiligung von Kindern an der Grundschulausbildung wuchs auf 91%;
- viel mehr Mädchen besuchen heute höhere Ausbildungsstufen, doch sind es immer noch weniger als ihre männlichen Altersgenossen;
- die Sterblichkeitsrate von Kindern unter 5 Jahren ging mehr als um die Hälfte zurück;
- die Sterblichkeitsrate von Müttern verringerte sich um 45%;
- die Zahl neuer HIV-Infektionen fiel um 40%, die Sterblichkeitsrate von Malaria sank um 58%, jene für Tuberkulose um 45%;
- 1,9 Mrd. Menschen erhielten Zugang zu einem Trinkwasseranschluss;
- der Auslandschuldendienst der Entwicklungsländer fiel gegenüber ihren Exporterlösen von 12% auf 3% (UNDP; 2015).
Die erreichten Fortschritte ermutigten die Staats- und Regierungschefs im September 2015, den eingeschlagenen Pfad weiter zu verfolgen. Es wurden siebzehn Ziele vereinbart, die bis 2030 unter dem Titel „ Sustainable Development Goals “ erreicht werden sollen. Die höhere Zahl der Ziele erklärt sich damit, dass neben der wirtschaftlichen und sozialen Förderung auch Vorgaben für die ökologische Nachhaltigkeit aufgestellt wurden:
1. Armut überall beenden; 2.Hunger beseitigen; 3.allen Menschen ein gesundes Leben ermöglichen; 4.inklusive, gleichberechtige und hochwertige Bildung gewährleisten und lebenslanges Lernen fördern; 5.Gleichstellung der Geschlechter erreichen, alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen; 6. nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung gewährleisten; 7. bezahlbare, verlässliche, nachhaltige und moderne Energie für alle sichern; 8. nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit fördern; 9. widerstandsfähige Infrastrukturen aufbauen, nachhaltige Industrialisierung fördern, Innovationen unterstützen; 10. Ungleichheit in und zwischen den Ländern verringern; 11. Städte inklusiv, sicher und nachhaltig gestalten; 12. nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster erarbeiten; 13. umgehend Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels ergreifen; 14. Meeresressourcen nachhaltig nutzen; 15. Wälder und Landökosysteme nachhaltig nutzen, Wüstenbildung bekämpfen und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzten; 16. friedliche und inklusive Gesellschaften fördern, allen Zugang zur Justiz ermöglichen, rechenschaftspflichtige Institutionen auf allen Ebenen aufbauen; 17. Umsetzungsmittel stärken und globale Partnerschaften mit neuem Leben erfüllen.
Mehrere dieser Ziele mögen utopisch klingen, jedes von ihnen spricht indessen Probleme an, mit denen die Weltgemeinschaft konfrontiert ist. Somit ist auch Skeptikern das alte Sprichwort zu empfehlen, der Weg sei wichtiger ist als das Ziel.
Der häufigste Begriff in der Agenda 2030 ist «sustainable» (nachhaltig). Was darunter zu verstehen ist, hat der Brundtland Bericht „Our Common Future“ bereits 1987 definiert: „ Nachhaltige Entwicklung ist die Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“.
Für die Agenda 2030 ist erneut dem UNDP die Koordination übertragen worden. Für die Nachhaltigkeit soll aber auch das „ UN Environment Programme “ (UNEP) eine wichtige Rolle spielen. Dieses wurde nach der Umwelt-Konferenz von Stockholm 1972 gegründet. Ihm erteilte die UNO-Generalversammlung das Mandat, regelmässig den Zustand der Umwelt zu untersuchen, Vorschläge für notwendige Massnahmen zu machen und die internationale Umweltpolitik zu koordinieren.
Obwohl Umweltprobleme seit 1972 massiv zugenommen haben, ist das UNEP noch heute ein kleines Organ. Es verfügt bloss über ein jährliches Budget von etwas mehr als 300 Mio. USD. Trotzdem hat es eine beachtliche Bilanz vorzuweisen. So leistete es entscheidende Beiträge für die Aushandlung der meisten universellen Abkommen, die seit den 1970er Jahren vereinbart werden konnten. Seit Jahren laufen Diskussionen, das UNEP zu verstärken. Die einen möchten es zu einer UNO-Spezialorganisation umwandeln, andere sogar zu einem Hauptorgan der Vereinten Nationen aufwerten. Bisher konnte man sich auf kein Reformvorhaben einigen. Einen Schritt vorwärts hat man insofern gemacht, als sich seit 2014 alle 2 Jahre die Umweltminister der UNO- Mitgliedstaaten treffen, um dem Verwaltungsrat des UNEP politische Impulse zu geben.
Zur Erfüllung seiner Aufgaben arbeitet das UNEP neben den Staaten auch mit NGOs und internationalen Netzwerken der Wissenschaft zusammen. So hat es 1988 mit der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) die Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe über Klimaveränderung (Weltklimarat - IPCC) ins Leben gerufen. Der IPCC sammelt die Erkenntnisse von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt und verfasst darüber periodisch einen Bericht. Sein fünfter Bericht (2013/2014) hat massgeblich dazu beigetragen, dass sich Ende 2015 in Paris 195 Staaten auf eine neue Klimakonvention einigen konnten. Gleichzeitig haben die reicheren Staaten bekräftigt, ab 2020 jährlich 100 Mrd. USD zur Verfügung zu stellen, um den Entwicklungsländern bei der Umsetzung des Abkommens zu helfen.
Die Spezialorganisationen der UNO waren als „technisch“ konzipiert worden. Deshalb standen sie auch Staaten offen, die nicht Mitglied der UNO waren. Als in den 1960er und 1970er Jahren die unabhängig gewordenen Staaten des Südens den meisten Spezialorganisationen beitraten, setzten diese häufig die gleichen politischen Themen auf die Agenda, die in New York diskutiert wurden. Das betraf etwa Südafrikas Apartheid-Politik oder das israelische Vorgehen in den palästinensischen Gebieten. Fehlleistungen einzelner Direktoren aus dem Süden verärgerten die westlichen Staaten, was dazu führte, dass die grossen Beitragszahler aus dem Norden auf einem Null-Wachstum der Budgets beharrten. Zudem vergifteten ideologischen Auseinandersetzungen zwischen Ost und West das Klima, weil sich die Staaten des Ostblocks meistens hinter die Entwicklungsländer stellten.
Neben den bereits erwähnten beschäftigen sich mit wirtschaftlichen Aufgaben noch weitere Spezialorganisationen der UNO:
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (UN Food- and Agriculture Organization - FAO), übernahm das Erbe des 1905 gegründete Internationalen Instituts für Landwirtschaft, wurde aber mit einem viel weiterreichende Mandat ausgestattet:
Förderung nationaler und internationaler Anstrengungen zur Agrarentwicklung, Schutz natürlicher Ressourcen, verbesserte Verarbeitung und Verteilung von Nahrungsmitteln.
Um diese Aufgaben zu erfüllen, hat die FAO eine Datenbasis erstellt, die über 1000 Produkte aus der Land- und Forstwirtschaf sowie der Fischerei erfasst und die als Frühwarnsystem zur Ernährungssicherheit dient. Seit 1961 erarbeitet die FAO mit der WHO den Codex Alimentarius, der Qualitätsstandards für Nahrungsmittel festlegt. Ferner wurden Abkommen über Pflanzenschutz und Saatgut sowie Verhaltenskodizes über Pestiziden und für verantwortungsvolle Fischerei ausgearbeitet. All diese Tätigkeiten finden noch heute Wertschätzung.
Allerdings geriet die FAO schon früh unter Kritik, weil deren Arbeitsweise als zu bürokratisch galt. Deshalb wurde 1961 das Welternährungsprogramm gegründet, dem die Hauptverantwortung für die Bekämpfung des Hungers übertragen wurde. Dieses Programm verfügt heute über fünf Mal mehr Ressourcen als die FAO, deren jährliches Budget ca. 1,2 Mrd. USD beträgt. Angesichts ihres Mandates war es naheliegend, dass die FAO vor allem Entwicklungsländer bei der Modernisierung ihrer Landwirtschaft unterstützte. Gerade diese Entwicklungsprojekte entfachten jedoch in der Organisation eine Krise, weil die langjährigen Direktoren Edouard Saouma (Libanon 1976-1993) und Jacques Diouf (Senegal 1994-2011) mit diesen Mitteln recht eigenhändig umgingen, womit der Verdacht entstand, sie würden diese nutzen, um sich Stimmen für ihre Widerwahl zu sichern. In der Tat konnten die beiden mit jeweils 18 Jahren ungewöhnlich lange im Amt bleiben. Deshalb wurden 2009 die Statuten geändert und die Amtszeit des Generaldirektors auf zwei Perioden von 4 Jahren begrenzt. Unter dem neuen Direktor José Graziano da Silva (Brasilien) scheinen inzwischen seit langem geforderte Reformen voranzukommen.
Am Welternährungsgipfel von 1974 wurde nach den fürchterlichen Hungersnöten in den Sahel-Ländern die Gründung eines Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (« International Fund for Agricultural Development – IFAD «) beschlossen, der drei Jahre später seine Arbeit aufnahm. Er operiert ähnlich wie die IDA und vergibt hauptsächlich stark vergünstigte Darlehen. Seine Aufgabe ist es, Kleinbauern zu unterstützen, damit sie effizienter produzieren und überschüssige Produkte auf den Markt bringen können. Der Fonds hat seit seinem Bestehen über 20 Mrd. USD Kleinkredite vergeben, fast die Hälfte davon an Frauen. Er investiert daneben in lokale Infrastruktur und sucht gesicherte Besitzverhältnisse zu schaffen. Seine Tätigkeit wird allgemein geschätzt und auch von privaten Firmen und Stiftungen unterstützt. An Herausforderungen fehlt es ihm nicht, leben doch nach wie vor 75% der ärmsten Menschen auf der Welt in ländlichen Gebieten.
In den 1960er Jahren drängten die Entwicklungsländer auf eine UNO-Politik für ihre Industrialisierung. Trotz Skepsis der entwickelten Länder wurde 1966 das UNO-Programm für industrielle Entwicklung geschaffen. 1985 gelang es den Entwicklungsländern, dieses Programm in eine Spezialorganisation Sonderorganisation umzuwandeln (« UN Industrial Development Organization – UNIDO «). Deren Aufgaben blieben weitgehend die gleichen:
technische Hilfe für die Erarbeitung von Industrieprojekten (speziell für die Nahrungsmittelindustrie und die Energiewirtschaft), Förderung privater Investitionen und des Technologietransfers, Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit und des Zugangs auf den Weltmarkt.
Da sich die Organisation praktisch nur als Beraterin von Regierungen betätigte, geriet der Wert ihrer Arbeit in den 1990er Jahren unter Druck, als sich die Marktwirtschaft weiter ausdehnte. 1993 verliessen die USA, Kanada und Australien die Organisation, so dass wegen Geldmangel der Zusammenbruch drohte. Heute zählt die UNIDO 170 Mitglieder und verfügt über ein jährliches Budget von ca. 180 Mio. USD. Ende der 1990er Jahre konnten Reformen durchgesetzt werden, so dass die Organisation seither in ein ruhigeres Fahrwasser gekommen ist.
Die Weltorganisation für Tourismus (World Tourism Organization - abgekürzt UNWTO, damit sie nicht mit der WTO verwechselt wird) ist die bislang jüngste und kleinste Spezialorganisationen der UNO. Sie wurde 2003 gegründet, verfügt über ein Jahresbudget von 20 Mio. USD und beschäftigt knapp 100 Mitarbeiter. Wie andere hat auch sie eine längere Vorgeschichte. Bereits 1925 fand in Den Haag der erste internationale Kongress über Tourismus statt, der zur Errichtung eines ständigen Büros führte. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Büro nach Genf verlegt, um Kontakte mit den dort ansässigen internationalen Organisationen zu pflegen. Es handelte sich jedoch um eine NGO, der private wie öffentliche Organisationen aus dem Tourismus-Bereich angehörten. Au Betreiben einer Reihe von Staaten wurde aus ihr 1974 eine intergouvernementale Organisation gemacht. Nachdem sie vom UNDP ein Mandat für technische Beratung in Tourismusfragen erhalten hatte, erfolgte 2003 die Umwandlung in eine UNO-Spezialorganisation. Einer ihrer Schwerpunkte ist noch heute die Förderung eines nachhaltigen Tourismus in Entwicklungsländern. Von ihr wurde der Globale Kodex für Ethik im Tourismus ausgearbeitet. Als Forum für gegenseitige Informationen findet die Organisation allgemein Anerkennung. Ihre jährlich herausgegebene Statistik belegt, dass der Tourismus zurzeit schneller wächst als der internationale Handel, auch wenn er periodisch unter terroristischen Attacken sowohl im Norden wie im Süden zu leiden hat.
Die Weltorganisation für Geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization – WIPO) entstand 1967 und ersetzte das seit 1883 bestehende Büro zum Schutz des geistigen Eigentums. 1974 erhielt die WIPO das Statut einer UNO-Spezialorganisation. Sie verwaltet zwei Dutzend Abkommen und dient als Forum für deren Anpassung und Weiterentwicklung. In den Abkommen werden namentlich Patente, Marken, Gestaltungsformen (Design) sowie Urheberrechte geregelt. Während Urheberrechte, die für künstlerisches Schaffen gelten (neuerdings zählen auch Computerprogramme dazu) nicht angemeldet werden müssen, generiert die WIPO für die Registrierung von Patenten und Marken ca. 90% ihres jährlichen Budgets. Die Philosophie hinter dem Schutz des geistigen Eigentums war seit Ende des 19. Jahrhunderts die Förderung von Innovationen. Erfinder sollten für eine bestimmte Zeit ein exklusives Nutzungsrecht erhalten. 1995 wurde die WIPO übergangen, als in der WTO ein eigenes Abkommen über handelsrelevante Eigentumsrechte abgeschlossen wurde. Danach steigerte sich die Kritik einiger Entwicklungsländer, weil sie geistige Eigentumsrechte als Zementierung von Monopolstellungen betrachten. Zwar wurde 2007 in der WIPO eine Entwicklungsagenda («Development Agenda») vereinbart, mit der ein besserer Ausgleich zwischen den Interessen der industrialisierten und der zurückgebliebenen Länder erreicht werden soll. Was dabei herauskommt, ist noch ungewiss. Bei den Ländern, welche die meisten Patente anmelden, figurieren in letzter Zeit China und Südkorea auf den vordersten Plätzen.
Art. 55 der UNO-Charta verlangte nicht nur eine verstärkte Zusammenarbeit im wirtschaftlichen, sondern auch im sozialen, gesundheitlichen und kulturellem Bereich. Zwischen 1946 und 1948 wurden zu diesem Zweck drei weitere Spezialorganisationen ins Leben gerufen, die auf Institutionen zurückgriffen, die schon früher bestanden hatten, aber erweiterte Mandate erhielten.
Die Internationale Arbeitsorganisation (Internatzional Labour Organizatio-ILO) war zusammen mit dem Völkerbund entstanden und wurde 1946 in die UNO-Familie integriert. Zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die in ihr eine eigenen Vertretung haben, ist es immer wieder zu in der Natur liegenden Auseinandersetzungen gekommen. Anfangs der 1970er Jahre geriet die ILO jedoch in einen politischen Sturm. Die Amerikaner hielten Teile ihres geschuldeten Beitrages (der 25% des ILO Budgets ausmachte) zurück, weil die ILO reihenweise Israel für die Arbeitsbedingungen in den besetzten Gebieten verurteilte, während Themen für arbeitsrechtliche Defizite in den Ostblockstaaten konstant ignoriert wurden. Als die ILO 1975 der PLO einen Beobachterstatus zuerkannte, verliessen die Amerikaner die Organisation. Zwar konnte das fehlende Geld aus Washington teilweise mit freiwilligen Beiträgen kompensiert werden. Trotzdem setzte in der ILO ein Prozess der Besinnung ein. Behutsam kam man zurück auf die ursprünglichen Aufgaben und begann wieder sachlicher über verbesserte Arbeitsstandards zu verhandeln. Bereits 1980 traten die Amerikaner der Organisation wieder bei.
Seit ihrem Bestehen hat die ILO 189 Konventionen über den Schutz der Arbeitnehmer ausgearbeitet. Zu den wichtigsten unter ihnen gehören:
das Recht auf Vereinigungsfreiheit, das Recht auf Kollektivverhandlungen, das Verbot der Kinderarbeit, das Mindestalter für die Zulassung zur Erwerbstätigkeit, die Abschaffung der Zwangsarbeit sowie das Verbot der Diskriminierung bezüglich Geschlecht, Rasse, Religion und politischer Meinung.
Um die Einhaltung von Verpflichtungen zu überwachen, gibt es in der ILO wie bei den UNO-Menschenrechtkonventionen nur ein Berichtsverfahren. Dieses funktioniert aber insofern besser, weil neben Regierungsvertretern und Arbeitgebern auch Vertreter der Arbeitnehmer stimmberechtigt sind. Zudem gibt die ILO jährlich etwa 130 Mio. USD (ca. 20% ihres Budgets) aus, um die Entwicklungsländer bei der Umsetzung der Sozialrechte zu unterstützen.
Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization-WHO) hat den Auftrag, für alle Menschen auf der Welt das bestmögliche Gesundheitsniveau zu erreichen. In ihr arbeiteten von Anfang an viele Ärzte, die sich bemühten, übertragbare Infektionskrankheiten zu bekämpfen. In einer der ersten Phase wollte man Malaria überwinden, wobei es zu Schwierigkeiten kam, weil sich herausstellte, dass deren Überträger unerwartet rasch Resistenzen entwickelten. Erfolgreicher war die zweite Kampagne, mit der in relativ kurzer Zeit die Pocken ausgerottet werden konnten. Danach wurden auch bei der Bekämpfung von Kinderlähmung, Tuberkulose, Darmwürmern und Frambösie erhebliche Fortschritte erreicht. Nachdem 2002 die SARS-Epidemie ausgebrochen war, musste die WHO zunächst gegen zurückgehaltene Informationen der chinesischen Regierung kämpfen, setzte aber durch, dass sie für Massnahmen (z.B. Reiseverbote) auch auf andere Informationsquellen zurückgreifen darf. Als 2004 die Vogelgrippe folgte, geriet die WHO in Kritik, weil sie mit ihrer Aufforderung zur Lagerung von Impfstoffen übermässig reagiert hatte. Bei der Ebola- Epidemie in Westafrika wurde ihr dagegen vorgeworfen, dass sie sich zu spät engagiert habe. Inzwischen ist ihr mit dem Zika-Virus eine weitere Herausforderung entstanden. Als Folge der Globalisierung ist das Risiko grösser geworden, dass sich ansteckende Krankheiten schnell auf der ganzen Welt verbreiten.
Seit Jahrzehnten ist die WHO auch damit beschäftigt, die medizinische Grundversorgung („Primary Health Care“) in zurückgeblieben Ländern zu verbessern. Es gehört zu ihrem Mandat, nicht nur zu heilen und einzudämmen, sondern auch an der Wurzel präventiv zu wirken. Deshalb revidiert sie periodisch ihre Liste unentbehrlicher Medikamente, was immer wieder zu Konflikten mit der pharmazeutischen Industrie führt. Diese hat bis jetzt wenig Interesse gezeigt, Heilmittel für tropische Krankheiten zu erforschen, weil in diesen Ländern zu wenig Kaufkraft besteht. Neuerdings lenkt die WHO ihr Augenmerk auch auf nicht übertragbare Krankheiten (Krebs, Diabetes, Kreislaufstörungen, Atembeschwerden), die wegen der längerer Lebenserwartung, zu wenig Bewegung und unausgeglichener Ernährung sowohl in reichen wie amen Ländern zunehmen. Nicht zuletzt aus diesem Grunde hat die WHO das Rahmenabkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums vorangetrieben. Nach jahrelangem Ringen mit Industrie-Interessen ist es ihr ebenfalls gelungen, einen Verhaltenskodex für die Vermarktung von Ersatzprodukten für Muttermilch durchzusetzen.
Für die Bekämpfung von AIDS hat die UNO 1996 ein eigenes Programm (UNAIDS) eingerichtet, an dem die WHO mit 9 weiteren UNO-Institutionen beteiligt ist. Das Programm wurde geschaffen, weil von Anfang an klar war, dass hier neben medizinischen Aspekten auch gesellschaftspolitische Hindernisse zu überwinden waren. Noch heute leben 23 Mio. Menschen mit AIDS, die jährlichen Neuansteckungen konnten aber von 3 Mio. auf 2 Mio. verringert werden. Ausserdem hat sich die Pharmaindustrie bereit erklärt hat, den ärmeren Ländern, die am stärksten unter AIDS zu leiden haben, die notwendigen Behandlungsmittel verbilligt zur Verfügung zu stellen. Gemäss dem UNO-Plan dauerhafter Entwicklung sollten Neuansteckungen bis 2030 auf null reduziert werden. Um das Ziel zu erreichen, wird es aber weitere Investitionen in Milliardenhöhe brauchen.
Das Ziel der Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) wird in der Präambel des Gründungsvertrages wie folgt definiert: „Da Kriege im Geist des Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist des Menschen verankert werden“. Zur Förderung der Bildung suchte sie prioritär, allen Kindern auf der Welt den Zugang zur Grundschule zu ermöglichen. 1948 waren in Lateinamerika noch 40%, in Asien 60% und in Afrika 80% der Bevölkerung Analphabeten. Der abschliessende Bericht über die Millenniumsziele konnte 2015 feststellen, dass nun über 90% der Kinder auf der ganzen Welt Zugang zu einer Grundschule haben. Das ist nicht ausschliessliches Verdienst der UNESCO, doch mit ihren Programmen zur Ausbildung von Lehrern und finanzieller Unterstützung für die Errichtung von Schulen war ihr Beitrag doch erheblich. In der Wissenschaft hat sie über Netzwerke namentlich die Forschung in der Ozeanographie, der Hydrologie und der Geologie gefördert, womit ein erheblicher Schatz von Expertise entstanden ist. Im Bereich der Kultur verwaltet sie die Abkommen zum Schutz der Kulturgüter in bewaffneten Konflikten und die Konvention gegen den illegalen Handel mit Kulturgütern. Bekannt ist ihre Tätigkeit zur Erhaltung des Welterbes, die mit antiken Städten und Bauwerken begann, sich danach auf erhaltenswerte Naturgebiete und schliesslich auch auf kulturelle Ausdrucksformen ausdehnte. Dass Kulturgüter in bewaffneten Konflikten schwer zu schützen sind, hat die Zerstörung von Palmyra gezeigt, was nicht der erste Fall war. Die Idee, zu diesem Zweck eine Art Blauhelme zu schaffen, dürfte jedoch nicht so einfach zu realisieren sein.
Intern war die Organisation in den 1970er und 1980er Jahren mit einer schweren Krise konfrontiert. Unter der Führung des senegalesischen Generaldirektors Amadou-Mahtar M’Bow traktandierten die Entwicklungsländer eine neue Weltinformationsordnung, um die Vorherrschaft westlicher Medien zu brechen. Da sie dabei vom Sowjetblock unterstützt wurden, sahen die westlichen Staaten das im Gründungsvertrag festgehaltene Prinzip der Pressefreiheit in Frage gestellt. Aus Protest verliessen deshalb die USA und das Vereinigte Königreich die Organisation. Beide Länder traten wieder bei, nachdem das Thema Ende der 1980er Jahre langsam vergessen wurde – wie die vorher von den Entwicklungsländern postulierte neue Weltwirtschaftsordnung. 2011 hat die UNESCO die palästinensische Autonomiebehörde als Vollmitglied aufgenommen, worauf die USA ihre Beitragszahlungen aussetzten, die 22% des jährlichen Haushalts von 350 Mio. USD ausmachen. Die neue Administration in Washington droht inzwischen erneut, zusammen mit Israel auszutreten.
Zu der Familie der Vereinten Nationen gehören noch fünf weitere Organisationen, deren Aktivitäten überwiegend technisch sind, so dass Politik bei ihnen seltener eine Rolle spielt.
Die internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union-ITU) geht auf den internationalen Telegraphenverein zurück, der 1865 als erste intergouvernementale Organisation des industriellen Zeitalters gegründet worden war. Seit der Erfindung des Telegrafen und des Telefons sind in der Kommunikationstechnologie enorme Neuerungen hinzugekommen (Radio, Fernsehen, Telefax, mobile Telefonie, Satelliten, Internet, digitale Revolution). Die ITU hat die Aufgabe, den grenzüberschreitenden Verkehr dieser Mittel zu erleichtern:
sie regelt die Nutzung von Frequenzen, registriert Sende- und Empfangsfrequenzen, teilt Rufzeichen zu, koordiniert die Entwicklung von Telekommunikationsanlagen, beteiligt sich an der Aufhebung von Störungen und vereinbart Leistungsgarantien und Gebühren.
Die Zuteilung von Internet Adressen wird nach wie vor von der «Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)» in Los Angeles wahrgenommen. Es handelt sich um eine private Organisation, die von der amerikanischen Regierung überwacht wird, was immer wieder zu Kritik führt. Keine Kompetenzen hat die ITU, wenn Regierungen aus politischen Gründen den Zugang zu Fernmeldesystemen einschränken.
Der Weltpostverein (Universal Postal Union – UPU) beschäftigt sich noch heute weitgehend mit den Aufgaben, die er 1874 bei der Gründung erhalten hatte. Er koordiniert die Zusammenarbeit der nationalen Postverwaltungen, regelt die grenzüberschreitenden Gebühren und die Entschädigungen bei Verlusten von eingeschriebene Sendungen. Mit dem Internet ist der Briefverkehr stark zurückgegangen, dagegen nehmen Paketsendungen dank des on-line Handels zu. Auch beteiligen sich Poststellen vermehrt daran, Ersparnisse von Migranten an Familienangehörige nach deren Herkunftsländer zu überweisen.
Die internationale Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization-ICAO) wurde 1944 in Montreal gegründet und ersetzte die seit den Versailler Friedensverträgen bestehende «Commission Internationale de Navigation Aérienne». Sie legt verbindliche Standards für die zivile Luftfahrt fest, regelt internationale Verkehrsrechte, erarbeitet Richtlinien für den Brandschutz, teilt die Codes für Länder und Flugzeugtypen zu, entwickelt Standards für maschinenlesbare Reisedokumente, definiert Grenzwerte für Fluglärmemissionen und beteiligt sich an den Untersuchungen bei Unfällen im Flugverkehr.
Die Gründung der internationalen Seeschifffahrts-Organisation (International Maritime Organization-IMO) wurde 1950 beschlossen, trat aber erst 1958 in Kraft. Die IMO ist für wirtschaftliche Angelegenheiten der Handelsschifffahrt zuständig. Sie setzt Standards zur Verhinderung der Meeresverschmutzung sowie Vorschriften für die Sicherheit der Schiffe und deren Besatzungen. Die Beiträge an das Budget der Organisation richten sich nach dem Anteil der jeweiligen Mitgliedstaaten an der Welthandelstonnage. Zurzeit stammen die grössten Zahlungen aus Panama, Liberia und den Bahamas.
Die Weltorganisation für Meteorologie (World Meteorological Organization-WMO) ging 1950 aus der 1873 gegründeten internationalen Meteorologie-Organisation hervor. Sie koordiniert die weltweite Zusammenarbeit von Wetterstationen, standardisiert deren Beobachtungsmethoden und sichert den raschen Austausch ihrer Daten. Auch unterstützt sie die Forschung in der Meteorologie und der Hydrologie. Wie bereits erwähnt ist sie mit dem UNEP an den Arbeiten des Welt-Klimarates beteiligt und organisierte 1979 die erste Klimakonferenz in Genf.
Die nur summarisch beschriebenen Tätigkeiten der UNO-Programme und der Spezialorganisationen belegen, dass diese im heutigen Umfeld zwar von unterschiedlicher, in verschiedenen Bereichen jedoch von sehr konkreter Bedeutung sind.
7. Zunahme regionaler Organisationen
Neben den universellen Organisationen sind in den letzten Jahrzehnten eine noch weit grössere Zahl regionaler Organisationen entstanden. Mehrheitlich handelt es sich um wirtschaftliche Zusammenschlüsse, mit denen für die Produktion grössere Märkte geschaffen werden sollen. Die üblichen Instrumente dazu sind Freihandelszonen und Zollunionen. Vermehrt kommen auch regionale Finanz-Institutionen hinzu. In beiden Bereichen geht es nicht zuletzt darum, sich in der globalen Wirtschaft besser positionieren zu können.
Ebenfalls auf politischer Ebene sind regionale Organisationen gegründet worden, um mit einheitlichem Auftreten auf dem internationalen Parkett mehr Einfluss zu gewinnen. Meistens wird von diesen Organisationen auch das Ziel verfolgt, untereinander für friedliche Verhältnisse zu sorgen. Im Sinne von Art. 52-54 der UNO-Charta können sie deshalb vom Sicherheitsrat als subsidiäre Instrumente eingesetzt werden, um zur Lösung von Konflikten in ihrer Region beizutragen. Selbst wirtschaftliche Organisationen haben sich in diese Richtung entwickelt, weil sie zur Verwirklichung ihrer Interessen ein friedliches Umfeld brauchen.
Regionale Organisationen sind inzwischen derart zahlreich geworden, dass auf diese hier nur selektiv eingegangen werden kann.
Europa
Eine der wichtigsten Regionalorganisationen ist die Europäische Union – EU. Ziel ihrer Gründer war, Kriege auf dem europäischen Kontinent zu überwinden. Nach dem Prinzip der Funktionalisten wurde schrittweise vorangegangen. Als erstes legte man 1951 die Kohle- und Stahlproduktion zusammen. 1957 folgte die Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die mit der Abschaffung der Zölle 1968 zur Zollunion wurde. Die Einheitliche Akte schuf 1986 den Binnenmarkt, in dem die internen Grenzen für alle Produktionsfaktoren aufgehoben wurden. Anfangs 2002 trat die gemeinsame Währung des EURO in Kraft, die vorläufig nur von 19 Mitgliedstaaten übernommen worden ist. Diesen Fall variabler Geometrie, der im Sinne von «Vorläufer» verstanden wird, hat die EU schon früher angewendet. So nehmen an dem 1995 geschaffenen Schengen-Raum, der die Personenkontrollen an den Binnengrenzen abschaffte und eine gemeinsame Visumspolitik einführte, nicht alle Mitgliedstaaten teil.
Von den anfänglich 6 Gründerstaaten ist die EU danach auf 28 Mitlieder gewachsen, nächstens wird jedoch Grossbritannien austreten. Auch wenn die Euro-Zone und der Schengen-Raum wegen Schuldenproblemen und der Flüchtlingswelle unter Druck gekommen sind, handelt es sich nicht um die ersten Krisen, welche die EU zu überwinden hatte. Auf jeden Fall übt sie weiterhin Anziehungskraft aus, stehen doch eine Reihe von Beitrittskandidaten vor ihrer Tür. Die EU gehört heute zu den wichtigsten Handelsmächten der Welt und ist der grösste Geber von Entwicklungshilfe, während der Euro auf den internationalen Finanzmärkten nach dem Dollar zur zweitwichtigsten Währung aufgestiegen ist.
Der supranationale Charakter der Union hat sich zunehmend verstärkt, indem Beschlüsse immer mehr mit qualifizierter Mehrheit gefällt werden[6]. Für einige Bereiche gilt aber nach wie vor die intergouvernementale Zusammenarbeit. So braucht es bei Steuern, sozialer Sicherheit, dem Polizeiwesen und der Aussen- und Sicherheitspolitik weiterhin Einstimmigkeit. Für die Aussenpolitik gab es seit 1970 einen informellen Mechanismus, um so weit als möglich mit gemeinsamen Positionen aufzutreten. In der Einheitlichen Europäischen Akte ist die politische Zusammenarbeit vertraglich festgehalten worden. Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde 1997 das Amt des Hohen Vertreters für die Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik geschaffen. Der Vertrag von Lissabon verstärkte 2007 das Amt institutionell und schuf einen eigenen Dienst für aussen- und sicherheitspolitische Angelegenheiten.
Da die EU über keine Streitkräfte verfügt, liegen ihre aussenpolitischen Schwerpunkte auf «soft power». In den letzten Jahren hat sie in Abstimmung mit der UNO 30 Friedensmissionen auf dem Balkan, in Osteuropa, in Afrika und in Südostasien durchgeführt. Darunter gibt es auch militärische Operationen, bei denen mit Personal aus den Mitgliedstaaten Abrüstungsmassnahmen kontrolliert werden und gegen Piraten am Horn von Afrika und gegen Flüchtlingsschlepper im Mittelmeerraum vorgegangen wird. In einigen Ländern Afrikas stehen solche Missionen lokalen Streit- und Polizeikräften in der Logistik zur Seite, um den Terrorismus zu bekämpfen. Mehrheitlich sind jedoch EU Friedensmissionen ziviler Natur, mit denen man sich in fragilen Staaten für den Aufbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie für die Achtung der Menschenrechte einsetzt.
Der Europarat wurde 1948 gegründet und war nach dem Krieg die erste europäische Regional-Organisation. Der Anstoss ging von Churchill aus, der 1946 in einer Rede in Zürich für die Bildung der «Vereinigten Staaten von Europa» plädiert hatte. Die Idee wurde von zahlreichen Bürgerbewegungen enthusiastisch aufgenommen. Für deren Verwirklichung kam es aber zu unterschiedlichen Meinungen. Die einen verstanden darunter den Aufbau eines föderalen Staates, anderen hatten mehr eine klassische intergouvernementale Organisation im Sinne. Wenig überraschend setzte sich bei den Verhandlungen der zehn Gründerstaaten in London die letztere Option durch.
Das Mandat wurde breit gefasst: der Europarat sollte als Forum für die Diskussion allgemeiner europäischer Fragen dienen, zwischenstaatliche Abkommen aushandeln, das gemeinsame Erbe bewahren und sowohl den wirtschaftlichen wie den sozialen Fortschritt fördern. Neben dem Ministerrat als oberstem Organ wurde eine parlamentarische Versammlung geschaffen, der jedoch nur eine beratende Funktion zukommt. Um die Verdienste von Bürgerbewegungen zu würdigen, erhielten Nicht-Regierungsorganisationen bereits 1952 eine spezielle Akkreditierung, wie sie später auch in anderen Organisationen eingeführt wurde.
Seit seinem Bestehen hat der Europarat über 200 zwischenstaatliche Abkommen ausgearbeitet. Das wichtigste unter ihnen ist die 1950 verabschiedete Menschenrechtskonvention, deren herausragendes Merkmal ein sehr starker Kontrollmechanismus ist. Alle Bürger aus den Mitgliedstaaten können beim Gerichtshof der Konvention klagen, nachdem sie die staatlichen Instanzen durchlaufen haben. Der Gerichtshof erfreut sich grosser Beliebtheit, werden bei ihm doch jährlich über 40'000 Berufungen eingereicht.
Die Zahl der Mitgliedstaaten ist in 1990er Jahren von 23 auf 47 gestiegen, da nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime praktisch alle Staaten aus Ost-Europa dem Europarat beitraten. Das trifft auch für Russland zu, den russischen Abgeordneten in der parlamentarischen Versammlung ist aber nach der Annexion der Krim bis auf weiters das Stimmrecht entzogen worden. Um Überlappungen mit anderen Organisation zu vermeiden, konzentriert sich der Europarat heute auf die Förderung von Demokratie und Rechtstaatlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte. 1990 richtete er die Venedig-Kommission ein, die nicht nur Mitgliedern, sondern auch Drittstaaten für verfassungsrechtliche Fragen Expertenhilfe zur Verfügung stellt.
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (« Organisation for Security and Cooperation in Europe-OSCE ») ist aus der 1973 in Helsinki begonnen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit (KSZE) hervorgegangen. Es war die Sowjetunion, die seit den 1960er Jahren auf Verhandlungen drängte, um die Grenzen der Nachkriegsordnung international zu verankern. Erst während der Entspannungspolitik der 1970er Jahre stieg der Westen darauf ein, konnte aber neben Sicherheitsfragen auch eine Diskussion über Menschenrechtsfragen durchsetzen. Zudem bestand Bereitschaft, über erleichterte Wirtschaftsbeziehungen zu diskutieren.
Auf diese drei «Körbe» einigte man sich 1975 in Helsinki, worauf zu deren Umsetzung an periodischen Verhandlungsrunden weitergearbeitet wurde. Erwartungsgemäss entwickelte sich das Thema der Menschenrechte als das schwierigste, führte aber zu einem nicht erwarteten Ergebnis. In mehreren Ost-Staaten bildeten sich sogenannte Helsinki-Komitees, die auf eine konkrete Umsetzung der Menschenrechte pochten. Es ist nicht zuletzt diesen Bürgerbewegungen zu verdanken, dass es nach 1989 in den kommunistisch regierten Ländern Osteuropas zu einer politischen Wende kam. Widerstandslos konnte 1990 am Pariser Gipfel das «demokratische Modell» zelebriert werden.
Darauf begann die KSZE, mit dem Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, dem Kommissar für Minderheiten und dem Beauftragten für die Freiheit der Medien zusätzliche Organe zu schaffen. Angesichts dieser Institutionalisierung beschlossen die Staats- und Regierungschefs am Gipfeltreffen von 1994 in Budapest, die Konferenz (KSZE) in Organisation (OSZE) umzubenennen. Allerdings erfolgte das ohne völkerrechtlichen Vertrag, weshalb die OSZE noch heute keine Rechtspersönlichkeit besitzt und deshalb für einige Juristen nicht als internationale Organisation im klassischen Sinne zu betrachten ist.
Trotzdem konnte sich die Organisation in den 1990er Jahren mit wenig Bürokratie recht wirksam entfalten. Im Forum für Sicherheitskooperation wurden bedeutende Vereinbarungen über vertrauensbildende Massnahmen vereinbart (z.B. das Recht auf gegenseitige Inspektionen militärischer Manöver). Der Vertrag über konventionelle Streitkräfte legte Höchstgrenzen für Offensivwaffen fest, worauf etwa 50'000 solcher Waffen (Panzer, Artilleriegeräte, Flugzeuge und Hubschrauber) unter gegenseitiger Kontrolle verschrottet wurden. Das Warschauer Büro für demokratischen Institutionen überwachte Wahlen nicht nur in Osteuropa, sondern auch in westlichen Demokratien. In Konfliktregionen, bei denen es häufig um Minderheitenprobleme ging, wurden insgesamt 17 Langzeitmissionen stationiert, die bis zu zwei Drittel des Budgets der Organisation absorbierten.
Doch zu Beginn des neuen Jahrhunderts begann sich das gegenseitige Einvernehmen abzuschwächen. Russland war unglücklich über die Osterweiterung der NATO, während der Westen den Krieg zwischen Georgien und Russland (2008) sorgenvoll verfolgte. Den Höhepunkt erreichten die Spannungen, als Russland 2014 die Krim annektierte und unter der Hand die Rebellen in der Ostukraine unterstützte. Immerhin stimmte Moskau der Entsendung einer OSZE-Beobachtermission in die Ukraine zu und nimmt an den Verhandlungen über die Ukraine teil, die in unter der Schirmherrschaft der OSZE in Minsk geführt werden. Das ist insofern bemerkenswert, als Beschlüsse in der OSZE nur im Konsensverfahren gefällt werden. Anderseits hat Russland 2015 den Vertrag über konventionelle Streitkräfte gekündigt, was für die Organisation einen herben Rückschlag bedeutet. Moskau begründete den Schritt damit, dass das bei der Wiedervereinigung Deutschlands abgegebene Versprechen, die NATO würde weder Truppen noch Kriegsmaterial nach Osten verschieben, gebrochen worden sei.
Die Nordatlantikpakt-Organisation (North Atlantic Treaty Organization-NATO) wurde 1949 in Washington gegründet. Die Initiative ging weniger von den USA als den westeuropäischen Staaten aus. Diese wurden sich nach dem Staatsstreich von 1948 in Prag bewusst, dass sie mit eigenen Mittel den sowjetischen Expansionsgelüsten nicht gewachsen waren. Dem Wunsch für ein verstärktes Engagement der Amerikaner konnte die Regierung in Washington erst entsprechen, nachdem sie vom Senat mit der Vandenberg-Resolution ermächtigt worden war, militärische Beistandsverpflichtungen auch in Friedenszeiten einzugehen.
Ausdrücklich berief sich der Grünungsvertrag, dem neben den USA und Kanada zwölf westeuropäische Staaten[7] beitraten, auf Art. 51 der UNO-Charta, der das kollektive Selbstverteidigungsrecht vorgesehen hatte. Die zentrale Verpflichtung des NATO-Paktes lautet demnach, dass im Falle eines bewaffneten Angriffs auf ein Mitglied ihm alle anderen zu Hilfe kommen müssen (Art.5). Wie das zu erfolgen hat, wurde im Vertrag nicht im Detail geregelt. Als die NATO unter amerikanischem Kommando integrierte Streitkräfte aufzubauen begann, war klar, dass militärische Mittel im Vordergrund standen. Nachdem sich das Ziel von 95 einsatzbereiten Divisionen als zu kostspielig erwies, ergänzten die Amerikaner das Verteidigungsdispositiv mit in Europa stationierten Nuklearwaffen. Die Eisenhower-Administration setzte dabei auf massive Vergeltung (Mutually Assured Destruction – MAD), unter Präsident Kennedy wechselte man zur Strategie der flexiblen Erwiderung.
Nach der Wende von 1989/1990 fiel der Warschauer-Pakt auseinander und mehrere ehemalige Sowjet-Satelliten äusserten Interesse an einen Beitritt zur NATO. Das Bündnis reagierte vorsichtig und setzte 1991 einen Kooperationsrat ein, um den Sicherheitsbedürfnissen der osteuropäischen Länder entgegen zu kommen. Selbst mit Russland versucht man, ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, indem 1992 der NATO-Russland Rat geschaffen wurde. Russland beteiligte sich 1993 ebenfalls an der Partnerschaft für den Frieden, bei der auch Länder, die keinen NATO-Beitritt beabsichtigen, sich an friedenserhaltenden Operationen der NATO beteiligen können. Doch kam es mit Moskau bald zu Spannungen, als die NATO 1999 Polen, Ungarn und Tschechien aufnahm. 2002 folgte die zweite Erweiterungsrunde, in der die Mitgliedschaft auf sieben weitere osteuropäische Länder ausgedehnt wurde (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien). Mit der Aufnahme von Albanien, Kroatien und Montenegro ist die Zahl der NATO-Mitglieder auf 29 gestiegen.
Die Spannungen mit Russland hatten sich bereits verstärkt sich, als die NATO 1999 ohne Ermächtigung des UNO-Sicherheitsrates in Kosovo eingriff. Aus dem gleichen Grunde kritisierte Russland den 2003 von den USA angeführten Krieg im Irak. Im libyschen Bürgerkrieg verhängte der UNO-Sicherheitsrat 2011 zum Schutz der Zivilbevölkerung eine Flugverbotszone. Bei der Abstimmung hatten sich Russland und China enthalten, bemängelten aber rasch, dass die Intervention, an der sich neben NATO-Mitgliedern auch einige arabische Staaten beteiligten, über das in New York vereinbarte Mandat hinausgegangen sei, weil die Intervention vor allem einen Regimewechsel beabsichtigt habe.
Nachdem die USA und eine Reihe ihrer Verbündeten 2014 mit Luftangriffen gegen den Islamischen Staat vorgingen, griff Russland 2015 in den syrischen Bürgerkrieg ein, um das dortige Regime im Kampf gegen «alle Terroristen» zu unterstützen. Ende 2017 wurde der islamische Staat weitgehend besiegt. Beteiligt daran war eine von den USA angeführte Koalition, in Syrien aber auch das gemeinsame Vorgehen von Moskau und Damaskus. Die UNO setzt ihre Friedensbemühungen fort, gleichzeitig verhandelt Russland mit der Türkei, Iran und Syrien über eine Nachkriegsordnung. Offen ist vorläufig, wie sich Trump an der künftigen Gestaltung Syriens beteiligen kann oder will.
Art. 5 des Nordatlantikpaktes wurde zum ersten Mal angerufen, nachdem Flugzeugentführer von Al-Kaida am 11. September 2001 in New York und Washington mehr als 3'000 Tote verursacht hatten. Auf Grund des Selbstverteidigungsrechtes ermächtige der Sicherheitsrat ein militärisches Eingreifen der NATO in Afghanistan. Zeitweise waren dort über 130'000 Soldaten im Einsatz, die nicht nur die Al-Kaida und die Taliban bekämpften, sondern auch demokratische Strukturen aufzubauen versuchten. Nach 13 Jahren begann die Allianz die meisten ihrer Kämpfer abzuziehen und liess nur noch militärische Berater zurück, obwohl die Lage in Afghanistan nach wie vor prekär geblieben ist.
Die Europäische Freihandelsassoziation (European Free Trade Association-EFTA) entstand 1960 als Alternative zur Europäischen Gemeinschaft. Sie wurde von Dänemark, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz und des Vereinigten Königreichs gegründet. Später kamen Finnland, Island und Liechtenstein hinzu. Es handelte sich um Staaten, die sich nicht den politischen Zielsetzungen der EWG/EU anschliessen wollten. Sie vereinbarten eine Freihandelszone für verarbeitete Produkte, bei denen die Zölle innert zehn Jahren völlig abgebaut wurden. Da es keinen gemeinsamen Aussenzoll gibt, bleiben Verhandlungen gegenüber Drittstaaten in der Kompetenz jedes einzelnen Mitgliedstaates. Bereits 1973 verliessen das Vereinigte Königreich und Dänemark die EFTA und traten der Europäischen Gemeinschaft bei. Den gleichen Schritt vollzogen 1986 Portugal sowie 1993 die neutralen Staaten Österreich, Finnland und Schweden. Damit verblieben nur noch vier Mitglieder in der EFTA, von denen sich drei (Norwegen, Island und Liechtenstein) 1993 dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) anschlossen, um sich den Zugang zum EU-Binnenmarkt zu verschaffen. Von der Schweiz wurde der Beitritt zum EWR in einer Volksabstimmung abgelehnt, worauf das Land sich über bilaterale Verträge so weit als möglich in den EU-Binnenmarkt zu integrieren suchte. Mit Drittstaaten verhandelt die kleine Rest-EFTA heute vermehrt gemeinsam über Freihandelsverträge, obwohl die externe Handelspolitik nach wie vor in den Händen jedes einzelnen Mitgliedstaates liegt. Welche Folgen der Brexit für die EFTA haben wird, ist erst nach dem Abschluss der Verhandlungen zwischen London und Brüssel zu beurteilen.
Nach mehreren Abkommen unter ehemaligen Republiken der Sowjetunion über Freihandel und Zollunionen kam es 2015 zwischen Russland, Weissrussland und Kasachstan zur Gründung der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaf (Eurasian Economic Union). Ähnlich wie die EU verfolgt sie das Ziel, neben dem Handel mit Waren auch den freien Austausch von Dienstleistungen, Kapital und Personen zu verwirklichen. In bestimmten Bereichen soll ebenfalls die Wirtschaftspolitik koordiniert werden. Trotz dem aktivem Werben Moskaus für Neumitglieder sind bisher nur Armenien und Kirgisistan hinzugekommen. Die Ukraine, auf deren Beitritt Moskau zählte, hat sich nach dem Maidan-Aufstand dem Westen zugewandt. Einziger Beitrittskandidat zur Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft ist zurzeit Tadschikistan. Die Übermacht Russlands in der Gemeinschaft macht kleinere Staaten eher skeptisch, weil sie dahinter hegemonistische Ambitionen befürchten.
Die Europäische Investitionsbank (European Investment Bank-EIB) wurde 1958 auf Initiative des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle gleichzeitig mit den Römer-Verträgen ins Leben gerufen. Ihre Kapitaleigner sind die EU-Mitgliedstaaten, sie operiert wie andere intergouvernementale Banken. In erster Linie besteht ihr Mandat darin, die Kohäsion unter den Mitgliedstaaten zu fördern. Dafür nimmt sie auf den internationalen Kapitalmärkten Anleihen auf und gewährt Kredite in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Innovation, Umwelt und zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen. Die EIB verfügt heute über ein Kapital von 250 Mrd. EUR, ihre Kreditvergabe ist mit ca. 80 Mrd. EUR pro Jahr etwas grösser als jene der Weltbank. Zu 90% profitieren davon weiterhin schwächere Mitgliedstaaten, 10 Prozent werden aber mittlerweile auch für Projekte in Drittländern eingesetzt. Damit unterstützt die Bank die Nachbarschafts- und Entwicklungspolitik der Union, obwohl sie von Weisungen der EU-Institutionen unabhängig bleibt.
Die Europäische Investitionsbank ist zusammen mit der EU-Kommission ebenfalls Mitglied der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD), an der weitere 64 Staaten beteiligt sind. Die Idee der Bank entstand 1991 und wurde ebenfalls von einem Franzosen – Präsident François Mitterand – angestossen. Nach dem Zusammenbruch des Sowjetsystems erhielt sie die Aufgabe, in den mittel- und osteuropäischen Staaten den Übergang zur Marktwirtschaft zu unterstützen. Sie verfügt über ein Grundkapital von 30 Mrd. Euro, das von den Mitgliedern je nach ihrer Wirtschaftsgrösse beigetragen wird. Seit ihrem Bestehen hat die Bank für fast 100 Mrd. Euro Kredite und Bürgschaften vergeben. Die Mittel gehen vor allem an private Unternehmen, werden aber auch zur Restrukturierung und Privatisierung staatlicher Firmen und zur Verbesserung kommunaler Dienstleistungen eingesetzt. Die Bank fördert ausserdem kleinere und mittlerer Unternehmen und wickelt die entsprechenden Mittel meistens über lokale Finanzinstitute ab. Seit dem arabischen Frühling ist die EBRD in Ländern wie Ägypten, Tunesien, Marokko und Jordanien tätig geworden. Sie hat gemäss Gründungsvertrag darauf zu achten, dass marktwirtschaftliche Öffnung von Fortschritten bei der Demokratisierung und der Rechtsstaatlichkeit begleitet wird. Deshalb hat sie sich bisher in Weissrussland, Usbekistan und Tadschikistan nur marginal engagiert. Nachdem die osteuropäischen Neu-Mitglieder der EU mehr Kohäsionsgelder aus Brüssel erhielten, ging fast ein Drittel der jährlich vergebenen Finanzmittel der EBRD an Russland. Seit der Annexion der Krim hat die Bank aber bis auf weiteres die Zusammenarbeit mit Moskau sistiert.
Amerika
Die Organisation Amerikanischer Staaten (Organization of American States-OAS) wurde 1948 in Bogota gegründet. Ihre Wurzeln gehen jedoch weiter zurück. Nach der Unabhängigkeit wollte der venezolanische Freiheitsheld Simon Bolivar alle früheren Kolonien Lateinamerikas in einen Staatenbund vereinigen. Sein Plan scheiterte an den lokalen «caudillos», die sich an ihre Macht klammerten. Als in den USA nach dem Sezessionskrieg eine rasche Industrialisierung einsetzte, schlug Präsident Benjamin Harrison die Einberufung einer panamerikanischen Konferenz vor. Er hoffte, mit den lateinamerikanischen Staaten eine Zollunion zu errichten und eine obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit zu vereinbaren. Beide Postulate wurden an der Konferenz von 1989 in Washington abgelehnt. Die rückständigen Partner des Südens sahen in der Zollunion wenig Vorteile, befürchteten zudem, dass mit der obligatorischen Gerichtsbarkeit ihre Souveränität eingeschränkt werden könnte. Washington musste sich mit der Errichtung eines ständigen Sekretariats zufriedengeben, das Statistiken über den Handel sammeln und periodische Folgekonferenzen vorbereiten sollte. Acht solche Konferenzen fanden zwischen 1889 und dem Beginn des zweiten Weltkrieges statt. An jener von 1929 einigte man sich auf ein obligatorisches Vergleichsverfahren und eine subsidiäre Schiedsgerichtsbarkeit, von denen aber beide wenig Wirksamkeit entfalteten.
Nach Ende des zweiten Weltkrieges ging es den USA vor allem darum, die südlichen Nachbarn in den Kampf gegen den Kommunismus einzubinden. Deshalb vereinbarte man 1947 in Rio de Janeiro den « Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca» (TIAR), der bei Aggressionen gegenseitige Hilfe versprach, ohne dass eine Integration militärischer Streitkräfte vorgesehen war.
An der neunten Konferenz der panamerikanischen Union beschloss man 1949 in Bogota, die Organisation der Amerikanischen Staaten zu gründen, der alle damals unabhängigen Länder Südamerikas beitraten. Als wichtigste Ziele legte man die Achtung der Demokratie, die Förderung der Menschenrechte, die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, die gemeinsame Bekämpfung der internationalen Kriminalität und des Drogenhandels sowie die Errichtung einer panamerikanischen Freihandelszone fest.
Was die Demokratie betrifft, gingen die USA als weitaus wichtigstes Mitglied nicht immer vorbildlich voran. Nach der Machtübernahme Fidel Castros wurde Kuba für ein halbes Jahrhundert von den Tätigkeiten der OAS ausgeschlossen. Dagegen unterstützte Washington Militärregierungen in Chile, Argentinien und Brasilien. Doch verabschiedete man 2001 die interamerikanische Demokratiecharta, die dazu führte, dass nach dem Putsch von 2009 gegen Honduras Präsidenten Manuel Zelaya die Teilnahmerechte des Landes suspendiert wurden. Auf der geplagten Insel Haiti haben lateinamerikanische Staaten eng mit der UNO zusammengearbeitet. Die OAS beobachtete nicht nur Wahlen, sondern musste wiederholt vermitteln, dass solche überhaupt stattfanden.
Erfolgreicher fällt die Bilanz auf dem Gebiet der Menschenrechte aus. Die bereits 1948 verabschiedete Erklärung der Rechte und Pflichten wurde 1969 in ein verbindliches Abkommen übergeführt. Schon 1959 schuf man eine Kommission für Menschenrechte, 1979 wurde sie durch einen Gerichtshof ergänzt. Bei der Kommission dürfen auch Individuen Klagen einreichen, werden diese von der Kommission an den Gerichtshof weitergeleitet, sind aber nur mehr Staaten zur Teilnahme berechtigt.
Gleichzeitig mit der Gründung der OAS kam es 1948 zum Bogota-Pakt über die friedliche Beilegung von Streitigkeiten. Er sah vor, dass Vertragsparteien, die einen Konflikt nicht auf diplomatischem Wege oder mit Vermittlung von Dritten lösen können, automatisch die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag anzuerkennen hätten. Der Vertrag mit dieser einzigartigen Klausel ist aber nie von allen Mitgliedern der OAS ratifiziert worden. Heute gehören ihm noch 14 südamerikanische Staaten an, nachdem in den letzten Jahren El Salvador, Honduras und Kolumbien das Abkommen gekündigt haben.
Bei der Drogenbekämpfung haben stets die USA die führende Rolle gespielt. Seit Präsident Nixon 1973 den Krieg gegen Drogen ausrief, hat Washington Milliarden von Dollars ausgegeben, um die Anbauzonen im Andengebiet zu zerstören. Die Bemühungen waren wenig erfolgreich, vielmehr haben sie zur Ausbreitung der grenzüberschreitenden Kriminalität beigetragen. Diese ist so stark geworden, dass mit Schmiergeldern und Waffengewalt staatliche Behörden ständig unter Druck gesetzt werden. Deshalb plädieren nun mehrere Länder in Südamerika, dass man in der OAS zu einem Konsens kommt, um einen neuen Ansatz für die Drogenpolitik zu finden. Viele denken an das Beispiel Uruguays, das 2013 leichte Drogen legalisiert hat.
Nach dem 2. Weltkrieg hofften lateinamerikanische Länder, die sich auf die Seite der Alliierten gestellt hatten, von Washington ebenfalls eine Art Marschall-Plan zu erhalten. Als dieser nicht eintraf, setzten mehrere von ihnen auf eine Industrialisierung durch Importsubstitution. Raul Prebisch plädierte als geistiger Vater des Modells, dass eine solche Politik nicht innerhalb jedes Landes, sondern zusammen mit benachbarten Ländern realisiert werden sollte. Unter seinem Einfluss kam es rasch zu einer Reihe von Abkommen regionaler Integration. So wurde 1960 in Montevideo die lateinamerikanische Freihandelszone gegründet (Associacion Latinoamericana de Libre Commercio-ALLC), der sich Argentinien, Uruguay, Brasilien, Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Venezuela und Mexiko anschlossen. Im gleichen Jahr vereinbarten die zentralamerikanischen Länder Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua, schrittweise einen gemeinsamen Markt aufzubauen (Mercado Comun de Centro America- MCCA). Weil Kolumbien, Ecuador, Bolivien, Peru und Chile die ALLC als zu schwach empfanden, schlossen sie sich 1969 im Andenpakt (« Pacto Andino ») zusammen, der sich eine Zollunion zum Ziele setzte. Venezuela trat 1974 dem Andenpakt bei, während Chile 1976 unter der Diktatur von Pinochet wieder austrat.
Panama ergriff 1975 die Initiative für die Gründung des Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems (Sistema Economico Latinoamericano-SELA), das nicht nur die lateinamerikanischen, sondern auch die inzwischen unabhängig gewordenen Staaten der Karibik umfasste. Allerdings handelte es sich mehr um einen «think tank», der gemeinsame Positionen für internationale Wirtschaftsverhandlungen vorbereiten sollte.
Alle Zusammenschlüsse litten häufig unter politischen Turbulenzen. Als die Militärdiktaturen in Chile, Argentinien, Uruguay und Brasilien eine stark liberal ausgerichtete Wirtschaftspolitik verfolgten, wurde die Lateinamerikanische Freihandelszone (ALLC) in die « Associacion Latinoamericana de Integracion » (ALADI) zurückgestuft, der bloss die Aufgabe zukam, bilaterale oder subregionale Handelsabkommen zu fördern.
In den 1980er Jahren gerieten viele lateinamerikanische Länder in eine Schuldenkrise. Um von den internationalen Finanzinstitutionen Kredite zu erhalten, mussten sie sich dem Konsens von Washington beugen, mit dem unter anderem die Liberalisierung des Aussenhandels und des Kapitalverkehrs gefordert wurde. Für das Wachstum hatte das neoliberale «Credo» ein verlorenes Jahrzehnt zur Folge. Doch wurde damit unter den lateinamerikanischen Regierungen das Bewusstsein gefördert, dass sich das Modell der Importsubstitution erschöpft hatte. Das führte zu einem Paradigma-Wechsel in der Integrationspolitik, die früher praktizierte Abschottung wurde nun durch eine Öffnung gegenüber den globalen Märkten abgelöst.
Im Sinne des neuen Ansatzes gründeten 1991 Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay den » Mercosur «. Dessen Ziel war eine Zollunion, die noch heute nicht vollständig ist, der regionale und internationale Handel konnte aber erheblich gesteigert werden. In einem gesonderten Protokoll vereinbarten die vier Länder, die lange unter Militärdiktaturen gelitten hatten, dass nur demokratisch regierte Länder als neue Mitglieder aufgenommen würden. Nach dem Friedensprozess wurde in Zentralamerika 1991 der MCCA revidiert und zum » Sistema de la Integracion Centroamaricana - SICA « umgewandelt, womit man sich ebenfalls nach aussen öffnen und demokratische Institutionen fördern wollte. Noch weiter gingen die Andenländer, die ihren Pakt 1996 mit der » Comunidad Andina « ersetzten, um ihren Integrationsprozess nach dem Vorbild der Europäischen Union voranzutreiben.
Die karibischen Staaten, die erst zwischen 1960 und 1980 ihre Unabhängigkeit erlangten, schufen eine Freihandelszone und bauten diese schrittweise zu einer Zollunion aus. Im Jahre 2001 gründeten 15 von ihnen die karibische Gemeinschaft (« Caribbean Community and Common Market – CARICOM »), in der sie neben wirtschaftlichen Zielen (Errichtung eines Binnenmarktes) auch eine verstärkte Zusammenarbeit in Bereichen wie Aussenpolitik, Gesundheitswesen, Bildung und Wissenschaft erreichen wollen. Dazu gehört die in Etappen angestrebte Personenfreizügigkeit sowie die Einführung eines einheitlichen Reisepasses. Acht ostkaribische Kleinstaaten verständigten sich 1976 auf eine gemeinsame Währung, die an den Dollar gebunden wurde. Als sie 1981 mit der Organisation ostkaribischer Staaten (Organisation of Eastern Caribbean States – OECS) weiter zusammenrückten, wurde 1983 die einheitliche Währung unter die Aufsicht einer gemeinsamen Zentralbank gestellt.
Obwohl die Politik der regionalen Öffnung in den 1990er Jahren erfolgreich war, ging der Schwung in der folgenden Dekade stark zurück. Verantwortlich dafür waren einmal mehr politische Faktoren. Wegen massiver Ungleichheiten kamen vielerorts linksgerichtete Regierungen an die Macht. Mehrere von ihnen waren sozialdemokratisch ausgerichtet, die an einer offenen Wirtschaftspolitik festhielten, um den Kuchen vor der Verteilung zu vergrössern. Mit ähnlichen Parolen wurde 1999 in Venezuela der ehemalige Militärputschist Hugo Chavez zum Präsidenten gewählt. Nach einem sanften Beginn verwandelte er sich zu einem glühenden Anhänger der kubanischen Revolution, der unermüdlich gegen den amerikanischen Imperialismus wetterte. Rasch wurde Chavez zu einem entschiedenen Gegner der von George Bush Senior lancierten Idee, den nordamerikanischen Freihandelsvertrag zwischen Kanada, USA und Mexiko auf den südamerikanischen Kontinent auszudehnen. Dessen Nachfolger Bill Clinton und George W. Bush Junior hielten an dem Vorhaben fest (« Aerea de Libre Comercio de las Americas-ALCA »). Zehn Jahre später wurden die harzigen Verhandlungen in Mar del Plata abgebrochen. Verantwortlich dafür war allerdings nicht nur Venezuela, auch grosse Agrarexporteure des Südens hielten die Konzessionen der USA als ungenügend.
Am meisten freute sich jedoch Chavez über den Misserfolg, denn er hatte schon ein Jahr vorher das alternative Projekt der « Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America – ALBA » aufs Tapet gebracht und dafür umgehend Kuba als Mitglied gewonnen. Bald kamen Bolivien, Nicaragua, Ecuador und Honduras hinzu, da Chavez grosszügig Geschenke verteilte. Als er 2005 mit « Petrocaribe» verbilligtes Erdöl nach karibischen Staaten zu liefern begann, wurden sechs von ihnen ebenfalls Mitglied von ALBA. Das Credo von Chavez lautete, Handelsbeziehungen seien nicht markwirtschaftlich, sondern im Sinne von Solidarität und gegenseitiger Ergänzung zu gestalten. Deshalb trat er ein Jahr später aus der Andengemeinschaft aus, weil Kolumbien und Peru bilaterale Freihandelsverträge mit den USA abgeschlossen hatten. Darauf bewarb er sich um die Mitgliedschaft im Mercosur, was er erreichte, obwohl einige der ursprünglichen Mitglieder lange zögerten. Damit hatte er einen Fuss in allen wichtigen Wirtschaftsorganisationen des Kontinents gesetzt (mit Ecuador und Bolivien in der Andengemeinschaft, mit Nicaragua und Honduras in der zentralamerikanischen SICA und über Petrocaribe mit Caricom). 2009 gelang es ihm auch noch, sieben Staaten aus der Region für seine Idee des « Banco del Sur » zu gewinnen, mit dem er die Unabhängigkeit Südamerikas vom IWF und der Weltbank erreichen wollte.
Als 2008 die Union Südamerikanischer Staaten (Union de Naciones Suramericanas – UNASUR) gegründet wurde, geriet die ursprüngliche von Brasilien lancierte Idee einer Freihandelszone zwischen Mercosur und der Andengemeinschaft in den Hintergrund. UNASUR hat zwar weitgehende Integrationsziele, vorläufig dominieren jedoch politische Themen. So versucht die Organisation, der alle südamerikanischen Staaten beigetreten sind, vor allem bei politischen Krisen zwischen Mitgliedstaaten zu vermitteln und organisiert Wahlbeobachtungsmissionen.
Da Chavez hinter dem Sturz seines Freundes Manuel Zelaya in Honduras den amerikanischen Geheimdienst vermutete, lancierte er zudem die Gründung der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten (« Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribenos – CELAC »), mit der er die OAS ersetzen wollte. Zwar sind alle Staaten Lateinamerikas und der Karibik der CELAC beigetreten, doch viele von ihnen wollen von der Abschaffung der OAS nichts wissen, weil sie diese als Stütze demokratischer Institutionen betrachten. Hugo Chavez verstarb 2013 im Amt, sein Nachfolger Nicolas Maduro ist wegen sinkender Erdölpreise in eine schwere Wirtschaftskrise geraten, womit Venezuelas Führungsrolle auf dem Kontinent verblasst ist.
Bei Wahlen auf dem südlichen Kontinent kommen wieder mehr marktfreundliche Kräfte an die Macht. Die Kritik am IWF ist zurückgegangen, die Weltbank investiert jährlich 6 Mrd. USD in der Region. Von der Interamerikanische Entwicklungsbank, bei der die USA den höchsten Kapitalanteil gezeichnet hat, fliessen pro Jahr 12 Mrd. USD in die südliche Hemisphäre, womit sie als multilaterale Geldgeber an erster Stelle liegt.
Obwohl Lateinamerika kulturell recht homogen ist, aber nach wie vor mit grossen Wohlstandsgefällen zu kämpfen hat, weist es eine übertriebene Dichte regionaler Organisationen auf. Deren Aufgaben und Mitglieder überschneiden sich häufig, bei keiner ist es bisher zu supranationalen Kompetenzen gekommen, auch wenn dieses Ziel schon seit langem in mehreren Gründungsverträgen proklamiert worden ist.
Afrika
Als die afrikanischen Kolonien Ende der 1950er Jahre ihre Unabhängigkeit erlangten, setzte eine Diskussion ein, auf welche Art die künftigen Beziehungen untereinander zu gestalten seien. Dabei kam es zu ähnlichen Überlegungen wie vor mehr als hundert Jahren bei den lateinamerikanischen Ländern. Kwame Nkrumah, der 1958 Ghana als erstes schwarzafrikanisches Land in die Unabhängigkeit geführt hatte, war ein Vordenker des Panafrikanismus und plädierte für einen engen Zusammenschluss aller afrikanischen Staaten. Ihm schwebte ein föderaler Gesamtstaat nach dem Vorbild der USA vor («African United States»). Julius Nyerere, der Freiheitskämpfer in Tansania, stand der Idee skeptisch gegenüber und meinte, es brauche zwar Zusammenarbeit, zunächst müssten sich aber die jeweiligen Staaten selber konsolidieren und ihre Wirtschaftssysteme festigen.
Nyereres Ansicht obsiegte, als 30 der 32 inzwischen unabhängig gewordenen Staaten 1963 in Addis Abeba die Organisation der Afrikanischen Union (Organization of African Unity- OAU) gründeten. Ihr traten danach alle afrikanischen Staaten bei, einzig Marokko verliess 1986 die Organisation, nachdem die Westsahara als Vollmitglied aufgenommen worden war[8]. Die Gründungsakte der Organisation enthielt ein sehr breites Mandat. Sie sollte in Solidarität eine enge politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit fördern und die regionale Integration voranbringen. Doch blieb die OAU eine intergouvernementale Institution, in der keine supranationalen Mechanismen vorgesehen waren. Sie betonte die Souveränität der einzelnen Mitgliedstaaten, das Prinzip der Nichteinmischung in interne Angelegenheiten sowie die Anerkennung der aus der Kolonialzeit stammenden Grenzen. Als Folge davon musste die OAU zahlreichen Bürgerkriegen und Terrorregimen tatenlos zusehen. Auch die wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents erhielt von der OAU kaum Impulse.
Vermehrt geriet die OAU nach dem Ende des Kalten Krieges selbst unter den eigenen Mitgliedern auf Kritik. Das Klima der Frustration nützte der libysche Staatschef Gaddafi am Gipfeltreffen von 1999 in Sirte aus, um seine afrikanischen Kollegen mit dem Vorschlag zu überraschen, auf die Idee Nkrumahs für die Bildung eines gesamtafrikanischen Staates zurückzukommen. Den verdutzten Staatschefs fiel es nicht einfach, Gaddafi offen zu widersprechen, weil der libysche Revolutionsführer damals mehr als ein Drittel des OUA-Budgets finanzierte. Doch über Nacht arbeiteten ihre wichtigsten Vertreter einen Plan für die Revitalisierung der Organisation aus. Dieser orientierte sich an der Europäischen Union, auch wenn der 2002 in Kraft getretene Vertrag, mit dem die Afrikanischen Union (African Union – AU) entstand, klar hinter dem angestrebten Vorbild zurückblieb.
Zumindest organisatorisch liess man sich jedoch von Brüssel inspirieren. An der Spitze der AU stehen die jährlichen Treffen der Staats- und Regierungschefs («Assembly of the Union»), bei denen im Konsensverfahren entschieden wird. Deren Beschlüsse werden vom geschäftsführende Rat («Executive Council») vorbereitet, in dem bei fehlendem Konsens auch mit Mehrheit (one country-one vote) abgestimmt werden kann. Auf dritter Stufe schafft dem Rat das Komitee der ständigen Vertreter zu («Permanent Representative Committee»). Für die Umsetzung von Entscheiden ist die Kommission mit einem Präsidenten zuständig, der von den Staats- und Regierungschefs einstimmig ernannt wird. Die 230 Mitglieder des Parlaments («Pan-African Parliament») haben nur eine beratende Stimme und werden weiterhin von den nationalen Parlamenten ernannt. Der Gerichtshof besteht aus zwei Kammern, von denen die eine für die Interpretation des AU-Rechtes zuständig ist, die andere den früheren Gerichtshof für Menschenrechte übernommen hat. Letzterer kann über Individualklagen nur befinden, wenn dies von den jeweiligen Staaten anerkannt worden ist. Ausserdem gibt es als beratende Organe einen Wirtschafts- und Sozialrat, einen Rat der Finanzinstitutionen sowie einen Rat für Frieden und Sicherheit.
Art. 4 des Grundvertrages sieht vor, dass die AU im Falle schwerster Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid humanitäre Interventionen beschliessen kann. Dies verabschiedeten die afrikanischen Staaten noch bevor sich die UNO-Generalversammlung 2005 auf das Prinzip der Schutzverantwortung («responsability to protect») verständigte. Mit Unterstützung der UNO und der EU bemüht sich die AU, eine Reserve rasch einsetzbarer Truppen aufzubauen. Zu ersten Operationen ist es in Burundi, Somalia, Sudan und der Zentralafrikanischen Republik gekommen.
Ferner verpflichtet die AU-Charta ihre Mitglieder auf die Förderung von Demokratie. Bei gewalttätigen Umstürzen von demokratisch gewählten Regierungen soll die Mitgliedschaft suspendiert werden. Das erfolgte bisher bei Mauretanien, Guinea, Madagaskar und Niger. Auch die Elfenbeinküste wurde zeitweise von den Beratungen ausgeschlossen, als der frühere Machthaber Laurent Gabo das Wahlergebnis nicht anerkennen wollte. Dagegen reagierte die AU im Falle des libyschen Bürgerkrieges zurückhaltend und plädierte bloss für eine friedliche Lösung, da Gaddafi immer noch der grösste Geldgeber war. Die von den Militärs erzwungene Demission von Präsident Mugabe konnte dagegen als vertragskonform gewertet werden. In mehreren Ländern bestehen jedoch weiterhin Verhältnisse, die einem konsequentem Demokratieverständnis nicht entsprechen.
Bald nach der Unabhängigkeit entstanden in Afrika über 20 regionale Organisationen für die wirtschaftliche Integration. Mehrheitlich bildeten sie sich unter benachbarten Ländern, deren Grenzen von den in Afrika besonders zahlreichen Kolonialmächten gezogen worden waren. Neben britischen und französischen gab es spanische, portugiesische, belgische, italienische, deutsche und südafrikanische Kolonien. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit erschien als logische Folge des kolonialen Erbes. Dafür plädierte namentlich die 1958 gegründete UNO-Wirtschaftskommission für Afrika.
Alle diese Organisationen bekannten sich in ihren Gründungsakten zu ehrgeizigen Zielen. Über Freihandelszonen wollte man möglichst rasch zu Zollunionen und zu gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsräumen kommen. Doch die von den Kolonialherrschern hinterlassenen Wirtschaftsstrukturen waren wenig komplementär, auch vermochte sich der intraregionale Handel wegen fehlender Infrastruktur nicht zu entwickeln. Die Hoffnung der meisten regionalen Wirtschaftsorganisationen war deshalb, gemeinsam mehr ausländische Hilfe zu erhalten. Geld floss namentlich von der EU, zu der mit Ausnahme Südafrikas alle ehemaligen Kolonialherrscher gehörten. Doch führte das kaum zu einer nennenswerten Diversifizierung der lokalen Wirtschaften. Schuld daran war nicht nur der europäische Agrarprotektionismus, sondern auch die mangelnde Effizienz lokaler Regierungseliten.
Moderaten Erfolg hatten einige Projekte für die Nutzung von grenzüberschreitenden Flüssen und Seen. Gemeinsame Währungen entstanden unter ehemaligen französischen Kolonien, die jedoch wegen der Abhängigkeit von Paris vermehrt unter Druck geraten.
Die meisten Staaten beteiligten sich an mehreren Organisationen. Bloss 6 Staaten gehören nur einer Organisation an, 26 Staaten sind an zwei, 20 an drei, Kenia sogar an vier Organisationen beteiligt. Solche Mehrfachmitgliedschaften sind nicht nur kostspielig, sondern erschweren auch die Entscheidungsprozesse. Fazit ist, dass der intraregionale Handel kaum 10% der Gesamtausfuhren beträgt, die ihrerseits nur 3% der weltweiten Exporte ausmachen.
Die Verzettelung subregionaler Integrationsbemühungen sind nicht nur von ausländischen Geldgebern kritisiert worden. Als sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die markwirtschaftliche Globalisierung verstärkte, stieg auch unter afrikanischen Führern das Bewusstsein, dass man zu einem neuen Ansatz kommen müsse. 1991 wurde in Abuja die « African Economic Community » gegründet, die 1994 in Kraft trat. Ziel war, alle Staaten Afrikas in eine einzige Wirtschaftsgemeinschaft zusammenzuführen. Das sollte zwar graduell, aber nach einem festen Zeitplan erfolgen:
a) 1999 bestehende regionale Wirtschaftsorganisationen (Regional Economic Communities - REC) stärken;
b) 2007 Koordination und Harmonisierung innerhalb der REC voranbringen;
c) 2017 in allen REC Freihandelszonen und Zollunionen verwirklichen;
d) 2019 Zölle zwischen den einzelnen REC harmonisieren, um zu einer kontinentalen Zollunion zu kommen;
e) 2023 Bildung eines gemeinsamen Marktes, Abstimmung der Währungspolitik und freier Personenverkehr;
f) 2028 Konsolidierung des gemeinsamen Marktes, Verwirklichung einer Wirtschaftsunion und Einführung einer gemeinsamen Währung.
Der Abuja-Vertrag ist 2002 in die Afrikanische Union integriert worden. Damit wurden von den 16 Regionalorganisationen, die damals noch bestanden, nur 8 als eigentliche «Bausteine» für den erstrebten Aufbau eines kontinentalen Wirtschaftsraumes anerkannt:
1) « The East African Community-EAC », die 1967 von Kenia, Uganda und Tansania gegründet worden war. Die drei Länder hatten schon unter der Kolonialherrschaft ihre Wirtschaftsbeziehungen institutionalisiert. Nach zehn Jahren fiel die Organisation wegen der Diktatur von Idi Amin auseinander. Nach jahrelangen Bemühungen erfolgte 1999 ein Neustart mit einer Freihandelszone, die schon 2004 zu einer Zollunion führte. 2007 kamen Rwanda und Burundi hinzu. Die EAC ist auf dem Wege zu einer Wirtschaftsgemeinschaft, in der Waren, Kapital und sukzessive auch Personen (mit einem gemeinsamen Pass) frei zirkulieren sollen. Verglichen mit anderen Regionalorganisationen hat sie die kleinste Mitgliederzahl, ist aber wirtschaftlich am stärksten integriert, was auch institutionell zum Ausdruck kommt. Ihre parlamentarische Versammlung ist als einzige befugt, verbindliche Entscheidungen zu treffen.
2) « The Economic Community of West-African States-ECOWAS » entstand 1975 und zählt 15 Mitglieder[9]. Unter ihnen befinden sich ehemalige britische und französische Kolonien. Nigeria als grösste Wirtschaftsmacht zog viele der regionalen Staaten an, weil sie von ihm verbilligtes Erdöl erhielten. Die wirtschaftliche Integration, die anfangs nur schleppend vorankam, konzentrierte sich vor allem auf die grenzüberschreitende Verkehrsinfrastruktur. Internationale Aufmerksamkeit erhielt die ECOWAS durch ihre militärischen Friedensmissionen bei internen Konflikten in der Region (Liberia, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Elfenbeinküste, Mali). Inzwischen ist eine Freihandelszone entstanden und die Visaplicht unter den Mitgliedern zumindest teilweise aufgehoben worden. Neben dem obersten Entscheidungsorgan (Staatschefs) bestehen eine parlamentarische Versammlung mit beratender Stimme sowie ein Gerichtshof, der für die Interpretation der Verträge zuständig ist.
3) « The Southern African Development Community - SADC », folgte 1992 auf den informellen Zusammenschluss, der 1980 von neun Frontstaaten initiiert worden war, die als Nachbarn Südafrikas dessen rassistische Politik verurteilten, wirtschaftlich aber stark von ihm abhängig waren. Zunächst wurden nur periodische Konferenzen abgehalten, um sich gegenseitig zu unterstützen und für gemeinsame Projekte Hilfe bei ausländischen Geberländern zu beantragen. Als Namibia 1990 die Unabhängigkeit erlangte, wurde 1992 die ad-hoc Zusammenarbeit in eine formelle Organisation umgewandelt. Nach den demokratischen Wahlen von 1994 erhielt ebenfalls Südafrika die Mitgliedschaft. Heute gehören ihr 15 Staaten an[10], die sich sowohl wirtschaftlich wie politisch stärker integrieren wollen. Wirtschaftlich besteht eine Freihandelszone, die geplante Zollunion istoch nicht verwirklicht. 1996 wurde ein sicherheitspolitisches Protokoll verabschiedet, um demokratische Regierungsformen in der Region zu garantieren. Zwar wird die Bildung einer schnellen Eingreiftruppe vorangetrieben, die aber bisher noch nicht zum Einsatz gekommen ist. Nach dem Putsch von 2009 in Madagaskar wurde dessen Mitgliedschaft für mehrere Jahre suspendiert.
4) « The Economic Community of Central African States-ECCAS » war zunächst eine Zollunion von fünf zentralafrikanischen Staaten, die sich in den 1960er Jahren gebildet hatte. 1983 wurde beschlossen, die Organisation sowohl geographisch wie inhaltlich zu erweitern. Inzwischen hat sich ihre Mitgliederzahl verdoppelt[11]. Wegen zahlreicher Konflikte in der Region kommt jedoch die wirtschaftliche Integration nicht voran. Vorläufig bemüht sich die ECCAS mit beschränktem Erfolg um regionale Friedenspolitik.
5) « The Common Market for Eastern and Southern Africa-COMESA » entstand 1994, um präferentielle Zollabkommen in eine Freihandelszone umzuwandeln. Von den 19 Mitgliedern[12], die zur Organisation gehören, sind aber noch nicht alle in die Freihandelszone integriert. Das Ziel der Zollunion bleibt weiterhin unerreicht.
6) « The Inter-Governemental Authority on Development-IGAD » geht auf eine Initiative von sieben ostafrikanischen Staaten[13] zurück, die 1986 nach einer schweren Dürreperiode die Hungersnot in der Region gemeinsam zu bekämpfen suchten. 1996 wurde das Mandat auf die allgemeine Förderung der Entwicklung erweitert, zu deren Zweck auch die Schaffung einer Freihandelszone in Aussicht genommen wurde. Allerdings muss sich die Organisation bis heute vor allem um die Vermittlung von Konflikten in der Region bemühen. Im Auftrag der AU hat sie namentlich eine Friedenstruppe nach Somalia entsandt.
7) Die « Union du Maghreb Arabe-UMA » ist 1989 zwischen Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen und Mauretanien vereinbart worden, um die gegenseitige Wirtschaftsintegration zu vertiefen. Wegen des Konfliktes zwischen Marokko und Algerien über den Status der Westsahara ist das Projekt bis heute nicht vorangekommen.
8) « The Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD) » wurde 1998 am Rande des OAU-Gipfels in Sirte beschlossen. Es handelte sich um eine der Konzessionen an den von Gaddafi propagierten Vorschlag eines afrikanischen Einheitsstaates. Sehr allgemein wurden Ziele für eine enge Zusammenarbeit auf politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gebieten festgelegt. Mit der Hoffnung auf den Geldsegen von Tripolis beteiligten sich 28 Staaten an ihr. Einige Projekte folgten bei der Förderung von Landwirtschaft und Verkehrsinfrastruktur. Seit dem Zusammenbruch von Gaddafis Regime ist die Organisation lahmgelegt. Unter der Führung von Tschad sucht sie in letzter Zeit, die Zusammenarbeit im Kampf gegen den islamischen Terrorismus zu mobilisieren.
Die acht von der AU anerkannten Regionalorganisationen entsprechen nicht den ursprünglichen Absichten der afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft. Damals wollte man nur je eine Organisation im Norden, Osten, Westen, Zentrum und Süden schaffen. Aus politischen Gründen musste man jedoch auf mehre regionale «acquis» Rücksicht nehmen. Folglich bleiben multiple Mitgliedschaften und unterschiedliche Grade der Integration bestehen. Hinzu kommt, dass einzelne Mitglieder auf eigene Faust Wirtschaftsabkommen mit Partnern ausserhalb des Kontinents abschliessen (USA, EU, China, Indien etc.). Der Zeitplan des Abuja-Vertrages ist über Jahre im Verzug. Auf die AU-Kommission wartet noch viel Arbeit, um das ihr übertragene Mandat der Koordination effektiv wahrzunehmen .
Während die afrikanischen Staaten noch über die Erneuerung ihrer kontinentalen Organisation diskutierten, startete 1991 der südafrikanische Präsident Thabo Mbeki eine weitere Initiative. Ausgangspunkt war, dass sich Afrika an den Millenniumszielen der UNO aktiv beteiligen müsse. Freimütig wurde anerkannt, Afrika habe für seine Entwicklung selbst viele Fehler gemacht. Deswegen wurden in der « New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) » neben Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auch mehr Marktwirtschaft gefordert. Lokale Basisbewegungen reagierten negativ, weil sie eine Hinwendung zum Konsens von Washington befürchteten. Dagegen reagierte das Ausland sehr positiv. Der NEPAD gelang es, den « African Peer Review Mechanism-APRM » einzuführen, der periodisch alle Länder überprüft, ob die vorgegebenen Kriterien erfüllet werden. Der Mechanismus, an dem sich zumindest formell die Mehrheit der afrikanischen Länder beteiligen, enthält keine Sanktionen, sondern gleicht den von der OECD praktizierten Länderexamen. Die NEPAD ist inzwischen als Entwicklungsagentur in die Afrikanische Union integriert worden. Bei ihren Projekten stehen Landwirtschat, Infrastruktur, Wasser, Energie, IT-Ausbildung und die Förderung der Frauen im Vordergrund.
Kurz nach der ersten Unabhängigkeitswelle wurde 1964 von 23 Staaten die afrikanische Entwicklungsbank (« African Development Bank- AfDB ») gegründet. Im Unterschied zu anderen regionalen Entwicklungsbanken waren zunächst nur afrikanische Staaten zugelassen. Bald stellte sich heraus, dass damit keine genügende Kapitalausstattung zu erreichen war. Deshalb wurde der Beitritt 1979 auch für nichtregionale Staaten geöffnet. Heute gehören neben den 54 afrikanischen Staaten 26 nichtregionale Staaten zur Bank. Die Stimmrechte der nichtregionalen Teilnehmer sind auf 40% beschränkt. Das Grundkapital beläuft sich auf 99 Mia. USD. Jährlich werden Kredite in der Höhe von etwa 5 Mia. USD vergeben. 1972 wurde nach dem Vorbild der IDA der «African Development Fund» ins Leben gerufen. Der Fonds vergibt verbilligte Darlehen und Zuschüsse an die 38 ärmsten Länder des Kontinents. Die Mittel des alle drei Jahre neu aufgefüllten Fonds stammen zur Hauptsache aus nichtregionalen Geberländern. In den 1980er und zu Beginn der 1990er Jahren drohte der Bank wegen mangelnder Führung und schlechter Zahlungsmoral von Kreditnehmern der Kollaps. Seither durchgeführte Reformen haben aber erlaubt, das AAA Rating wieder zurückzuerobern. Heute arbeitet die Bank eng mit den Zielen der NEPAD zusammen.
Trotz nach wie vor viel Rhetorik und Wunschvorstellungen sind die Reformbemühungen der Afrikanischen Union beachtlich. Der Kontinent hat eingesehen, dass er für die Lösung seiner zahlreichen Konflikte selber Hand anlegen muss. Sicher gibt es unter den Organisationen noch zu viele Überlappungen, die nicht einfach zu überwinden sein werden. Doch ist Afrika in den letzten Jahren jährlich um 6% gewachsen, was die wirtschaftliche Integration beschleunigen dürfte. Allerdings muss dieses Wachstum in Zukunft besser verteilt und die starke Konzentration auf Rohstoffexporte verringert werden.
Naher Osten
Sieben schon unabhängige arabische Staaten (Ägypten, Irak, Jemen, Jordanien, Libanon, Saudi-Arabien, Syrien) gründeten 1945 in Kairo die Arabische Liga (League of Arab States). Unter ihnen gab es auch einige, die von einer einheitlichen arabischen Nation träumten. Das Gründungsdokument hielt jedoch fest, Aufgabe der Liga sei es, die Souveränität und territoriale Integrität der einzelnen Mitgliedstaaten zu schützen. Parallel dazu sollte sich der Verbund dafür einsetzten, andere arabische Gebiete, die noch unter Kolonialherrschaft standen, möglichst rasch in die Unabhängigkeit zu führen. Einzig Ägypten fusionierte 1958 unter dem panarabischen Idealisten Gamal Abdel Nasser mit Syrien, doch fiel der Zusammenschluss nach drei Jahren wieder auseinander. Heute zählt die Liga 22 Mitglieder, zu denen auch die palästinensische Autonomiebehörde gehört. Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist, dass das betreffende Land Arabisch zumindest als eine der offiziellen Sprachen anerkennt, obwohl man für Dschibuti und Somalia eine Ausnahme gemacht hat.
Die Liga inspirierte sich am funktionalen Ansatz und wollte vor allem die intergouvernementale Zusammenarbeit im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich vorantreiben. Bezeichnenderweise wurde das Thema der Sicherheit in der Gründungsakte nicht erwähnt. Das änderte sich 1948, als die UNO die Zwei-Staaten Lösung für Palästina beschloss und Israel rasch von zahlreichen Staaten anerkannt wurde. Noch im gleichen Jahr kam es zum ersten, aber erfolglosen Krieg der Araber mit Israel. Deshalb ergänzte die Liga 1950 ihre Charta mit einem Pakt für kollektive Verteidigung, der alle Mitglieder verpflichtet, bei einem Angriff auf einen arabischen Staat Beistand zu leisten. Obwohl Israel in den zehn seither stattgefundenen Kriegen meistens der Angreifer war, vermochten die arabischen Staaten die israelische Armee nie zu besiegen. Die schmerzlichste Niederlage erlitten sie beim Sechstagekrieg von 1967, als Israel den Golan, Westjordanland, Gaza und die Sinai-Halbinsel besetzte.
Gleich danach beschloss die Liga auf dem Gipfel von Khartum ihr berühmtes « Drei- Nein: keine Verhandlungen, keine Anerkennung, kein Frieden mit Israel. Den Konsens durchbrach 1979 der ägyptische Präsident Anwar as-Sadat, als er in Camp David mit Israel einen Friedensvertrag unterzeichnete. Ägypten wurde von der Liga ausgeschlossen, das Sekretariat der Organisation nach Tunis verlegt. Zehn Jahre später nahm die Liga Ägypten wieder auf, auch das Sekretariat kehrte nach Kairo zurück. Als Jordanien 1994 ebenfalls mit Israel Frieden schloss, kam es nicht mehr zu Sanktionen. Vielmehr unterbreiteten die arabischen Staaten auf Betreiben Saudi-Arabiens 2002 einen Friedenvorschlag. Sie erklärten sich bereit, Israel abzuerkennen, falls sich der jüdische Staat aus den 1967 besetzten Gebieten zurückziehen würde und das Problem der palästinensischen Flüchtlinge gelöst werden könnte.
Bei inner-arabischer Streitigkeiten gelang es der Liga, verschiedentlich zu vermitteln. So hat sie zu diesem Zweck Friedenstruppen nach Libanon und Kuwait entsandt. Uneinigkeiten ergaben sich 2003 bei dem Krieg gegen den Irak, der mehrheitlich abgelehnt wurde. Einige der benachbarten Länder stellten trotzdem der von den USA angeführten Koalition Flugplätze zur Verfügung. Ähnlich war das Szenario im libyschen Bürgerkrieg von 2011, bei dem sich nur vereinzelte Mitglieder an der von westlichen NATO-Staaten angeführten Intervention beteiligten.
1994 setzte der Rat eine Expertengruppe ein, um für die Liga eine Menschenrechtscharta vorzubereiten. Nach verschiedenen Revisionen wurde diese 2004 genehmigt und trat nach den ersten sieben Beitritten 2008 in Kraft. Die Charta ist jedoch noch nicht von allen Mitgliedern ratifiziert worden. Inhaltlich enthält sie viele säkular formulierte Rechte. Von Menschenrechtsexperten wurden trotzdem einige Passagen kritisiert, etwa der mangelnde Minderheitenschutz und die Möglichkeit, die Todesstrafe für Minderjährige beizubehalten. Der Überwachungsmechanismus ist schwach, er besteht aus einer Kommission von sieben Experten, die alle drei Jahre die Berichte der Mitgliedstaaten zu beurteilen haben.
Obwohl sich die Liga seit ihrem Bestehen vor allem mit politischen Fragen zu beschäftigen hatte, sind wirtschaftliche und soziale Ziele nicht völlig vernachlässigt worden. So gründete die Liga autonome Sonderorganisationen in Bereichen wie Gesundheit, Arbeit, Kultur, Postwesen und Telekommunikation. 1974 wurde der « Arab Fund for Economic and Social Development » beschlossen, dessen Kapital inzwischen auf 10 Mrd. USD aufgestockt worden ist. Von ihm sind mehr als der doppelte Betrag in Projekte für Energie, Verkehrsinfrastruktur und landwirtschaftliche Bewässerungstechnik investiert worden. Ein Jahr später kam die « Arab Bank for Development in Africa » hinzu, die über ein Kapital von 4 Mrd. USD verfügt und jährlich mit 300 Mio. USD Entwicklungsprojekte in nicht- arabischen Ländern Afrikas unterstützt. Seit 1976 besteht der « Arab Monetary Fund », der zur Stabilisierung der Wechselkurse unter den Mitgliedstaaten beitragen soll und zudem das Ziel hat, längerfristig eine gemeinsame Währung zu entwickeln. Ein weiteres Vorhaben wurde 2005 mit der « Greater Arab Free Trade Aerea – GAFTA » lanciert, mit dem die Zölle jährlich um 10% abgebaut werden sollten. Sowohl die gemeinsame Währung wie auch die geplante Freihandelszone sind jedoch bisher kaum vom Fleck gekommen.
Eine wirtschaftlich viel weitergehende Integration hat als subregionale Organisation der Golfkooperationsrat (Cooperation Council for the Arab States of the Arabian Gulf-GCC) erreicht. Er wurde 1981 von den sechs Monarchien der arabischen Halbinsel gegründet: Kuwait, Bahrain, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Oman. Unter diesen Ländern kam es 1982 zu einer Freihandelszone, die bereits nach drei Jahren in eine Zollunion mündete. Danach arbeitete man an einem gemeinsamen Markt, in dem auch die Personenfreizügigkeit vorgesehen war. Für 2010 war die Einführung einer gemeinsamen Währung vorgesehen, die jedoch zurückgestellt werden musste.
Das Zusammenrücken der Golfstaaten hatte auch sicherheitspolitische Motive. Nach der iranischen Revolution von 1979 befürchteten die sunnitischen Monarchien, dass die neue Führung in Teheran die schiitischen Minderheiten in ihren Ländern zu Revolten animieren könnte. Die Nervosität verstärkte sich, als 1980 der Krieg zwischen Irak und Iran ausbrach. Deshalb beauftragte der oberste Kooperationsrat 1982 die Verteidigungsminister, das Bündnis der kollektiven Verteidigung zu verstärken, worauf eine gemeinsame Brigade von 5000 Mann gebildet wurde. Mit dieser beteiligten sich die Golfstaaten an der von den USA geführten Koalition, die 1990 nach dem Einmarsch irakischer Truppen Kuwait befreite. Die sogenannte «Peninsula Shield Force» wurde danach weiter ausgebaut.
Teile von ihr marschierten 2011 in Bahrain ein, um den bedrängten Monarchen vor Demonstranten zu schützen, die im Zuge des Arabischen Frühling demokratischen Reformen verlangten. Seit 2014 beteiligten sich Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate an den von den USA angeführten Luftschlägen gegen den Islamischen Staat, dessen Ideologie nicht zuletzt aus dem saudischen Wahhabismus stammt. Anfangs 2015 starteten die Golfstaaten eine militärische Intervention in Jemen, bei der es darum geht, den Aufstand der als Schiiten geltenden Huthis zurückzuschlagen.
2017 ist der Golfkooperationsrat in eine schwere Krise gestürzt. Saudi-Arabien und seine engsten Verbündeten kündigten ihre Zusammenarbeit mit Katar, dem sie eine zu starke Nähe mit Iran vorwerfen. Kuwait sucht zu vermitteln, das saudische Königsreich mobilisiert aber alle Kräfte, um iranische Expansionsgelüste im Mittleren Osten einzudämmen.
Niemand weiss heute, wie die Kriege in Syrien und Jemen enden werden. Nach wie vor verursacht der islamische Terror mehr muslimische als westliche Opfer. Die Gegensätze zwischen Sunniten und Schiiten sind politisch überlagert. Im Irak ist es der Regierung nicht gelungen, einen Ausgleich zwischen den beiden Gruppen zu finden. Libyen ist seit dem Sturz von Gaddafi ein gescheiterter Staat, für Somalia gilt das schon seit Jahrzehnten. Mehr denn je scheint eine Lösung des Palästina-Konfliktes in weiter Ferne zu liegen.
Das Bewusstsein steigt, dass allein mit Erdöl eine florierende Wirtschaft nicht mehr lange zu gewährleiten ist. Seit Jahren fordert die regionale Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien, die 1973 von der UNO gegründet wurde, die Region müsse sich wirtschaftlich diversifizieren. Deren energische Generalsekretärin, die Jordanierin Rima Khalaf, wagt es auch, die enormen Wohlstandsgefälle sowie die nach wie vor bestehenden Diskriminierungen in den muslimischen Gesellschaften zu thematisieren.
Asien-Ozeanien
In Asien sind regionale Organisationen relativ spät entstanden. Das hat mit der flächenmässigen Ausdehnung des Kontinents zu tun, auf dem alle Klimazonen der Welt anzutreffen sind, ein Drittel der bestehenden Sprachen gesprochen werden und uralte Zivilisationen weiterhin Wirksamkeit entfalten. Unter den zahlreichen Staaten gibt es nicht nur in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht, sondern auch bezüglich ihrer Grösse enorme Unterschiede. Zudem schränkten ideologische Gründe das Interesse an grenzüberschreitender Zusammenarbeit ein, nachdem China, das bevölkerungsreichste Land, kommunistisch geworden war. Verschiedene Konflikte (Kaschmir, Nord-Südkorea, Südchinesisches Meer, Taiwan, Myanmar) belasten bis heute die gegenseitigen Beziehungen.
Die erste Organisation wurde 1967 von Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Singapur und Thailand gegründet (« Association of South East Asian Nations-ASEAN ». Auf dem Hintergrund kommunistischer und westlicher Interventionen im Vietnamkrieg befürchteten die fünf Staaten, dass sie ihre Unabhängigkeit verlieren könnten. Sie gehörten alle der Bewegung der Blockfreien an, obwohl einige von ihnen mit dem Westen verbunden waren. Sofort nach seiner Unabhängigkeit erhielt Brunei 1984 die Mitgliedschaft, nach dem Ende des Kalten Krieges kamen Vietnam (1995), Laos, Myanmar (1997) und Kambodscha (1999) hinzu, was die Zahl der Mitglieder verdoppelte.
Rechtlich gesehen war die ASEAN zunächst keine internationale Organisation, sondern ein periodisches Zusammentreffen von Aussenministern sowie den Staats-und Regierungschefs. Erst 1976 wurde ein kleines Sekretariat für administrative Aufgaben eingerichtet. Von Anfang an verfolgte die ASEAN das Ziel, Frieden, Fortschritt und Wohlstand untereinander zu fördern. Dahinter stand die Überzeugung, dass es für den wirtschaftlichen Erfolg friedliche Verhältnisse braucht.
In den ersten Jahren standen sicherheitspolitische Themen im Vordergrund. Zur Lösung von Problemen setzte man ausschliesslich auf den Dialog. Dieser sollte auf der Grundlage der Nichteinmischung in interne Angelegenheiten und des Respektes der territorialen Integrität erfolgen. Von übergeordneten Instanzen zur Schlichtung von Konflikten wurde abgesehen. Durch ständige Kommunikation wollte man auf sanfte Weise («ASEAN Way») zu Lösungen kommen.
Um solche Bemühungen zu unterstützen, einigte man sich 1971 auf die Erklärung für eine Zone des Friedens, der Freundschaft und Neutralität. 1976 ergänzte man diese mit dem Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit, 1995 kam das Abkommen über eine nuklearwaffenfreie Zone hinzu. Der weiche Ansatz geduldiger Vermittlung über Konsens führte durchaus zu Erfolgen. So konnten etwa Grenzstreitigkeiten zwischen Indonesien und Malaysia sowie zwischen den Philippinen und Malaysia überwunden werden. Nach der Besetzung Kambodschas (1978) suchte man unterschiedliche Meinungen auszugleichen, was nach zehn Jahren zum Rückzug der vietnamesischen Truppen führte. Als Myanmar 1995 trotz seiner Militärdiktatur aufgenommen wurde, gab es einige Kritik, doch dürften die beharrlichen, aber diskreten Bemühungen dazu beigetragen haben, dass es in dem Land zwei Jahrzehnte später wenigstens zu einer kleinen Öffnung kam.
Angesichts des Prinzips der Nichteinmischung in interne Angelegenheiten war seit Beginn klar, dass jeder Staat seine Wirtschaftspolitik selber gestalten würde. Allerdings hatten sich mehrere Mitgliedstaaten schon früh auf den Pfad der Marktwirtschaft begeben. Das führte in den 1980er Jahren zu grossen Erfolgen des Wachstums, das vornehmlich auf Exporten beruhte. 1993 beschloss die ASEAN, für Industrieprodukte eine Freihandelszone einzuführen, die schrittweise auch auf Agrarprodukte ausgedehnt werden sollte. Den wirtschaftlich schwächeren Mitgliedstaaten wurden längere Übergansfristen eingeräumt. Nach der Finanzkrise von 1997 musste das Vorhaben zeitlich verschoben werden. Seit der Überwindung der Krise sind auch die weniger fortgeschrittenen Mitgliedstaaten den vorgesehenen Zollsenkungen weitgehend nachgekommen. Auch der Kapitalverkehr für Direktinvestitionen wurde liberalisiert. Ohne eine Zollunion zu verwirklichen, haben die ASEAN-Staaten mit China, Japan, Südkorea, Indien, Australien und Neuseeland Freihandelsabkommen abgeschlossen. Mit mehreren Drittstaaten ausserhalb des Kontinents wird über ähnliche Abkommen verhandelt.
Nach mehrjährigen Vorarbeiten trat 2008 die ASEAN-Charta in Kraft. Damit erhielt der bisher informelle Prozess eine völkerrechtliche Grundlage und eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die drei Körbe, die schon bisher galten – Sicherheit, Wirtschaft und Soziales – wurden in der Charta verankert. Der «ASEAN-Way» blieb aber unverändert, das Prinzip der Einstimmigkeit gilt weiterhin. Auch das Sekretariat erhielt keine zusätzlichen Aufgaben. Einzig für die Treffen der Staats- und Regierungschef wurde vereinbart, dass diese künftig mindestens zwei Mal pro Jahr stattzufinden haben. Ausserdem forderte die Charta die Mitgliedstaaten auf, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte zu fördern[14].
Im Bereich der Sicherheitspolitik schuf man 1994 das ASEAN-Regionalforum (ASEAN Regional Forum-ARF). Mit ihm sollte der interne Ansatz für die Vermeidung und Lösung von Konflikten über die eigenen Grenzen hinaus verbreitet werden. An ihm beteiligen sich inzwischen neben den 10 ASEAN-Mitgliedern 17 weitere Staaten:
Australien, Bangladesch, China, Indien, Japan, Kanada, Mongolei, Neuseeland, Nordkorea, Pakistan, Papua-Neuguinea, Ost-Timor, Russische Föderation, Südkorea, Sri Lanka, die USA sowie die EU.
Das Forum, bei dem die jeweilige ASEAN-Präsidentschaft den Vorsitz führt, ist zurzeit die grösste asiatische Plattform für Diskussionen über Sicherheit. Zu Beginn standen vertrauensbildende Massnahmen und präventive Diplomatie im Vordergrund. Nach dem Tsunami von 2004 wurde die koordinierte Katastrophenhilfe ausgebaut. Seither berät man sich auch zu Themen wie die Bekämpfung der Piraterie, des Terrorismus, der transnationalen Kriminalität und des Drogenhandels.
Nachdem sich anfangs 2016 der ständige Schiedsgerichtshof in Den Haag gegen die chinesischen Ansprüche im südchinesischen Meer ausgesprochen hatte, konnten sich die ASEAN-Staaten nicht auf eine gemeinsame Position einigen. Obwohl mehrere Mitgliedstaaten den Richterspruch begrüssten, hielten sich andere mit Rücksicht auf China bedeckt. Als Myanmars Generäle 2017 über 600'000 Rohingyas aus dem Lande trieben, war es erneut nicht möglich, eine klare Stellungnahme zu beziehen.
Im wirtschaftlichen Bereich haben sich die ASEAN- Staaten 2003 auf dem Gipfel von Bali das Ziel gesteckt, über die Freihandelszone hinaus zu gehen und progressiv eine Wirtschaftsgemeinschaft (« ASEAN Economic Community ») aufzubauen. Die Charta von 2008 bekräftigte das Vorhaben und legte vier Leitplanken fest: a) die Errichtung eines Binnenmarktes, b) die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, c) ein besserer Ausgleich unter den Mitgliedstaaten, d) die möglichst weitgehende Integrierung in die Weltwirtschaft. Der Binnenmarkt soll bis 2020 verwirklicht werden. Die Personenfreizügigkeit wird zunächst nur für Unternehmer und Fachkräfte gelten. Bezüglich Wettbewerbsfähigkeit will man über den Ausbau des Patentschutzes Innovationen fördern. Für den Ausgleich unter den Mitgliedstaaten sollen namentlich Kredite an kleine und mittlere Unternehmen sowie Investitionen in die grenzüberschreitende Verkehrsinfrastruktur verstärkt werden.
Mit dem vierten Punkt sucht man, bei der Gestaltung der globalen Wirtschaftsordnung an vorderster Front mitzumachen. Zu diesem Zweck hat die ASEAN mehrere Dialogpartnerschaften mit Drittstaaten geschaffen. Eine der ersten war die ASEAN + 3, die seit 1997 besteht und zu der China, Japan und Südkorea gehören. 2005 kam der Ostasiengipfel (« East Asia Summit ») hinzu, der neben den ASEAN+3 Staaten auch Australien, Neuseeland, Indien, die USA und Russland umfasst. Die Treffen der beiden Formationen finden in der Regel nach den ASEAN-Gipfeltreffen statt.
Auf Betreiben Singapurs suchten die ASEAN-Staaten schon früh den Kontakt mit der Europäischen Union. 1996 fand das erste Gipfeltreffen zwischen der EU, den ASEAN-Staaten sowie Japan, China und Südkorea statt. Später wurde der Kreis auf Indien, Pakistan, die Mongolei, Australien, Neuseeland, Russland, Bangladesch, Norwegen, die Schweiz und Kasachstan erweitert. Unter den Staats- und Regierungschefs kommt es alle zwei Jahre zu einem Gipfeltreffen (« Asia-Europe Meeting-ASEM). Dazwischen gibt es regelmässige Sitzungen der Aussen- Wirtschafts- und Finanzminister. Vermehrt kommt es auch zu Kontakten von Fachministern in Bereichen wie Umwelt, Bildung und Kultur.
Da das rasche Wachstum Chinas und der südostasiatischen Länder die trans-pazifischen Beziehungen veränderten, regte der australische Premierminister Bob Hawke 1989 an, für die pazifischen Anrainerstaaten ein informelles Netzwerk zu schaffen. Zwölf von ihnen trafen sich noch im gleichen Jahr auf Ebene der Aussenminister in Canberra und begründeten die « Asia-Pacific Economic Cooperation-APEC ». Das Forum war vorwiegend für Handelsfragen gedacht. 1993 lud der amerikanische Präsident Bill Clinton die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmer nach Blake Island ein, um den Abschluss der Uruguay Runde voranzutreiben. Seither treffen sich die Staats-und Regierungschefs jedes Jahr in einem der Teilnehmerstaaten.
In der APEC wird allerdings soweit als möglich nicht von Staaten, sondern von eigenständigen Wirtschaften gesprochen. Deshalb sind daran auch Taiwan und Hongkong beteiligt. Die Mitgliedschaft ist inzwischen auf 21 gestiegen[15]. Um die Nähe zur Wirtschaft zu bezeugen, nehmen an den jährlichen Treffen auch Unternehmensvertreter teil. Dank informellen Absprachen sind die Transaktionskosten für Geschäftstätigkeiten in zwei Etappen um etwa 10% gesenkt worden.
1994 beschloss man auf dem Gipfel in Bogor (Indonesien), Verhandlungen über eine Freihandelszone aufzunehmen. Ein erster Schritt konkretisierte sich 2005, als Chile, Neuseeland und Singapur ein Freihandelsabkommen vereinbarten und sich für weitere Teilnehmer offen zeigten. Den vier Ländern schlossen sich 2008 Australien, Kanada, Japan, Malaysia, Mexiko, die USA und Vietnam an, um über ein umfangreicheres Abkommen zu verhandeln. Darin sollten nicht nur Zölle und nichttarifäre Hemmnisse, sondern auch Dienstleistungen, Investitionen, geistiges Eigentum, öffentliche Ausschreibungen, Wettbewerbsrecht sowie Mindeststandards für den Umweltschutz und das Arbeitsrecht geregelt werden. Nach siebenjährigen Verhandlungen einigten sich die Unterhändler Ende 2015 auf einen Text, der anfangs 2016 in Auckland unterzeichnet wurde. Das « Transpacific Partnership Agreement-TPP » tritt in Kraft, wenn es innerhalb von zwei Jahren von allen Unterzeichnerstaaten ratifiziert wird, oder wenn es danach von wenigstens 6 Staaten, die mindestens 85% des BIP der Teilnehmerstaaten ausmachen, ratifiziert wird.
China war für die Verhandlungen des TPP nicht berücksichtigt worden. Ein halbes Dutzend anderer Staaten hatten jedoch die Absicht ihres Beitritts angekündigt. Sofort nach seinem Amtsantritt erklärte Donald Trump, er werde das Abkommen nicht ratifizieren, sondern nur bilateral verhandeln. Umgehend suchte Peking sein eigenes Projekt der «Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP» voranzutreiben. Neben den zehn ASEAN-Staaten nehmen an den Verhandlungen ebenfalls Australien, Indien, Japan, Südkorea und Neuseeland teil. Die Zielsetzungen der RCEP gehen weniger weit als jene des TPP. Im Vordergrund stehen stark verringerte Zölle im Güterverkehr, die Öffnung für grenzüberschreitende Dienstleistungen sowie die gegenseitige Erleichterung von Direktinvestitionen. Wie weit die Liberalisierung des staatlichen Auftragswesens gehen soll, ist noch umstritten. Zudem stehen die im TPP enthaltenen Mindeststandards für den Arbeiter- und den Umweltschutz nicht zur Diskussion. Sollte das Abkommen zustande kommen, würde mit 45% der Weltbevölkerung und 40% der globalen Wirtschaftsleistung die bisher grösste Freihandelszone der Welt entstehen.
1985 wurde von Bangladesch, Bhutan, Indien, den Malediven, Nepal, Pakistan und Sri Lanka die südasiatische Vereinigung für regionale Zusammenarbeit (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) gegründet. 2007 kam Afghanistan hinzu. Die Idee war bereits in den 1970er Jahren von Zia-ur Rahman, dem Regierungschef von Bangladesch angeregt worden. Deren Verwirklichung erwies sich jedoch als schwierig. Zwischen Pakistan und Indien bestanden langjährige Streitigkeiten, so dass Islamabad wenig erpicht auf eine Organisation war, die von Indien dominiert würde. Auch in New-Delhi war man skeptisch, weil man befürchtete, die kleineren Nachbarstaaten könnten gemeinsam stärkeren Druck auf eigene Interessen ausüben.
Die Vorbehalte wurden erst überwunden, als man sich darauf einigte, Beschlüsse im Konsens zu fällen, sich nicht in interne Angelegenheiten einzumischen, politische Streitigkeiten auszuklammern und sich auf wirtschaftliche Zusammenarbeit zu beschränken. Danach wurden mehr als ein Dutzend Kooperationsfelder vereinbart, die Bereiche wie Land- und Forstwirtschaft, Armutsbekämpfung, Umwelt, Energie, Katastrophenhilfe, Meteorologie, Gesundheit, Biotechnologie, Sport und Kultur umfassen. Verschiedenen Hauptstädten wurden dafür regionale Zentren zugeteilt, die bisher jedoch mehr Papier als konkrete Projekte realisiert haben.
Im wirtschaftlichen Bereich kam es 1993 zu einem präferentiellen Zollabkommen, mit dem ab 2002 für 5'000 Produkte die Zölle abgebaut werden sollten. 2006 ergänzte man das Ziel mit einer Freihandelszone, um auch andere Handelshemmnisse zu beseitigen. Mittelfristig strebt man eine Zollunion an, was sich angesichts der bisherigen Ergebnisse nicht so rasch verwirklichen wird. Trotz der boomenden Wirtschaft Indiens ist der intraregionale Handel von 3% auf kaum mehr als 5% gestiegen.
Obwohl von der Gründungsakte strittige Themen politischer Natur ausgeklammert worden waren, haben die mehr oder minder regelmässigen Gipfeltreffen wiederholt die Möglichkeit geboten, auf oberster Ebene diskrete Gespräche zu führen. Auch wenn es dabei noch nie zu einem durchschlagenden Erfolg gekommen ist, verbleibt die Hoffnung, dass von diesem Forum eines Tages wenigstens vertrauensbildende Massnahmen ausgehen könnten.
1996 lud Zhang Zemin - damals Generalsekretär der kommunistischen Partei und später Präsident von China - Russland, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan nach Shanghai ein, um politische und wirtschaftliche Themen zu erörtern. Die sogenannte Shanghai-5 Gruppe hielt darauf jährliche Treffen ab. 2002 wurde sie vertraglich in die Organisation der Shanghai-Kooperation (« Shanghai Cooperation Organisation-SCO ») übergeführt. Gleichzeitig nahm man Usbekistan als neues Mitglied auf, 2016 kamen mit Indien und Pakistan zwei weitere Mitglieder hinzu.
Wirtschaftlich ging es den Chinesen vor allem darum, in den rohstoffreichen Ländern Zentralasiens Fuss zu fassen. Moskau war seinerseits interessiert, den steigenden Einfluss der Amerikaner in der Region zurückzudrängen. Auch für die Machthaber der zentralasiatischen Länder war das Angebot verlockend, weil die Chinesen weniger als westliche Unternehmen auf Bedingungen für soziale Mindeststandards pochten.
Das Prinzip, sich nicht in interne Angelegenheiten einzumischen und bestehende Herrschaftsstrukturen nicht in Frage zu stellen, kam allen gelegen. Deshalb wollte man sich gegenseitig vor allem bei der Bekämpfung des Terrorismus, des Separatismus und des Extremismus unterstützen. Dabei ging es nicht nur um den internationalen Terrorismus, sondern auch um interne Regimegegner und aufmüpfige Minderheiten. Zu diesem Zweck wurde in der usbekischen Hauptstadt Taschkent ein Anti-Terrorismus Zentrum eingerichtet, das den Austausch von sicherheitsrelevanten Informationen zu koordinieren hat.
Institutionell ist der Integrationsprozess eher schwach, weil er auf Konsens beruht. Für die Idee Moskaus, ein Kartell für Gas und Erdöl zu bilden, hatte Peking wenig Sympathie, weil es vorzieht, seine Energieversorgung über bilaterale Verträge abzuwickeln. Als China eine Freihandelszone und einen regionalen Entwicklungs-Fonds vorschlug, zeigte sich Russland zurückhaltend, da es eine Schwächung seines Einflusses in den zentralasiatischen Republiken befürchtete. Seit der Annexion der Krim ist jedoch Moskau wegen westlicher Sanktionen mehr denn je auf Kompromisse mit dem chinesischen Nachbarn angewiesen.
Experten meinen, die sicherheitspolitische Zusammenarbeit der SCO könnte mit der Zeit zu einem System kollektiver Verteidigung in Konkurrenz zur NATO führen. Tatsächlich werden in den letzten Jahren gemeinsame Militär-Manöver zwischen Russland und China, aber auch mit anderen Mitgliedstaaten durchgeführt. Doch bleibt zwischen Moskau und Peking ein historisch gewachsener Argwohn bestehen. Russlands Interessen sind vor allem auf die Erhaltung seines Status als Weltmacht konzentriert. Für China steht dagegen im Vordergrund, eine führende Rolle in der Weltwirtschaft zu übernehmen.
Der Entscheid, Indien und Pakistan als neue Mitglieder aufzunehmen, war lange umstritten. China hatte vor allem mit Indien Schwierigkeiten, Peking stimmte erst zu, als auch Pakistan den Zutritt erhielt. Pakistan als langer Verbündeter Chinas interessiert insofern alle Mitgliedstaaten, weil man von ihm einen stabilisierenden Einfluss auf Afghanistan erhofft, dessen Extremisten eine Gefahr für die gesamte Region darstellen. New Delhi unterhielt zwar bis zum Ende des Kalten Krieges privilegierte Beziehungen zu Moskau, hielt aber an der Tradition demokratischer Institutionen fest. Als rasch wachsende Wirtschaft ist es heute wie China vor allem an dem Rohstoffreichtum Russlands und der zentralasiatischen Staaten interessiert.
Indien verfügt über keine direkten Grenzen zu den anderen SCO-Staaten. Da ihm von Pakistan ein Transitkorridor verweigert wird, investiert die indische Regierung in den iranischen Hafen Chabahar und plant, von dort aus eine Eisenbahnverbindung nach dem Norden zu bauen. Indien unterstützt deshalb die iranische Kandidatur für die Mitgliedschaft in der SCO. Da noch andere Kandidaten vor der Türe stehen, ist damit zu rechnen, dass sich das geographische Einzugsgebiet der Organisation weiter ausdehnen wird.
Die süd-pazifischen Staaten gründeten 1971 in der Hauptstadt Neuseelands das «South Pacific Forum». 1999 wurde es in « Pacific Islands Forum » umgetauft, weil auch Staaten nördlich des Äquators beigetreten waren. Institutionell weist das Forum, an dem inzwischen 16 Staaten beteiligt sind[16], einen speziellen Charakter aus. Das jährliche Treffen der Staats-und Regierungschefs fungiert als oberstes Entscheidungsorgan, ist aber juristisch eine Konferenz geblieben. Völkerrechtspersönlichkeit hat nur das Sekretariat, für dessen Errichtung die Mitglieder 1973 einen zwischenstaatlichen Vertrag abgeschlossen hatten.
Es besteht ein Freihandelsabkommen für den Warenaustausch, dessen Umsetzung noch nicht vollständig ist. Für Dienstleistungen gibt es ein Zusatzprotokoll, das bisher nur von einer Minderheit ratifiziert worden ist. Verhandlungen über die Liberalisierung des Flugverkehrs («open sky») ziehen sich in die Länge, obwohl ein solches Abkommen für die teilweise weit entfernten Inseln von einiger Bedeutung wäre. Viele der lokalen Wirtschaften sind klein und wenig komplementär. Sie bleiben stark von Entwicklungshilfe abhängig, die hauptsächlich von Australien, Neuseeland und der Europäischen Union geleistet wird.
Auf dem Gipfeltreffen von Oktober 2000 wurde die Biketawa Erklärung verabschiedet, die alle Mitglieder zu demokratischen Regierungsformen verpflichtet. Als es in Nauru und auf den Salomon-Inseln zu Spannungen kam, konnten diese unter australischer Führung beruhigt werden. Die Mitwirkungsrechte von Fidschi wurden nach dem Militärputsch von 2009 suspendiert, seit den Wahlen von 2014 ist das Land jedoch wieder voll integriert. 1985 war der Vertrag von Rarotonga über die nuklearfreie Zone im Südpazifik in Kraft getreten, dem inzwischen 13 Länder aus der Region beigetreten sind, nur Palau, Mikronesien und die Marsall-Inseln haben ihn noch nicht ratifiziert. Seit 2013 nimmt Australien keine Bootsflüchtlinge mehr auf, sondern lagert diese gegen Entschädigung auf Nauru und andere Inseln aus. Seit Jahren wird dies von internationalen Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisation scharf kritisiert. Die Klimaerwärmung bedroht das Überleben mehrerer Inseln, weshalb die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens für das «Pacific Forum» oberste Priorität hat.
2013 schlug der chinesische Präsident Xi Jinping vor, eine asiatische Infrastruktur-Investitionsbank (« Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB «) zu gründen. Hinter der Idee standen nicht nur die grossen Währungsreserven des Landes, Peking war schon seit langem verärgert, dass der amerikanische Kongress seine Stimmerhöhung von 4% auf 6,4% in den Bretton-Woods Institutionen blockierte, obwohl die Volksrepublik zur zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen ist.
Die Bank nahm anfangs 2016 ihre Operationen auf, nachdem die notwendigen Ratifikationen hinterlegt worden waren. Inzwischen sind ihr 37 asiatische und 20 nicht-regionalen Länder beigetreten. Unter den nicht-regionalen Ländern befinden sich auch die wichtigsten westeuropäischen Staaten, obwohl Washington zunächst Druck auf seine Verbündeten ausgeübt hatte, sich an der Institution nicht zu beteiligen.
Das Stammkapital der Bank beträgt 100 Mrd. USD, von dem nur noch 1,6 Mrd. nicht gezeichnet sind. Da es mehrere Beitrittskandidaten gibt, dürfte es bald erhöht werden. 75% des Kapitals ist für die regionalen Mitglieder reserviert. Der Aufbau der Bank gleicht weitgehend ähnlichen Institutionen. Für sehr wichtige Beschlüsse (Änderung der Statuten, Erhöhung des Kapitals, Ausschluss eines Mitgliedes) braucht es eine Zweidrittelmehrheit der Mitgliedstaaten, die drei Viertel der Kapitalbeteiligungen ausmachen. Für die qualifizierte Mehrheit genügt die Mehrheit der Stimmen mit der Mehrheit des Kapitals. Eine Besonderheit ist, dass die zwölf Vertreter im Direktorium, von denen neun aus der Region kommen müssen, nicht ständig am Sitz der Bank in Peking stationiert sind, sondern mit modernen Kommunikationsmitteln auch aus der Ferne beraten und beschliessen können. China verfügt mit einem Stimmenanteil von 26,06% über eine knappe Sperrminorität.
Für die operationellen Tätigkeiten liegen die Prioritäten hauptsächlich beim Landverkehr, Hafenanlagen, Energie, Wasser und Telekommunikation. Mit den auf den internationalen Kapitalmärkten aufgenommen Mittel sollen Darlehen, Garantien und Beteiligungen nicht nur an Regierungen, sondern auch an private Unternehmen vergeben werden. Gemäss den Statuten sind Projekte jeweils öffentlich auszuschreiben, damit jeder Mitgliedstaat sich daran beteiligen kann. Bei deren Beurteilung sollen auch soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt werden[17].
Nicht zu bezweifeln ist, dass die Aktivitäten der Bank zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Senkung von Produktionskosten und zur Erschliessung neuer Märkte beitragen werden. Nach Berechnungen der asiatischen Entwicklungsbank müssten in der Region 8'000 Mrd. USD in die Infrastruktur investiert werden, um die Wachstumsdynamik und die Armutsbekämpfung auf alle zurückgebliebenen Länder auszudehnen. Angesichts der Summe sind Befürchtungen nicht gerechtfertigt, die neue Bank werde zu unnötiger Konkurrenz mit bestehenden Institutionen führen. Ausserdem sind die ersten Projekte der AIIB in Abstimmung mit der Weltbank und der asiatischen Entwicklungsbank aufgegleist worden. Indessen ist es China mit der Initiative gelungen, seinen Anspruch auf eine Führungsrolle in der internationalen Wirtschaftsordnung zu untermauern.
Die Asiatische Entwicklungsbank (« Asian Development Bank-ADB ») wurde 1965 gegründet und zählt heute 67 Mitglieder (davon 48 regionale und 19 nicht-regionale Länder). In den 1960er Jahren waren noch viele asiatischen Länder arm, weshalb es nicht erstaunt, dass Japan und die USA die grössten Kapitalanteile zeichneten. Bis heute verfügen die beiden Länder über die höchste Stimmenzahl (Japan 12,8%, USA 12,7%), während China bloss auf 5,4% kommt. Peking stört sich daran, dass seit Beginn ununterbrochen ein Japaner zum Präsidenten der Bank gewählt wird.
Gegenwärtig liegt das Kapital der ADB bei 160 Mrd. USD, womit sie jährlich für etwa 13 Mrd. USD Projekte realisiert. 1973 wurde der Bank auch ein Entwicklungsfonds angegliedert, der bei der letzten Aufstockung 140 Mrd. USD für viere Jahre erhalten hat. Damit werden die ärmsten Länder mit Zuschüssen und stark verbilligten Darlehen unterstützt. Zunächst konzentrierte die ADB ihre Prioritäten auf die Landwirtschaft, mit der wirtschaftlichen Entwicklung kam die Energie hinzu, schliesslich auch die Unterstützung von Privatisierungen in einzeln Mitgliedstaaten. In den nächsten Jahren will sie ihr Schwergewicht auf die in der UNO vereinbarten Klimaziele legen. Die Ausgaben für Projekte in diesem Bereich sollen von 3 auf 6 Mrd. USD verdoppelt werden.
Die UNO-Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik (« UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP «) wurde von der UNO 1947 gebildet. An ihr sind 53 Staaten beteiligt, hinzu kommen 9 assoziierte Territorien. Wie andere regionale UNO-Wirtschaftskommissionen setzt auch sie sich für die Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein und plädierte damit schon früh für die Bildung einer regionalen Entwicklungsbank. Daneben half und hilft sie ärmeren Ländern bei der Ausarbeitung von Projekten, um internationale Entwicklungshilfe zu erhalten. In den vergangenen Jahren hat sie das Schwergewicht auf die UNO-Millenniumsziele gelegt und tut dasselbe nun für die Ziele der nachhaltigen Entwicklung (UNO-Agenda 2030).
8. Transregionale Spezialorganisationen
Bei regionalen Organisationen denkt man in erster Linie an Zusammenschlüsse unter geographisch benachbarten Staaten. Die regionalen Entwicklungsbanken haben zwar Mitgliedstaaten ausserhalb der Region, ihr Ziel ist jedoch, die Entwicklung in einer bestimmten Region zu fördern. Doch gibt es auch Organisationen, die sich einem spezifischen Bereich widmen, keine universelle Mitgliedschaft anstreben, zur Erreichung ihres Ziels aber mit gleichgesinnten Ländern aus anderen Kontinenten zusammenarbeiten. Von transregionalen Organisationen solcher Art werden nach nachstehend nur drei erwähnt.
Die Organisation erdölexportierender Länder (« Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC ») wurde 1960 von Irak, Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela gegründet. Darauf schlossen sich ihr Katar (1961), Indonesien (1962), Libyen (1962), die Vereinigten Arabischen Emirate (1967), Algerien (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973), Gabun (1975) und Angola (2007) an. Indonesien, Ecuador und Gabun verliessen zeitweise die Organisation, traten später aber wieder bei.
Nach dem zweiten Weltkrieg nahm der Konsum von Erdöl stark zu. Der Markt wurde von wenigen westlichen Firmen (den « sieben Schwestern») beherrscht, die noch unter kolonialen Privilegien entstanden waren. Ziel der OPEC war es, sich von diesem Kartell zu lösen und die Preisbildung selber an die Hand zu nehmen. Mittel dazu waren die Festlegung von Exportquoten und die Erhöhung der Steuern für internationale Konzerne. In zahlreichen Ländern wurde die Erdölförderung nationalisiert, auch wenn einige von ihnen bis heute an dem System der Lizenzen festgehalten haben.
Die Mitglieder der OPEC fördern etwa 40% der weltweiten Produktion und verfügen gemäss Schätzungen über 75% der noch vorhandenen Reserven. Mindestens zwei Mal pro Jahr treffen sich die Erdölminister am Sitz der Organisation in Wien, um die Marktlage zu analysieren und sich auf entsprechende Massnahmen zu einigen. Jedes Mitglied verfügt über eine Stimme und bezahlt den gleichen Beitrag an die Verwaltungskosten der OPEC. Beschlüsse werden im Konsens gefällt. Saudi-Arabien ist jedoch die Schlüsselfigur der Organisation. Wenn sich andere Länder nicht an die vereinbarten Exportquoten halten, kann es sich leisten, unter seiner eigenen Quote zu produzieren, damit die Gesamtmenge nicht überschritten wird.
Zum ersten Mal weltweite Aufmerksamkeit erhielt die Organisation 1973 nach dem Jom-Kippur-Krieg, als arabische Länder ihre Lieferungen nach westlichen Staaten, die als Freunde Israels galten, einstellten. Innerhalb weniger Monate vervierfachte sich der Erdölpreis von 2,89 USD auf 11,65 USD pro Fass. Nach der islamischen Revolution im Iran (1979) und dem Ausbruch des Krieges zwischen Iran und Irak (1980-1988) kam es zu einem zweiten Preissprung auf ca. 34 USD. Als in den westlichen Industriestaaten eine Rezession einsetzte, ging die Nachfrage nach Erdöl zurück, so dass der Preis pro Fass Mitte der 1980er Jahre wieder bei 10 USD lag. In den 1990er Jahren blieben die Preise relativ tief, obwohl es bei politischen Krisen immer wieder zu kurzfristigen Aufschlägen kam.
Nach der Jahrhundertwende begannen die Preise stetig zu steigen. Ausschlaggebend waren wirtschaftliche Faktoren, namentlich das rasche Wachstum Chinas, das zum zweitgrössten Erdölimporteur der Welt geworden war. Kurz vor der Finanz-und Wirtschaftskrise von 2008 kam es zu Notierungen für ein Fass in der Nähe von 150 USD. In der Euphorie meinte der algerische Erdölminister Chakib Kheli, es sei bald mit Preisen von 400 USD. pro Fass zu rechnen. Doch so weit kam es nicht, ab 2014 sanken die Preise wieder unter 50 USD. pro Fass. Einerseits lagen die Fördermengen der OPEC über den vereinbarten Quoten, anderseits wurden in der USA mit der neuen Technologie des «fracking» mehr Erdöl produziert, womit der grösste Erdölkonsument weniger importieren musste.
Die OPEC hatte schon immer Schwierigkeiten mit der Festlegung von Quoten. Kleinere Produzenten plädieren bei sinkenden Preisen für eine Reduktion, weil ihre staatlichen Budgets stark von dem Erdöl abhängig sind. Auch Venezuela pochte in letzter Zeit auf Mengenbeschränkungen, da seine Wirtschaft unter sozialistischer Führung in eine schwere Krise geraten war. Saudi-Arabien als grösster Produzent hielt aber immer wieder an seiner langjährigen Politik fest, die weltwirtschaftliche Konjunktur nicht mit einer kurzfristigen Preispolitik zu beeinträchtigen und Marktanteile zu verteidigen. Da nach dem Nuklear-Abkommen von 2015 der Westen seine Sanktionen gegenüber Teheran gelockert hat, ist mit einer weiteren Zunahme der Erdölförderung zu rechnen. Wie weit die Nachfrage wegen der in der Klimakonvention gemachten Versprechen zurückgeht, wird sich erst noch weisen müssen. Die Fortschritte neuer Technologien zur Erschliessung alternativer Energiequellen sind jedoch nicht zu unterschätzen.
Zumindest bei politischen Krisen, die stets zu Preisaufschlägen geführt haben, dürften die OPEC-Länder weiterhin eine Rolle spielen. Ob sie je wieder zu der Macht kommen, die sie in der Dekade 1970-1980 ausspielen konnten, ist als eher als unwahrscheinlich zu betrachten.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (« Organisation for Economic Cooperation and Development-OECD ») folgte 1961 auf die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC). Die OEEC war 1948 ins Leben gerufen worden, um die Verteilung der amerikanischen Marshallplan-Hilfe zu koordinieren, mit der die vom Krieg zerstörten Volkswirtschaften Europas beim Wiederaufbau unterstützt wurden. Weil die Sowjetunion und ihre Satelliten den Marshall-Plan ablehnten, beteiligten sich an der OEEC nur 18 westeuropäische Länder[18]. Gegen Ende der 1950er Jahre hatte die Organisation ihre Daseinsberechtigung verloren, nachdem die westeuropäischen Wirtschaften stark zu wachsen begannen und mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sowie der Europäischen Freihandelszone (EFTA) auch das Ziel verstärkter Zusammenarbeit in Gang gekommen war.
Doch waren es gerade die USA, die sich für eine Nachfolgeorganisation stark machten, um den wirtschaftspolitischen Dialog über den Atlantik hinweg aufrechtzuerhalten. Washington ging es darum, in der Atmosphäre des Kalten Krieges den Zusammenhalt der westlichen Demokratien nicht nur im militärischen (NATO), sondern auch im wirtschaftlichen Bereich zu demonstrieren. Auch wollte man den Erfolg der Marktwirtschaft dafür nutzen, sich bei der beginnenden Entwicklungshilfe nach dem Süden zu profilieren, damit die vom Kolonialismus befreiten Länder der Dritten Welt nicht den Sirenen des Kommunismus erliegen würden.
Zu der OECD gehörten zunächst die 18 ehemaligen OEEC-Mitglieder sowie die USA und Kanada. 1964 wurde Japan aufgenommen, es folgten Finnland (1969), Australien (1971), Neuseeland (1973), Mexiko (1994) Tschechien (1995), Polen, Ungarn, Südkorea (1996), Slowakei (2000), Chile, Estland, Israel, Slowenien (2010), Lettland (2016). Damit zählt die Organisation 35 Mitglieder, die aus sehr unterschiedlichen Teilen der Welt kommen. Die wichtigsten Aufnahmekriterien haben sich nicht geändert: Achtung der Menschenrechte, demokratische Verfassung und marktwirtschaftliche Strukturen.
Hatte die OEEC ein klar umrissenes Mandat, wurde jenes der OECD weniger eindeutig formuliert. Nach ihrem Zweckartikel soll die OECD dazu beizutragen, dass in den Mitgliedländern eine optimale Politik zur Entwicklung der Wirtschaft, der Beschäftigung und des Lebensstandards gefördert wird. Zu diesem Zweck ist das Sekretariat beauftragt, mit vergleichenden Studien beste Praktiken («best practices») zu erforschen. Der «Think Tank» beschränkt sich nicht nur auf den makroökonomischen Bereich, sondern umfasst auch Themen wie Bildung, Wissenschaft, Umwelt und Sozialpolitik. Regelmässig wird die Lage in den Mitgliedstaaten untersucht, wobei es auch zu kritischen Anmerkungen kommt. Diese sind nicht einfach zu ignorieren, weil das «Peer Review-Verfahren» sanften Druck ausübt. Zudem wird den Studien des Sekretariats meistens eine hohe Qualität attestiert.
Die OECD beschränkt sich jedoch nicht nur auf Studien, sie kann auch auf praktischer Ebene tätig werden. Schon zu Beginn wurde ein eigener Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit eingerichtet (« Development Assistance Comittee-DAC «), der alle 4-5 Jahre die öffentliche Entwicklungshilfe in den einzelnen Mitgliedstaaten untersucht. Eine seiner ersten Aufgaben war die Ausarbeitung einer Definition, was überhaupt als öffentliche Entwicklungshilfe zu betrachten sei (z.B. zählen Exportkredite und militärische Hilfe nicht, Darlehen nur, wenn sie zinsbegünstigt und mit einem Schenkungselement von 25% verbunden sind, Flüchtlingshilfe bloss während des ersten Jahres der Aufnahme). Relativ früh einigte man sich im Ausschuss, für Projekte möglichst viel lokal zu beschaffen, also nicht an den Kauf von Produkten aus dem Geberland zu binden. 1995 wurde die Erklärung von Paris verabschiedet, um die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit an einer Reihe von Indikatoren zu messen. Die DAC-Ländern finanzieren über 95% der globalen Entwicklungshilfe, dafür wenden sie im Durchschnitt jedoch nur 0,4% ihres BIP auf, was deutlich unter dem UNO-Ziel von 0,7% des BIP liegt.
Die OECD wird häufig als Klub der Reichen bezeichnet, der sich für Freiheit auf den globalen Märkten einsetzt. Das ist kaum zu bestreiten, auch wenn sich die Organisation verschiedentlich bemüht hat, Fehlentwicklungen zu begegnen. Ein Bespiel dafür ist die 1989 geschaffene Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei (« Groupe d’Action Financière/GAFI -Financial Action Task Force/FATF «). Es handelt sich um ein autonomes Gremium, das 1989 von der G-7 angeregt wurde, dessen Sekretariat jedoch bei der OECD angesiedelt ist. Von ihm sind seit 1990 vierzig Empfehlungen ausgearbeitet worden, um zu verhindern, dass Gelder aus der organisierten Kriminalität weissgewaschen werden. Nach den Terrorangriffen vom September 1991 in New York wurden neun weitere Empfehlungen zu Bekämpfung der Finanzierung terroristischer Organisationen hinzugefügt. An dem Gremium nehmen 36 Staaten teil, unter denen sich auch Nicht- OECD-Länder wie Südafrika, Argentinien, Brasilien, China, Hongkong, Indien, Malaysia, Russland und Singapur befinden. Vom GAFI werden periodisch überarbeitete Tatbestände aufgelistet, die von den Mitgliedern strafrechtlich zu verfolgen sind. Jedes Mitglied hat eine Meldestelle einzurichten, die bei Verdacht auf Gelwäscherei zu informieren ist. Zwar haben die Empfehlungen keinen rechtlichen Charakter und das GAFI kann auch keine Sanktionen verhängen. Trotzdem funktioniert das System recht gut, weil auch bei ihm die für die OECD typischen Länderüberprüfungen («Peer Reviews») stattfinden und zudem weltweit schwarze Listen für nicht kooperierende Länder erstellt werden.
In der Regel arbeitet die OECD mit Empfehlungen, die im Konsens verabschiedet werden. Enthält sich ein Mitglied der Stimme, gilt für dieses die Empfehlung nicht. Die Aushandlung von völkerrechtlichen Verträgen ist eher selten. Einen solchen Versuch starteten die OECD-Mitglieder 1995 für ein Abkommen über Investitionen (« Muliteral Agreement on Investment «), das auch Nicht-Mitgliedern offenstehen sollte. Die OECD wollte das Gestrüpp tausender bilateraler Investitionsschutzabkommen lichten. Die Latte wurde recht hoch gesetzt, wie für den Handel wollte man die Prinzipien der Inländerbehandlung und der Meistbegünstigung festlegen. Bei Enteignungen sollten Unternehmen zum Marktwert entschädigt werden, bei Streitigkeiten hätte ein Schiedsgericht sowohl von Staaten als auch von Unternehmen angerufen werden können. Nicht nur der Beratungsausschuss der Industrie («Business and Industry Advisory Committee-BIAC), sondern auch jener der Gewerkschaften («Trade Union Advisory Committee-TUAC») unterstützten die Verhandlungen. Obwohl die OECD bei Fragen wie Entwicklungshilfe und Umweltschutz meistens ebenfalls die Zivilgesellschaft konsultiert, hatte man davon in diesem Falle abgesehen. Als der geheim gehaltene Entwurf nach zwei Jahren an die Öffentlichkeit gelangte, starteten NGOs in Kanada und den USA über das Internet eine Kampagne, die den Vertrag aus sozialen und umweltrechtlichen Gründen heftig kritisierte. Der Druck der Kampagne entfaltete ein derartiges Echo, dass die Verhandlungen 1998 abgebrochen werden mussten.
Eine Lehre daraus war, dass man umgehend die Leitsätze für multinationale Unternehmen zu revidieren begann und dafür auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammenarbeitete. Eine erste Version der Leitlinien war in der OECD bereits 1976 vereinbart worden, seither wurden diese in periodischen Abständen ergänzt. Heute bestehen sie aus zehn Kapiteln: Transparenz, Menschenrechte, Arbeitsbeziehungen, Umwelt, Korruption, Konsumentenschutz, Technologietransfer, Wettbewerb und Besteuerung. Darin werden Unternehmen aus den Unterzeichnerstaaten aufgefordert, Normen aus internationalen Verträgen in ihren Filialen auf der ganzen Welt einzuhalten und dasselbe von ihren Lieferanten zu verlangen. Auch sollen sie sich an die lokalen Gesetzte halten und mit den entsprechenden Regierungen offen zusammenarbeiten. Rechtlich sind die Leitlinien nicht verbindlich, jeder Unterzeichnerstaat hat aber bei einer Regierungsinstanz eine Kontaktstelle einzurichten, welche die Umsetzung der Leitsätze fördern soll und bei Beschwerden ein Schlichtungsverfahren einzuleiten hat. Kommt man damit nicht zu einem positiven Ergebnis, muss die Instanz öffentlich bekannt machen, dass das Unternehmen die Leitsätze verletzt hat. Die Kontaktstellen haben jährlich Berichte an die OECD zu erstellen, worauf diese nach dem üblichen «Peer Review»-Verfahren von den teilnehmenden Staaten überprüft werden. Die Leitlinien sind neben den OECD-Mitgliedern auch von Ägypten, Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Jordanien, Kolumbien, Litauen, Marokko, Peru, Rumänien und Tunesien unterzeichnet worden.
Bezüglich multilateraler Verträge konnte die OECD 1997 erfolgreich die Konvention über die Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr aushandeln. Der Konvention sind alle Mitgliedstaaten sowie Argentinien, Brasilien, Bulgarien, Kolumbien und Russland beigetreten. Der Text verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, die Bestechung von Amtsträgern strafrechtlich mit bis zu 5 Jahren Gefängnis zu verfolgen. Ähnliche Abkommen sind auch im Europarat und in der UNO ausgehandelt worden. Selbst die NGO «Transparency International» räumt jedoch ein, dass die OECD-Konvention über den wirksamsten Überwachungsmechanismus verfügt. Das übliche «Peer Review»- Verfahren prüft zunächst, ob die eingeführten Strafbedingungen den Verpflichtungen der Konvention entsprechen. Darauf wird mit dem gleichen Verfahren periodisch untersucht, ob diese auch effektiv umgesetzt werden. Aufgrund dieser Ergebnisse werden Empfehlungen an einzelne Staaten gerichtet, um die Situation zu verbessern.
Nach dem Ausbruch der Finanzkrise von 2008 hat sich die OECD vermehrt mit Steuerfragen beschäftigt. Sie wirkt in diesem Bereich als Sekretariat der G-20. Von ihm werden die eigentlichen Vorschläge ausgearbeitet, die anschliessend der G-20 zur Genehmigung unterbreitet werden. Zahlreiche Staaten, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben, sind mehr denn je interessiert, die Evasion von Steuern zu bekämpfen. Deshalb wurde 2014 das Instrument des Automatischen Informationsaustausches-AIA in Steuersachen verabschiedet. Gemäss diesem müssen Finanzinstitutionen ihre ausländischen Inhaber von Konten, deren Bestand und Bewegungen jährlich den nationalen Steuerbehörden melden, von denen die Informationen an die jeweiligen Staaten weiterzuleiten sind. Die Informationen dürfen nur für Steuerzwecke verwendet werden. Dem System haben sich seither 97 Staaten angeschlossen, 56 werden mit dem Austausch 2017 beginnen, 41 Staaten ab 2018. Zur Überwachung wurde eine bereits bestehende Arbeitsgruppe der OECD geöffnet und in « Global Forum « umbenannt. An ihr beteiligen sich inzwischen 135 Staaten, die eine einheitliche Anwendung der Amtshilfestandards sicherstellen sollen.
Ferner entwickelte die OECD 2015 Richtlinien, um die Steuerkürzung und Gewinnverschiebung (« Base Evasion and Profit Shifting-BEPS) multinationaler Unternehmen zu unterbinden. Sie beruhen auf dem Grundsatz, dass Steuern dort zu bezahlen sind, wo der Mehrwert erwirtschaftet wird. Solche Unternehmen dürfen folglich nicht mehr über konzerninterne Darlehen und künstliche Transferpreise Gewinne nach steuergünstigeren Ländern verschieben. Sie müssen offenlegen, wo und mit welchen Mitteln sie ihre Produktion getätigt haben.
Dass es der OECD immer wieder gelingt, über Empfehlungen und Richtlinien («soft law») Staaten zur Änderung ihrer nationalen Gesetze zu bewegen und deren Umsetzung mit einem Überwachungsmechanismus zu kontrollieren, ist bemerkenswert. Zweifelsohne ist die manchmal verpönte Denkfabrik zu einem bedeutenden Akteur in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen geworden. Ihr Prestige erklärt, warum sich Länder aus unterschiedlichen Zonen der Welt um eine Mitgliedschaft bemühen. Nächstens dürfte Kolumbien aufgenommen werden, mit Costa Rica und Litauen wird verhandelt, Argentinien, Peru und Malaysia haben Interesse an einem Beitritt bekundet. Zwischen den grossen Schwellenländern Brasilien, China, Indien, Indonesien, Südafrika und der OECD besteht ein partnerschaftlicher Dialog, der in der Regel als Vorstufe für die Mitgliedschaft gilt. Dabei stellt sich allerdings das Problem, wie man die bisher gültige Bedingung demokratischer Strukturen handhaben wird.
Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich-BIZ (« Bank for International Settlements-BIS «) entstand 1930, nachdem die Reparationszahlungen Deutschlands mit dem Young-Plan neu geregelt worden waren. Einerseits sollten die jährlich fälligen Abgeltungen über die neue Institution abgewickelt werden, anderseits wollte man die Zusammenarbeit unter den Zentralbanken fördern. Mit der Machtübernahme der National-Sozialisten in Berlin geriet die Bank stark unter deutschen Einfluss. So nahm sie nach dem Anschluss von 1938 die Goldreserven der österreichischen Zentralbank an. Während des zweiten Weltkrieges erfolgte das auch für Reserven anderer Zentralbanken, deren Länder von der Wehrmacht überrennt worden waren. Berlin soll sogar Gold hinterlegt haben, das von Opfern aus den Konzentrationslagern stammte.
Deshalb wollten die Amerikaner nach dem Krieg die «nazifreundliche» Bank auflösen. John Maynard Keynes, der englische Unterhändler in Bretton Woods, plädierte für deren Weiterbestehen. Erst 1948, als mit Truman eine neue Administration in das Weisse Haus einzog, einigte man sich darauf, die Bank nicht zu schliessen, sondern deren Aufgaben neu zu definieren. Seither hat sie die Entwicklung der internationalen Finanzmärkte zu verfolgen, die dafür notwendigen Statistiken zu sammeln und Auswirkungen auf die Finanzstabilität zu untersuchen. Daneben dient sie als Plattform für den periodischen Meinungsaustausch unter den Zentralbankgouverneuren. Einmal jährlich treffen sich die Vertreter aller Mitglieder, zu denen derzeit 60 Zentralbanken oder Währungsbehörden aus allen Kontinenten gehören.[19] Diese wählen für drei Jahre den aus 21 Zentralbankgouverneuren bestehenden Verwaltungsrat, der sich alle 2 Monate am Sitz der Bank in Basel trifft.
Die BIZ wird manchmal als Zentralbank der Zentralbanken bezeichnet, was sie nicht ist. Allerdings hinterlegen verschieden Zentralbanken etwa 10% ihrer Währungsreserven bei der BIZ. Während den festen Wechselkursen unter dem Bretton Woods System konnte die Bank mehrmals bei Krisen kurzfristige Hilfe koordinieren. Ab 1950 waltete die BIZ als Clearing-Stelle der europäischen Zahlungsunion, die 1958 zur Konvertibilität der beteiligten Währungen führte. Als die Europäische Gemeinschaft den Plan eines stufenweisen Aufbaus ihrer Währungsunion in die Wege leitete, tagten die Experten des Delors-Komitees häufig am Sitz der Bank in Basel.
Nachdem 1971 die USA die Goldkonvertibilität nicht mehr aufrechterhalten konnten und es zu flexiblen Wechselkursen kam, gerieten zwei international bedeutende Banken (die deutsche Herstatt und die amerikanische Franklin National Bank) in Konkurs. Als Folge davon wurde 1974 in der BIZ der sogenannte Basler Ausschuss für Bankenaufsicht gegründet, der 1988 erstmals gemeinsame Regeln für die Kapitalerfordernisse der Banken aufstellte (Basel I). In der Finanzkrise von 1997-1998 erwiesen sich diese als ungenügend und wurden 2004 entsprechend der Risikopositionen weiter verschärft (Basel II). Das gleiche Szenario erfolgte 2010 nach der Krise von 2007-2008 (Basel III)[20].
Schon 1999 wurde auf Betreiben der G-7 das Forum für finanzielle Stabilität eingerichtet, das sich nicht nur mit der Solidität einzelner Banken, sondern auch mit systemische Risiken in den globalen Finanzstrukturen befassen sollte. Da sich das Forum nur aus den G-7 Staaten und einigen industrialisierten Ländern zusammensetzte, fehlte ihm die notwendige Legitimität, um weltweite Normen auszuarbeiten. Am Gipfel der G-20 in London wurde deshalb beschlossen, das Forum in den Rat für Finanzstabilität (« Financial Stability Board «) umzuwandeln, in dem auch Länder wie Argentinien, Brasilien, China, Indien, Indonesien, Korea, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika und die Türkei vertreten sind. Der Rat, der aus 24 Mitgliedern besteht, untersteht formell der G-20, dessen Sekretariat ist aber bei der BIZ angesiedelt.
Das Board hat ähnlicher Aufgaben wie das Forum. Es soll die verschiedenen Organe für die Bankenaufsicht koordinieren. Seine Makro- Aufgabe hat es bisher vor allem auf die 30 international tätigen Banken gerichtet, die als systemrelevant gelten. Für diese sind 2015 Kapitalvorgaben aufgestellt worden, die über Basel III hinausgehen und von der G-20 im gleichen Jahr genehmigt wurden. Die 30 Banken müssen bis 2019 ein Verlustpolster von 16% der Aktiva und 6% der Bilanzsumme aufbauen, bis 2022 sind die beiden Mindeststandards («Total Loss Absorbing Capacity-TLAC») auf 18%, beziehungsweise 6,75% zu erhöhen. Damit soll bei Krisen sichergestellt werden, dass die «too big to fail» Banken nicht mehr über Steuergelder gerettet werden müssen, sondern mit eigenen Mitteln stabilisiert oder abgewickelt werden können. Der Rat beschäftigt sich inzwischen auch mit Finanzakteuren ausserhalb des regulären Bankensystems (Schattenbanken, Versicherungen, Wertpapierhandel, Devisengeschäften). In diesen Bereichen arbeitet er namentlich mit der Dachorganisation der Wertpapieraufsichtsbehörden («International Organization of Securities Commissions-IOSCO») und der internationalen Vereinigung der Versicherungsaufsichtsbehörden («Internationale Association of Insurance Supervisors-IAIS) zusammen.
Das «Financial Stability Board» überwacht die Umsetzung seiner Standards mit «Peer Reviews» und kann auch Listen nicht-kooperierender Finanzplätze erstellen. Wie die OECD arbeitet es mit rechtlich nicht verbindlichen Richtlinien («soft law»), die aber in der Praxis stärker als manche völkerrechtlichen Verträge zur Anwendung gelangen.
9. Zukunft mit Fragen
Die Bankenkrise von 2008 hat die Weltwirtschaft in eine schwere Krise gestützt. In den Industriestaaten kam es zu negativen Wachstumszahlen. Auch die aufstrebenden Schwellenländer erlitten eine spürbare Verlangsamung. Die Folge davon war ein Rückgang der Rohstoffpreise, was andere Entwicklungsländer in Bedrängnis brachte.
Zweifelsohne ging die Globalisierung von den westlichen Industriestaaten aus. Inzwischen befinden sich aber gerade diese in einer unbequemen Lage. Extremistische Linksgruppen haben am Gipfel der G-20 von 2017 in Hamburg erneut ihre Gewaltbereitschaft unter Beweis gestellt. Gleichzeitig gewinnen nationalistische Rechtsparteien bei Wahlen grösseren Zulauf. Sie beschwören Heimat, bekämpfen die Migration und haben wenig Sympathie für die Globalisierung. Der harte Kern der Wähler von Donald Trump agiert mit ähnlichen Parolen. Auch das britische Referendum über den Austritt aus der EU hatte mit der Immigration zu tun.
Während sich aber die konservative Regierung in London als liberale Handelsmacht ausserhalb der EU profilieren will, setzt der neue amerikanische Präsident auf den Merkantilismus, um für sein Land ausgeglichene Handelsbilanzen zu erreichen. Wer nach verbleibenden Anhängern der Globalisierung sucht, muss sich neuerdings in südliche Gefilde begeben. Dort stand Freihandel und Kapitalismus über Jahrzehnte unter Beschuss. Nach den Erfolgen des kommunistischen Regimes in Peking sind jedoch gerade unter den ärmeren Ländern die überzeugtesten Anhänger einer freien Weltwirtschaft zu finden.
Dass die Globalisierung in den alten Industriestaaten neben Gewinnern auch Verlierer verursacht hat, ist nicht zu bestreiten. Am stärksten betroffen sind wenig qualifizierte Arbeitskräfte, da einfache Produktionsprozesse vermehrt nach Billiglohnländern auslagert worden sind. Enttäuscht ist auch die Mittelschicht, weil deren Einkommen seit zwei Jahrzehnten stagnieren. Zu den grössten Gewinnern der Globalisierung gehören Kapitaleigner und Spitzenmanager. Eine Studie der amerikamischen Zentralbank (FED) hat für 2017 ergeben, dass das oberste Prozent der Amerikaner über 23% aller Einkommen und über 33% aller Vermögenswerte verfügt.
Die Ungleichheiten haben sich nicht nur in den USA, sondern in praktisch allen westlichen Industrieländern erhöht. Der Gini-Koeffizient, der die Verteilung von Einkommen und Vermögen misst (1 = völlige Ungleichheit, 0 = völlige Gleichheit) ist in den USA und Grossbritannien von 0,3 auf 0,4 gestiegen. Ähnliche, wenn nicht sogar grössere Zunahmen gibt es auch in anderen Ländern. Nur in Nordeuropa (Deutschland, Niederlande, Dänemark, Schweden, Norwegen, Schweiz) hat sich der Gini-Koeffizient etwas weniger erhöht (Milanovic; 2016). Sicher hat die wachsende Kluft zwischen Armen und Reichen zu den jüngsten Wahlerfolgen populistischer Bewegungen beigetragen. Das ist umso bedenklicher, als einige von ihnen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht besonders hoch einschätzen.
Dagegen hat sich die Ungleichheit zwischen den Staaten leicht abgeschwächt. Zurückzuführen ist das auf den raschen Anstieg der Mittelschicht in den Schwellenländern. 1990 lebte noch 35% der Weltbevölkerung in extremer Armut, seither ist deren Zahl auf 10% gesunken. Mehr als eine Milliarde Menschen vermochten der extremen Armut zu entfliehen. Das ist vor allem den dynamischen Volkswirtschaften Chinas, Indiens und anderer asiatischen Staaten zu verdanken. Aber auch in einigen Ländern Südamerikas hat sich die Situation verbessert. Weniger spürbar ist der Trend im Mittleren Osten und im südlichen Afrika. Trotzdem schätzt die OECD, dass die Mittelschicht weltweit bis 2030 auf über 5 Milliarden Menschen zunehmen dürfte.
Überdurchschnittlich haben die Superreichen von der Globalisierung profitiert. Von Forbes wird die Zahl der Milliardäre auf etwa 1500 geschätzt. Mehrheitlich stammen sie aus den alten Industrieländern, doch gibt es solche immer mehr auch in Schwellenländern. Gesamthaft wird deren Reichtum auf über 6’000 Milliarden USD geschätzt. Das ist mehr als die zweijährige Wirtschaftsleistung der afrikanischen Länder südlich der Sahara (Milanovic; 2016). Dennoch verfügen dort korrupte Politiker weiterhin über genügend Mittel, um sich periodisch wiederwählen zu lassen. In postindustriellen Demokratien wird dagegen die Konzentration des Reichtums mehr und mehr zu einem politischen Zündstoff. Vereinzelt gibt es Versuche, Korrekturen anzubringen, die jedoch bisher nur wenig verändert haben.
Der amerikanische Milliardär Donald Trump erklärte in seinem Wahlkampf, er werde die 6 Millionen Arbeitsplätze, die in der heimischen Industrie seit 2000 verloren gegangen seien, wieder nach Amerika zurückbringen. Das Versprechen war wohl ausschlaggeben für seine knappe Wahl ins Weisse Haus. Vor allem kritisierte er die von seinen Vorgängern «miserabel» ausgehandelten Freihandelsverträge. Sofort nach seinem Amtsantritt kündigte er den pazifischen Partnerschaftsvertrag, den sein Vorgänger noch ratifizieren wollte. Auf die Abschussliste setzte er ebenfalls den nordamerikanischen Freihandelsvertrag (NAFTA), erst nach langem Zögern stimmte er zögernd Neuverhandlungen zu. Auch gegenüber Südkorea fordert er, dass der bilaterale Vertrag von 2012 zugunsten der USA verbessert werden müsse. Bei den Gesprächen über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen mit der EU, die Obama begonnen hatte, herrscht vorläufig Funkstille. Einzig Peking, das während seines Wahlkampfes noch im Vordergrund stand, scheint bisher etwas gnädiger davon zu kommen. Wohl aus politischen Gründen (nordkoreanisches Atomprogramm) bemüht sich Trump bis auf weiteres um eine bei ihm nicht übliche Vorsicht.
Ob seine polternde Politik zum Erfolg führen wird, ist mit guten Gründen zu bezweifeln. Zahlreiche Untersuchungen von Ökonomen sind zum Schluss gekommen, dass 80% der Arbeitsplätze, die in der amerikanischen Industrie verloren gingen, nicht auf Freihandelsverträge, sondern auf den technologischen Fortschritt zurückzuführen sind. Wenn Trump auf «astronomische» Handelsbilanzdefizite mit China, Südkorea, Deutschland und anderen Ländern verweist, blendet er gerne die Dienstleistungsbilanz aus, die für die USA häufig positiv ist, auch wenn damit die Defizite des Warenhandels nicht ausgeglichen würden.
Der frühere Geschäftsmann sollte jedoch wissen, dass Industriearbeit in postindustriellen Ländern nur zu erhöhen ist, wenn wenig Qualifizierte umgeschult werden, um ihnen neue Möglichkeiten zu eröffnen. Bezeichnend ist, dass einige Grosskonzerne bereits daran denken, dank Robotern serienmässige Produktionsprozesse wieder in ihr Ursprungsland zurückzuholen. Sicher kann Trump damit rechnen, dass mit seiner Reduktion der Unternehmenssteuer amerikanische Grosskonzerne mindestens einen Teil ihrer im Ausland gelagerten Gewinne repatriieren werden. Ungeachtet dessen wird sich ihm die Frage stellen, wie er mit geringeren Steuereinnahmen andere seiner Vorhaben (Steigerung der Militärausgaben, Infrastrukturprojekte, Bau der Mauer an der mexikanischen Grenze) erfüllen kann, ohne die schon jetzt hohe Staatsverschuldung seines Landes zu erhöhen.
Kurz nach Trumps Wahl verteidigte Chinas Präsident Xi Jinping am Davoser Weltwirtschafsforum von 2017 den freien Welthandel. Mit seinem Satz «Protektionismus heisst, sich in einer dunklen Kammer einzuschliessen» sicherte er sich den Applaus der globalen Wirtschaftsführer. Dabei ging es Xi Jinping nicht nur darum, für den Export von Billigprodukten seines Landes offene Grenzen zu erhalten. China hat in den letzten Jahren enorme technologische Fortschritte gemacht. Durch zahlreich Übernahmen ausländischer Firmen hat es sich viel technologisches Wissen angeeignet, auch wenn es ausländische Firmen im eigenen Land nach wir vor diskriminiert. Während sich aber Trump aus der Pariser Klimakonvention verabschiedete, um den Kumpeln in Kohlewerken aus dem 19. Jahrhundert ihre Arbeitsplätze zu erhalten, investiert Peking fast drei Mal mehr als die USA in Technologien für saubere Energie. Das Land ist in Solar- und Windenergie zu einem führenden Anbieter auf dem Weltmarkt geworden. Auch bei den Informationstechnologien ist es ihm gelungen, an der Spitze mitzumischen.
Trumps Politik des « America first» stosst selbst bei alten Verbündeten auf wenig Verständnis. Die verbliebenen Teilnehmer an der Transpazifischen Partnerschaft (TPP)[21] suchen nach einer Lösung, um das Abkommen ohne die USA in Kraft zu setzen. Da neue Länder sich um einen Beitritt bewerben, scheint das nicht unmöglich zu sein. China, das beim TPP nicht berücksichtigt worden ist, will dagegen sein Projekt der «Regional Comprehensive Economic Partnership» (RCEP) voranzutreiben.
Die Europäische Union ist zurzeit durch die Verhandlungen über den Brexit absorbiert. Die konservative Regierung in London beteuert bei jeder Gelegenheit, sie werde sich nach dem Austritt noch stärker für den globalen Freihandel einsetzten. Das gleiche Ziel verfolgt aber auch die EU. Mit Japan und dem Mercosur hat sie Ende 2017 neue Freihandelsverträge abgeschlossen. Gleichzeitig gibt es intensive Verhandlungen mit Indien, Indonesien, Thailand, Malaysia und den Philippinen. Mexiko ist seinerseits bereit, den bestehenden Freihandelsvertrag mit der EU zu vertiefen.
Die Vermutung liegt nahe, dass der globale Führungsanspruch der USA unter Druck kommt. Denn wirtschaftlich haben sich die Gewichte stark verschoben. China ist heute nicht nur die grösste Exportnation der Welt, zu Marktpreisen entspricht seine Wirtschaftsleistung bereits 65% von jener der USA. Zwar bleibt das Pro-Kopfeinkommen noch sieben Mal tiefer, kaufkraftbereinigt liegen beide Werte jedoch deutlich höher. Für einige Experten könnte China in 15 Jahren die USA als stärkste Wirtschaftsmacht der Welt ablösen. Auch wenn die chinesischen Wachstumsraten in den nächsten Jahren zurückgehen sollten, ist davon auszugehen, dass dies spätestens in 30 Jahren der Fall sein wird.
Historiker haben ausgerechnet, dass es in den vergangenen 500 Jahren 16 Mal zu einem Wechsel der Hegemonialmacht gekommen ist, wobei das in 12 Fällen durch einen Krieg erfolgte. Zu den vier, die friedlich verliefen, gehört die letzte Transition von Grossbritannien auf die USA nach dem 2. Weltkrieg. Vorläufig kann man nur spekulieren, ob das auch zwischen den USA und China so verlaufen würde. Militärisch werden die USA noch für Jahre an der Spitze bleiben. Washington gibt jährlich 600 Mrd. USD für seine Streitkräfte aus, in China sind es laut offiziellen Angaben nur 200 Mrd. USD. Zurzeit scheinen sich Chinas Machtansprüche auf seine asiatischen Nachbarn zu beschränken, was bei den Streitigkeiten über das chinesische Meer zum Ausdruck kommt. Global konzentriert sich dagegen die Führung in Peking auf den Ausbau ihrer Wirtschaftsmacht. Die kommunistische Einheitspartei ist sich bewusst, dass sie nur überleben kann, wenn sie ihre Bürger jährlich mit grösserem Wohlstand versorgt. Auch dürfte sich China bewusst sein, dass ein Krieg zwischen zwei Nuklearmächten für beide Seiten mit fatalen Folgen enden würde.
Doch hat sich Rationalität in der Geschichte noch nie als sichere Leitplanke erwiesen. Bedenkt man, dass in den letzten Jahren über eine Milliarde Menschen des Südens zu mehr Kaufkraft gekommen sind, sollte das allgemein als höchst erfreulich empfunden werden. Das scheint jedoch Trump nicht verinnerlicht zu haben. Der ehemalige Immobilienguru will alle in die Knie zwingen, um für sich den besten Preis herauszuholen. Damit stellt er die liberale Wirtschaftsordnung in Frage, die seine Vorgänger nach dem 2. Weltkrieg errichtet haben.
Damals ergatterte sich die neue Hegemonialmacht zwar einige Privilegien, die jedoch nicht völlig gratis waren. Anderseits ernteten jene, die dem liberal-multilateralen Ansatz folgten, enorme Fortschritte. Hingegen zahlte die kommunistische Welt für ihr Abseitsstehen einen hohen Preis. Die Verschiebung der wirtschaftlichen Gewichte in den letzten drei Jahrzehnten bedeutet nicht, dass alte Rezepte ausgedient hätten. Sie müssen aber an die neuen Verhältnisse angepasst werden. Das gilt sowohl für den wirtschaftlichen wie den politischen Bereich. Leider scheint die gegenwärtige Konjunktur selbst für kleine Reformen, geschweige denn für grosse Würfe nicht sehr vorteilhaft zu sein.
Was die Grundpfeiler der liberalen Wirtschaftsordnung betrifft, klammern sich nicht nur die USA, sondern auch viele westliche Staaten an ihre Vormachtstellung, die aus einer Zeit stammt, als sie noch unter sich waren. Zwar einigte man sich 2010 im Währungsfonds auf eine Erhöhung der Quoten zugunsten der aufstrebenden Schwellenländer. Chinas Quote wurde von 3.81 auf 6.16% erhöht, auch jene der anderen BRICS – Länder erhielten eine Aufstockung. Damit rückten China, Indien, Russland und Brasilien zu den zehn wichtigsten Mitgliedern des IWF auf. Doch bleiben die Stimmanteile weiterhin sehr unterschiedlich[22]. Für wichtige Entscheide, zu denen auch die Anpassung der Quoten gehört, verfügen die USA mit 16.73% nach wie vor über ein Veto-Recht.
Zwar mussten die übervertretenen Länder Europas Federn lassen. Sie verloren zwei Sitze im Exekutivdirektorium, in dem neben den USA, Japan, Deutschland, Frankreich und Grossbritannien auch China, Indien und Russland einen ständigen Sitz erhalten haben. Die übrigen Vertreter im 24-köpfigen Gremium müssen aus den Stimmrechtsgruppen gewählt werden. Mit der Summe ihrer Quoten könnten die EU-Länder zwar auf eine Sperrminorität kommen, sie sind aber bisher im Fonds nur selten geschlossen aufgetreten. Es brauchte schon Absprachen gewichtiger EU-Mitglieder mit den gestärkten BRICS-Staaten, um die Amerikaner unter Druck zu bringen.
Obwohl die USA ihr Veto-Recht behielten, blockierten die Republikaner im Kongress bis 2015 die Zustimmung zu der Reform, die damit erst 2016 in Kraft treten konnte. Zu diesem Zeitpunkt wäre bereits die nächste Überprüfung fällig gewesen, die in der Regel alle fünf Jahre stattfindet. Notgedrungen musste sie auf 2019 verschoben werden. Ob dabei auch eine Änderung der Kriterien für die Zuteilung der Quoten zur Sprache kommt, dürfte eher unwahrscheinlich sein.
2009 hatten die Industriestaaten am Gipfel der G-20 in London versprochen, die Direktoren von Währungsfonds und Weltbank künftig aufgrund fachlicher Qualitäten auszuwählen. Das bedeutete zwischen den Zeilen, bei den nächsten Wahlen nicht mehr an der bisherigen Absprache festzuhalten, dass der Direktor des Währungsfonds immer ein Europäer zu sein hat und das Präsidium der Weltbank für einen Amerikaner reserviert ist. 2011 wurde jedoch mit Christine Lagarde erneut eine aus Europa stammende Vertreterin an die Spitze des Währungsfonds berufen, ein Jahr später folgte auch in der Weltbank ein Amerikaner auf einen Amerikaner, obwohl Jim Yong Kim südkoreanische Wurzeln hat. Das heisst nicht, dass bei den Wahlen nicht fachlich ausgewiesene Persönlichkeiten zum Zuge kamen. Von vielen Seiten wird etwa anerkannt, dass sich namentlich Lagarde ehrlich bemüht, aus vergangenen Fehlern des Fonds Lehren zu ziehen. Mit Blick auf das Versprechen von 2009 bleibt dennoch ein schaler Geschmack zurück. Die Länder des Südens haben keine andere Wahl, als bei nächsten Ablösungen erneut valable Kandidaten zu präsentieren, von denen es auch bei ihnen einige gibt.
Nach langjährigen Bemühungen erzielte immerhin China einen Erfolg, als 2016 der Yuan neben dem Dollar, dem Euro, dem Yen und dem britischen Pfund in den Korb der IWF-Reservewährungen aufgenommen wurde. Gemäss den Regeln über die Sonderziehungsrechte können nun Empfänger von IWF- Krediten einen Teil davon in Yuan beziehen. Im Gegenzug wird von China erwartet, seine Währungspolitik und die Vorschriften über den Kapitalverkehr zu lockern. Beim Wechselkurs ist das geschehen, für Finanztransaktionen bestehen aber weiterhin Hindernisse. Deswegen ist der Anteil des Yuan als Zahlungsmittel für den Handel und Kapitalverschiebungen mit 4% noch immer sehr tief. An der Spitze bleibt der Dollar (42%), gefolgt vom Euro (31%), dem britischen Pfund (11%) und dem japanischen Yen (9%). Schon aus politischen Gründen dürfte sich jedoch China alle Mühe geben, möglichst rasch wenigstens zum japanischen Yen aufzuholen.
Gleichzeitig mit dem IWF kam es 2010 auch bei der Weltbank zu einer Quotenreform. Diese verlief weniger kontrovers, obwohl die Stimmrechte der Schwellen- und Entwicklungsländer gesamthaft nur um 3,13% erhöht wurden. Zu erklären ist das mit der Quotenregelung in der Weltbank, bei der zu 80% das Gewicht der Wirtschaftsleistung zählt, zu 20% aber auch die Beiträge für die periodisch aufgestockten Mittel der «International Development Association-IDA» (internationale Entwicklungsorganisation) berücksichtigt werden. Bei diesen gehören die alten Industriestaaten immer noch zu den wichtigsten Gebern. Unter dem Strich verfügen die Schwellen- und Entwicklungsländer nun über einen Stimmenanteil von 47,19%. Mit 16,28% verbleiben die USA an der Spitze, gefolgt von Japan (7,02%), China (4,55%), Deutschland (4,17%), Grossbritannien (3,85%), Frankreich (3,85%, Indien (2,98%) sowie Russland und Saudi-Arabien (je 2,84%).
Zurzeit verweigert die Administration Trump der Bank jegliche Erhöhung ihrer Finanzmittel. Die Begründung lautet, die Bank unternehme zu wenig für die Förderung der Privatwirtschaft in den Entwicklungsländern. Andere Stimmen aus dem Westen bemängeln, die Tätigkeiten der Bank seien zu stark verzettelt. Überschneidungen bestanden schon seit langem mit den regionalen Entwicklungsbanken. Hinzu kommt, dass in jüngster Zeit gerade die Schwellenländer neue Konkurrenz geschaffen haben. So haben die BRICS-Staaten 2015 eine eigene Entwicklungsbank mit einem Starkapital von 50 Mrd. USD gegründet.[23].
Noch bedeutender wird die asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank sein, die China 2013 lanciert hatte und 2016 operationell geworden ist. Ihr Starkapital beträgt 100 Mrd. USD und ist nach dem Vorbild der Weltbank strukturiert. Das heisst, dass Quoten und Stimmrechte nach der jeweiligen Wirtschaftskraft der Mitglieder zugeteilt werden. Mit ihrem Ziel, die alte Seidenstrasse wieder zu beleben und dafür zu Land, Luft und See von Asien bis nach Afrika und Europa milliardenschwere Infrastruktur-Projekte zu finanzieren, übt sie einige Anziehungskraft aus. So sind ihr – trotz dem Widerstand der USA – auch die Mehrzahl der europäischen Staaten beigetreten.
Die Weltbank bleibt jedoch mit 60 Mrd. pro Jahr der grösste Akteur der internationalen Entwicklungshilfe. Ausserdem scheinen alte und neue Konkurrenten nicht unbedingt auf Konfrontationskurs zu gehen. Jedenfalls haben sie kürzlich in einer gemeinsamen Erklärung unterstrichen, komplementär zusammenarbeiten zu wollen. Wie konkret das erfolgen wird, muss sich noch weisen.
Die Welthandelsorganisation folgte 1995 auf das Allgemeine Zoll-und Handelsabkommen (GATT). Trotz grossen Ambitionen ist ihre Bilanz bisher eher enttäuschend ausgefallen. Zwar sind ihr eine Reihe neuer Mitglieder beigetreten, doch ist die 2001 in Doha initiierte Entwicklungsrunde nach mehr als 15 Jahren keinen Schritt vorangekommen. Kritiker führen das auf den komplexen Entscheidungsprozess der Organisation zurück. Zwar könnten aufgrund der Statuten qualifizierte Mehrheitsentscheide getroffen werden, grundsätzlich wird aber am Konsens-Prinzip festgehalten. Experten schlagen deshalb vor, wie bei den Bretton Woods Institutionen eine Stimmgewichtung nach wirtschaftlicher Bedeutung einzuführen und diese mit einer doppelten Mehrheit (Stimmen + Mitglieder) zu ergänzen.
Die Frage ist, ob damit nicht ein zweischneidiges Schwert geschaffen würde. Viele Entwicklungsländer, die sich der WTO mit grossen Hoffnungen angeschlossen haben, werden in Bezug auf Wirtschaftsleitung und Beteiligung am Welthandel noch lange marginal bleiben. Obwohl die ärmsten unter ihnen für den Marktzugang Privilegien erhalten haben, werden sie für den Aufbau neuer Industrien von den Subventions-Verboten der WTO eingeschränkt. Ihnen ohne ihre Zustimmung neue Liberalisierungsschritte aufzudrängen, dürfte sich auf die Mitgliedschaft kontraproduktiv auswirken. Für die alten Industriestaaten besteht dagegen das Risiko, mittelfristig in die Minderheit zu geraten. Zwei Drittel der WTO-Mitglieder stammen aus den Ländern des Südens, ihre Wirtschaftskraft nähert sich der 50%-Grenze. Somit ist es durchaus möglich, dass eine Gewichtung der Stimmen in nicht allzu ferner Zukunft zu einer Mehrheit der südlichen Hemisphäre führen könnte.
Die Doha-Runde kommt nicht voran, weil viele Industrieländer wenig Bereitschaft zeigen, ihre Agrarsubventionen abzubauen. Deshalb wurden in den letzten Jahren nur zwei Abkommen im Konsens verabschiedet. Beide sind zwar nicht unbedeutend, stellen aber bei weitem nicht einen Durchbruch dar. Das eine betrifft die Vereinfachung von Zollabfertigungsmassnahmen, auf das man sich 2013 in Bali einigte. Das zweite erfolgte 2015 und verpflichtet alle Mitgliedstaaten, bis 2020 alle Subventionen für den Export von Agrarprodukten abzuschaffen.
Wegen der mageren Fortschritte der WTO haben zahlreiche Staaten neue Freihandelsabkommen ausgehandelt. Gesamthaft soll deren Zahl auf über 500 gestiegen sein. Schon zu Zeiten des GATT wurden solche Abkommen nicht als Verstoss gegen die Nichtdiskriminierung gewertet. Vielmehr betrachtete man Freihandelsabkommen und Zollunionen als Vorreiter zur Förderung des freien Handels. Vergleicht man deren Zunahme mit den zwei Abkommen der WTO, ist jedoch offensichtlich, dass die Genfer-Organisation in ihrem zentralen Geschäftsbereich ins Abseits geraten ist.
Bleibt der Durchbruch bei der Doha-Runde aus, muss die WTO wohl einige ihrer Verhandlungsprinzipien ändern. Noch heute gilt das Prinzip des « single undertaking », wonach es für jedes neue Abkommen die Zustimmung aller Mitglieder braucht. Will die WTO wieder zu einem aktiven Verhandlungsforum werden, kommt sie nicht darum herum, den flexibleren Methoden der bilateralen oder regionalen Freihandelsverträge nachzuahmen. Erste Schritte in diese Richtung sind bereits unternommen worden. So ist der ausgeweitete Zugang zum öffentlichen Auftragswesen nur für eine Gruppe vertragswilliger Mitglieder beschlossen worden. Das Gleiche gilt für das Abkommen der weiteren Öffnung des Dienstleistungsverkehrs.
Was aber bei der WTO funktioniert, ist das neue Streitbeilegungsverfahren. Seit 1995 haben die dafür eingesetzten Gremien mehr als 400 Fälle behandelt. Natürlich gibt es bei jedem Schiedsspruch eine unterlegene Partei, die nicht sehr glücklich ist. Doch wird das griffige Verfahren allgemein geschätzt. Das ist umso wichtiger, als es nach dem Ausbruch der Wirtschaftskrise von 2008 vermehrt zu protektionistischen Massnahmen gekommen ist. Gemäss dem WTO-Sekretariat sind seither über 3’000 handelshemmende Barrieren eingeführt worden.[24] Allein die neue Administration in Washington soll seit ihrem Amtsantritt über 190 solcher Massnahmen getroffen haben. Da Trump einige Urteile der Schiedsorgane als ungerecht empfindet, möchte er für die Lösung von Streitfällen wieder auf das alte GATT- Verfahren zurückkommen, das nie sehr effizient gewesen war.
Wie bereits gesagt, drängen sich Reformen nicht nur bei wirtschaftlichen, sondern auch bei politischen Organisationen auf. In erster Linie betrifft das den UNO - Sicherheitsrat, der schon lange unter Kritik steht. Von den fünf Vetomächten stammen drei aus dem Westen, die jedoch nur mehr 18% der Weltbevölkerung repräsentieren. 1993 setzte die Generalversammlung eine «open ended working group»[25] ein, um Reformvorschläge für die Erweiterung, Beschlussfassung und Arbeitsmethoden des Sicherheitsrates auszuarbeiten.
Drei Jahre danach unterbreitete der Präsident der 62. Generalversammlung, der Malaysier Razali Ismael, einen Kompromiss, gemäss dem der Rat um fünf ständige Mitglieder (ohne Veto-Recht) und vier nicht ständige Mitglieder erweitert werden sollte. Doch stellte sich bald heraus, dass damit die notwenige Mehrheit von zwei Dritteln nicht zu erreichen war. Nach jahrelangen Diskussionen ohne Ergebnis ernannte Generalsekretär Kofi Annan 2003 eine hochrangige Expertengruppe, um neue Ideen zu entwickeln. Das «High Level Panel on Threats, Challenges and Change» vermochte sich nur auf zwei nicht besonders originelle Varianten zu einigen:
a) sechs neue ständige Mitglieder (ohne Vetorecht) plus drei nicht ständige Mitglieder;
b) eine neue Kategorie von acht auf vier Jahre gewählten Mitgliedern (mit Wiederwahlrecht) plus ein nicht ständiges Mitglied.
Brasilien, Deutschland, Indien und Japan (G-4) setzen sich am stärksten für einen permanenten Sitz ein und lassen das Veto-Recht vorläufig offen. Bei jeglicher Reform müsste jedoch auch Afrika einen ständigen Sitz erhalten. Da die afrikanischen Länder nicht in der Lage sind, konkrete Kandidaten zu benennen, pokern sie hoch, indem sie zwei ständige Sitze mit Vetorecht und zusätzlich zwei nicht ständige Sitze fordern.
Immer wieder haben sich Vorsitzende der Generalversammlung um neue Kompromisse bemüht. Doch hat sich nach über zwei Dekaden an der Ausgangslage wenig geändert. Die fünf Veto-Mächte bremsen, wo immer sie können. China lehnt einen ständigen Sitz für Japan ab, die USA tun das behutsam gegenüber Deutschland, weil Westeuropa stark übervertreten ist. Die einstige Hoffnung, die Sitze von Frankreich und Grossbritannien in einen einzigen für die Europäischen Union zu fusionieren, wird nach dem Brexit nicht mehr zu realisieren sein.
Ausserdem sind es nicht nur die fünf Vetomächte, die neue permanente Sitze zu verhindern suchen. Sie erhalten mehr oder minder offene Unterstützung vom «Coffee Club», der sich inzwischen «Uniting for Consensus» nennt. Italien stemmt sich aus Prestigegründen gegen einen permanenten Sitz Deutschlands, Mexiko und Argentinien tun dasselbe gegenüber Brasilien, während Pakistan Indien ablehnt. Solche Rivalitäten von mittleren Mächten sind in praktisch allen Regionen zu finden.
Angesichts der verzwickten Lage hat sich eine Gruppe von fünf kleineren Staaten (Schweiz, Liechtenstein, Costa-Rica, Jordanien und Singapur (S-5) auf Reformen der Arbeitsmethoden konzentriert, die auch unabhängig von einer Änderung der Charta umgesetzt werden könnten. Doch die Veto-Mächte gaben umgehend zu verstehen, dass der Rat für seine interne Organisation selber zuständig sei. Ein weiterer Stein des Anstosses dürfte die Anregung gewesen sein, die P-5 Staaten sollten in Fällen von Genozid, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit freiwillig auf ihr Veto-Recht verzichten. Dabei ging es bloss um die drei Kriterien, die von der Generalversammlung 2005 für das Prinzip der Schutzverantwortung genehmigt worden waren.
Notwendig wären Reformen auch in der Generalsversammlung (GV). Zwar wird darüber geredet, doch bis ein Durchbruch beim Sicherheitsrat gelingt, wird nicht viel geschehen. Die GV verabschiedet jährlich zwischen 250 und 300 Resolutionen. Ausser von Diplomaten in New York werden die meisten kaum zur Kenntnis genommen. Trotzdem kommen etliche unverändert wieder auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. Häufig werden vom Sekretariat Berichte verlangt, die einen Stoss wenig nützlicher Papiere verursachen. Von den Mandaten der 57 Unterorgane, welche die GV geschaffen hat, vermögen sich nur altgediente Routiniers eine Übersicht zu verschaffen.
Bei allen Mängeln ist aber nicht zu vergessen, dass von mehreren GV-Resolutionen bedeutende Wirkungen ausgegangen sind. Das war und ist etwa der Fall für die Menschenrechte, die Abrüstung und den Umweltschutz. Auch in anderen Bereichen sind von ihr zahlreiche Verhandlungen über neue Völkerrechtsverträge angestossen worden. Wäre die GV eine blosse Schwatzbude, wie oft behauptet wird, würden nicht Dutzende von Staats- und Regierungschefs jedes Jahr zur Eröffnung der GV nach New York pilgern. Diese bietet ihnen eine Plattform, um ihre Sicht der Weltlage darzustellen und hinter den Kulissen konkrete Probleme anzugehen.
Da Resolutionen der GV nur Empfehlunge n sind, können sie ungestraft ignoriert werden. Bindende Entscheide kann die GV nur über Fragen der internen Organisation fällen (Budget, Wahlen für Organe, Aufnahme von Mitgliedern, Suspendierung oder Ausschluss von ihnen). Obwohl es Vorschläge gibt, ihre Kompetenzen zu erweitern, sind sich deren Urheber bewusst, dass das mit dem gegenwärtigen Prinzip «ein Staat, eine Stimme» nicht zu erreichen ist. So wird von dieser Seite ebenfalls für eine Gewichtung der Stimmen plädiert. Nauru verfügt in der GV mit 9’000 Einwohnern über die gleiche Stimmkraft wie China mit einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden.
Eine einfache Formel wäre:
W = (P+C+M) /3
W=Anzahl Stimmen, P=prozentualer Anteil an der Gesamtbevölkerung der UNO- Mitglieder, C=prozentualer Beitrag an das UNO-Budget, M = jedes Mitglied geteilt durch die Zahl aller Mitglieder (Schwartzberg; 2013).
Da die GV gegenwärtig von den Ländern der Dritten Welt beherrscht wird, hätte die Formel den Vorteil, dass weder die G-77 noch die reichen OECD-Länder auf genügend Stimmen kämen, um eine zwei Drittel Mehrheit für qualifizierte Entscheide zu erreichen. Somit sähen sich beide Lager gezwungen, nach Kompromissen zu suchen.
Die Frage ist jedoch, auf welche Bereiche verbindliche Entscheide der GV auszudehnen wären. Gesprochen wird namentlich von der Wahrung globaler Gemeingüter («common goods»), die nicht mit den Friedensaufgaben des Sicherheitsrates zu tun hätten. Darunter würden etwa souveränitätsfreie Räume wie der Weltraum, die Hohe See und die Antarktis fallen. Hinzu kämen Probleme wie Umweltschutz, Migration und organisierte Kriminalität, die von keinem Staat im Einzelgang gelöst werden können. Für mehrere davon bestehen internationale Verträge, aber es wäre sicher nützlich, wenn die GV bei schweren Verletzungen Sanktionen beschliessen könnte.
Schon vor Jahren hatte sich der kantige, aber reformfreudige Generalsekretär Boutros Boutros-Gali hinter die Forderung gestellt, auch in der UNO eine parlamentarische Versammlung zu schaffen. Erwartungsgemäss stiess die Idee bei den Regierungsvertretern der GV auf wenig Begeisterung. Argumentiert wurde hauptsächlich, dass das in einer Organisation mit 193 Mitgliedern zu einem organisatorisch nicht zu bewältigenden Monster führen würde. Der amerikanische Professors Joseph E. Schwartzberg ist dagegen der Ansicht, man könnte auch mit 564 Abgeordneten beginnen[26]. Er kommt auf diese Zahl, indem er von seiner Stimmgewichtung in der GV ausgeht und diese mit der Bedingung ergänzt, dass jedes Mitglied mindestens einen Sitz erhalten müsste. Natürlich hätte sich das UNO-Parlament zunächst mit einer bloss beratenden Funktion zu begnügen, um die Aushandlung völkerrechtlicher Verträge zu begleiten. Doch wäre schon damit ein gewisser Mehrwert zu erreichen, weil die Parlamentarier ihre legislativen Erfahrungen einbringen könnten und für die nationalen Ratifikationsverfahren besser gerüstet wären.
Dass der Wirtschafts-und Sozialrat (ECOSOC) weniger unter Kritik steht, ist darauf zurückzuführen, dass er in der öffentlichen Meinung kaum wahrgenommen wird. Zwar hat ihm die Charta auf dem Papier wichtige Aufgaben übertragen, ohne ihm dafür Entscheidungsbefugnisse zu geben. In der Substanz kann der ECOSOC nur Empfehlungen abgeben, die danach von der Generalversammlung in einem doppelspurigen Verfahren ebenfalls als blosse Empfehlungen genehmigt werden müssen.
Der ECSOC ist weder mit einer Erhöhung noch mit einer Reduzierung seiner Mitglieder zu reformieren. Am besten wäre es, ihn abzuschaffen und seine Aufgaben der Generalversammlung zu übertragen. Die GV könnte sich dann von September bis Dezember den politischen und rechtlichen Fragen widmen, um sich darauf in den ersten Monaten des folgenden Jahres mit wirtschaftlichen und sozialen Problemen zu befassen. Da die Mitgliedschaft in der WTO und in den Bretton Woods Institutionen zunehmend universell wird, sollte sich die UNO ohnehin nur auf Entwicklungshilfe konzentrieren. Dabei wäre ein periodischer Austausch mit der G-20 zu formalisieren, weil sich in den Reihen dieser Länder die wichtigsten Geldgeber befinden.
Addiert man die Unterorgane der GV mit jenen des ECOSOC, kommt man auf über 80. Einige von ihnen sind effizient, andere führen ein Schattendasein. Erste Priorität müsste demnach sein, das Gestrüpp zu entflechten und Fusionen nach funktionalen Kriterien vorzunehmen. Darauf wäre es durchaus denkbar, dass die GV bindende Beschlüsse für deren Tätigkeiten erlassen könnte. Auch wenn gerade die erfolgreichsten unter ihnen von freiwilligen Beiträgen abhängen, hätten die Geberländer mit einer Stimmgewichtung genügend Einfluss, um einen ausgewogenen Kompromiss mit den Empfängerländern zu erwirken.
Der Treuhandrat ist seit 1994 arbeitslos. Einige wollten ihm neue Aufgaben übertragen, etwa die Hütung globaler Gemeingüter («global commons») oder die Beschäftigung mit gescheiterten Staaten («failed states»). In beiden Fällen sind bereits andere Gremien aktiv, so dass einmal mehr nur neue Doppelspurigkeiten entstehen würden. Den Treuhandrat kann man ruhig schlafen lassen, bis er bei der nächsten Reform der Charta ehrenvoll beerdigt wird.
Ebenfalls für die Spezialorganisationen, die zur UNO-Familie gehören, sollten Neuerungen nicht tabu sein. Wenn transnationale Unternehmen mit Fusionen vermehrt Effizienz suchen, wäre es einer Überlegung wert, ob mit dem gleichen Ansatz Kosten auch bei ihnen gespart werden könnten:
- Sicher wäre das der Fall, wenn man das Welternährungsprogramm (WFP), den Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) sowie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) unter ein gemeinsames Dach bringen würde.
- Auch die internationale Fernmeldeunion (ITU), der Weltpostverein (UPU), die internationale Zivilluftfahrtbehörde (ICAO) und die internationale Seeschifffahrtsorganisation (IOM) sollten als Kandidaten für eine Fusion zu betrachten sein.
- Schwieriger, aber nicht undenkbar wäre es, in die UNESCO die Organisation für geistiges Eigentum (WIPO), die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) sowie die Organisation für Tourismus (UNWTO) zu integrieren.
- Das UNICEF (Kinderhilfswerk) ist zwar eine starke Marke, aber seine Beliebtheit dürfte mit einer Überführung in die WHO (Weltgesundheitsorganisation) kaum Schaden leiden.
- Angesichts der heutigen Probleme wäre dagegen das Umweltprogramm (UNEP) in eine Spezialorganisation aufzuwerten, in der dann auch andere Organe wie die Kommission für nachhaltige Entwicklung ihren Platz finden müssten.
- Mit seinen immensen Aufgaben sollte ebenfalls das UNHCR (Hochkommissariat für Flüchtlinge) zu einer Spezialorganisation umgewandelt und mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) verschmolzen werden. Auch wenn die IOM nicht zur UNO-Familie gehört, sind Überschneidungen zwischen den beiden Organismen offenkundig, weil es praktisch unmöglich geworden ist, zwischen Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten zu unterscheiden. Dass letztere nicht mit Flüchtlingen gleichzustellen sind, ist klar, ebenso klar ist aber, dass man für Wirtschaftsmigranten zu einem internationalen Regime kommen muss.
Solche Fusionen werden die Koordination der UNO-Familie nicht erleichtern, die der ECOSOC nie effektiv wahrzunehmen vermochte. Eine stimmgewichtete GV sollte jedoch ermächtigt werden, Empfehlungen abzugeben, worauf betroffene Organisationen ihre Ablehnung zu begründen hätten.
Es liegt auf der Hand, dass involvierte Akteure die skizzierten Anregungen als nicht praktikabel ablehnen werden. Doch ist in Bibliotheken und auf dem Internet tonnenweise Material zu finden, das Optionen viel eingehender analysiert. Auch bei diesen geht es nicht immer darum, was genau gemacht werden müsste, sondern dass zumindest etwas zu machen ist. Dabei denkt kaum noch jemand an eine Weltregierung, von der schon Dante im Mittelalter geträumt hatte und die nach dem 2. Weltkrieg selbst von Einstein unterstützt wurde. Viele sind aber überzeugt, dass der Multilateralismus nicht nur zu erhalten, sondern zu verstärken ist. Vermehrt kann man sich jedoch nicht des Eindruckes erwehren, dass auch die Verfechter des globalen Regierens («global governance) zu Utopisten geworden sind.
Der indische Politologe Amitav Acharya (Acharya; 2017) ist weniger pessimistisch, obwohl er überzeugt ist, dass das Zeitalter der liberalen Hegemonie vorbei sei. Er sieht die Zukunft in einer «multitplexen» Weltordnung, bei der funktionale Zusammenarbeit unter unterschiedlichen Akteuren sich weiterhin entwickeln werde. Eine solche Ordnung wäre nicht mehr von einem Hegemonen geprägt, je nach Thema würde sie von einer geteilten Führung («leader-sharing») vorangetrieben.
Das mag nicht nach einer Utopie klingen, bleibt aber doch eine idealistisch gefärbte Erwartung. Zweifelsohne wird die Globalisierung schon wegen des technologischen Fortschrittes nicht rückgängig zu machen sein. Wer ist jedoch willens oder fähig, der Globalisierung ein humaneres Gesicht zu geben? Sicher muss das zunehmende Gefälle zwischen Armen und Reichen in erster Linie auf staatlicher Ebene angegangen werden. Dafür stehen praktisch nur höhere Steuern für die Reichen zur Verfügung. Das Problem ist jedoch, dass auch der Steuerwettbewerb globalisiert worden ist. Trotz den Anstrengungen der OECD haben Begüterte nach wie vor Optionen, Steuern zu optimieren oder gar zu hinterziehen. Auch in diesem Kernbereich staatlicher Souveränität sind Lücken ohne gemeinsames Vorgehen nicht zu schliessen. Ob die OECD mit «leader sharing» das Ziel erreichen wird, kann man nur hoffen, einstweilen ist aber noch Geduld gefragt. Zudem sind für eine Globalisierung mit humanem Gesicht noch andere Probleme zu lösen. Letztlich müsste man weltweit zu einer sozialen Marktwirtschaft kommen, wobei zuzugeben ist, dass das bis auf weiteres ebenfalls eine Utopie bleiben wird.
10. Literaturhinweise
1. Acharya Amitav, After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order, Ethics & International Affairs 31, no.3 (2017) pp. 271-285
2. Armstrong David, Lloyd Lorna, Redmond John, International Organisation in World Politics, Palgrave Macmillan, 2004 (third edition)
3. Bhagwati Jagdish, In Defence of Globalization, Oxford University Press, New York, 2004
4. Beck Ulrich, Was ist Globalisierung? Suhrkamp Taschenbuch, Frankfurt am Main, 2007
5. Beck Ulrich, Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter, Suhrkamp Taschenbuch, Frankfurt am Main, 2009
6. Brock Ditmar, Globalisierung – Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2008
7. Freistein Katja, Leininger Julia (Hrsg.), Handbuch Internationale Organisationen, Oldenbourg Wissenschaftsvertrag, München, 2012
8. Goldin Ian, Divided Nations, Oxford University Press, Oxford, 2013
9. Herren Madeleine, Internationale Organisationen seit 1865, eine Geschichte der internationalen Organisation, WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt, 2009
10. Hirst P., Thompson G., Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance, Polity Press, Cambridge, 1999 (2nd edition)
11. Hurd Ian, International Organizations-Politics, Law, Practice, Cambridge University Press, New York, 2014 (second edition)
12. Krugman Paul, The Return of Depression Economics and the Crises of 2008, W.W. Norton & Company, New York - London, 2009
13. Krugman Paul, End this Depression Now, W.W. Norton & Company, New York – London, 2012
14. Leggewie Claus, Die Globalisierung und ihre Gegner, Verlag C.H. Beck, München, 2003
15. Mahububani Kishore, The Great Convergence, Public Affairs, New York, 2014
16. Mazower Mark, Governing the World, The Penguin Press, New York, 2012
17. Milanovic Branko, Global Equality, a New Approach for the Age of Globalization, Harvard University Press, Cambridge-London, 2016
18. Norberg Johan, Ten Reasons to Look Forward to the Future, One World Publications, London, 2017
19. Osterhammel Juergen, Petersson Niels P., Geschichte der Globalisierung, Dimensionen Prozesse Epochen, Verlag C.H. Beck, München, 2006 (dritte Auflage)
20. Pelizaeus Ludolf, Der Kolonialismus – Geschichte der europäischen Expansion, Marix Verlag, Wiesbaden, 2008
21. Plumpe Werner, Wirtschaftskrisen, Geschichte und Gegenwart, Verlag C.H. Beck, München, 2011 (zweite Auflage)
22. Rehbein Boike, Schwengel Hermann, Theorien der Glabilsierung, UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz, 2008
23. Rittberger Volker, Zangl Bernhard, Internationale Organisationen, Politik und Geschichte, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2008 (3. Auflage)
24. Rodrick Dani, The Globalization Paradox, W.W. Norton & Company, New York – London, 2011
25. Scherrer Christoph, Kunze Caren, Globalisierung, Vandenboeck & Ruprecht, Göttingen, 2011
26. Security Council Report, Human Rights and the Security Council - An Evolving Role, 2016, security councilreport.org
27. Schwartzberg Joseph E., Transforming the United Nations System, Designs for a Workable World, United Nations University Press, Tokyo-New York-Paris, 2013
28. Singer Peter, Yale University Press, New Haven & London, 2002
29. Steger Manfred B., Globalization: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2009 (2. Auflage)
30. Stiglitz Joseph, Globalization and its Discontents, W.W. Norton &Company, 2002
31. UNDP, Millennium – Development Goals, Report 2015
32. Wallerstein, Immanuel, The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origin of the European World Economy in the Sixteenth Century, Academic Press, New York, 1976
33. Weiss Thomas G., Thakur Ramesh, Global Governance and the UN, An Unfinished Journey, Indiana University Press, Bloomington, 2010
34. Weiss Thomas G. & Sam Daws, The Oxford Handbook on the United Nations, Oxford University Press, 2007
35. Wendt, Reinhard, Vom Kolonialismus zur Globalisierung - Europa und die Welt seit 1500, UTB Taschenbücher, Paderborn, 2007
[...]
[1] Nichtständige Mitglieder werden von der Generalversammlung mit Zweitdrittelmehrheit für ein Mandat von zwei Jahren gewählt. Nach Ablauf ihrer Amtszeit können sie nicht unmittelbar wiedergewählt werden.
[2] Zu Beginn bestand der Rat aus 18 Mitgliedern. In den 1960er und 1970er Jahren, als viele neue Länder der UNO beitraten, wurde die Zahl in zwei Schritten auf 54 erhöht. Die Generalversammlung erneuert jährlich 18 dieser Sitze für eine Amtsperiode von drei Jahren.
[3] Der Sicherheitsrat muss bei der Wahl des Generalssekretärs eine Empfehlung abgeben, bevor er von der Generalversammlung mit Zweidrittelmehrheit gewählt wird. Bisher hat sich die Generalversammlung nur 1951 bei der Wiederwahl von Trygve Lie über die Empfehlung des Sicherheitsrates hinweggesetzt.
[4] Der Gerichtshof besteht aus 15 Mitgliedern, die von der Generalversammlung und dem Sicherheitsrat mit absoluter Mehrheit für eine Amtsperiode von 9 Jahren gewählt werden. Wie im Falle des Generalsekretärs ist eine Wiederwahl möglich.
[5] In der Weltbankgruppe sind zwei weitere Organe angesiedelt: das 1966 gegründete „International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID», das bei Streitigkeiten zwischen Auslandinvestoren und lokalen Behörden vermittelt, sowie die 1988 geschaffene “Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)», die private Direktinvestitionen in Entwicklungsländer gegen politische Risiken versichert. Mit beiden Mechanismen wird versucht, den Fluss privater Investitionen nach Entwicklungsländern zu fördern.
[6] Dafür braucht es die Zustimmung von 55% der Mitgliedstaaten, die 65% der Bevölkerung ausmachen.
[7] Belgien, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten. 1952 kamen Griechenland und die Türkei hinzu, 1955 die Bundesrepublik Deutschland, 1982 Spanien.
[8] Ist jedoch 2017 wieder beigetreten
[9] Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapverden, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo
[10] Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Sambia, Simbabwe, Swasiland, Tansania, Namibia, Südafrika, Demokratische Republik Kongo, Mauritius, Seychellen, Madagaskar
[11] Angola, Äquatorial Guinea, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Gabun, Kamerun, Republik Kongo, Sao Tomé und Prinzipe, Tschad, Zentralafrikanische Republik
[12] Ägypten, Äthiopien, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Kenia, Komoren, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Ruanda, Seychellen, Sudan, Swasiland, Uganda, Sambia, Zimbabwe
[13] Äthiopien, Dschibuti, Kenia, Somalia, Sudan, Uganda, Eritrea suspendierte 2007 seine Mitgliedschaft, nach der Unabhängigkeit von 2011 kam Süd-Sudan hinzu
[14] Für die Menschenrechte wurde eine Kommission mit je einem Vertreter aus den Mitgliedstaaten eingesetzt, die eine Erklärung vorbereiten sollte. Nach zähen Verhandlungen akzeptierten die Staats- und Regierungschefs 2012 einen Text, der nicht rechtsverbindlich ist und dessen Überwachung sich auf periodische Berichte beschränkt. Inhaltlich wurde die Erklärung nicht nur von NGOs, sondern auch vom UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte kritisiert, weil einzelne Formulierungen nicht internationalen Standards entsprechen
[15] Australien, Brunei, China, Kanada, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Singapur, Thailand, USA, Taiwan, Hongkong, Mexiko, Papua-Neuginea, Chile, Peru, Russland, Vietnam.
[16] Australien, Cookinseln, Fidschi, Kiribati, Marschallinseln, Mikronesien, Nauru, Neuseeland, Niue, Palau, Papua-Neuguinea, Salomonen, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
[17] Verschiedene westliche NGOs sind skeptisch, dass dies in einer Bank unter chinesischer Leitung auch tatsächlich zur Anwendung kommt.
[18] Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich, Westdeutschland und (ab 1958) Spanien.
[19] Gesamthaft vereinigen die 60 Mitglieder ca. 95% des weltweiten BIPs auf sich und stammen aus folgenden Ländern: Algerien, Argentinien, Australien, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Korea, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Peru, Philippinen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, UK sowie die die Europäische Zentralbank.
[20] Das Erfordernis für hartes Kernkapital (eigene Aktien, einbehaltene Gewinne) wurde von 2% auf 4,5% erhöht, für weiches Kernkapital (z.B. stille Einlagen) von 2% auf 1,5% vermindert, für Ergänzungskapital (z.B. Genussrechte, nachrangige Verbindlichkeiten) von 4% auf 2% reduziert. Zudem wurde ein Kapitalerhaltungspuffer von 2,5% festgelegt (wird dieser von einer Bank unterschritten, muss sie Dividenden kürzen oder andere Massnahmen treffen). Hinzu kam ein antizyklischer Kapitalpuffer von 0-2,5%, der für jedes Land individuell festgelegt wird, die Banken aber in guten Zeiten verpflichtet, zusätzliches Kapital zu bilden, damit Verluste in schlechten Zeiten aufgefangen werden können. Ende 2017 einigte man sich nach zähen Verhandlungen, die bankinternen Risikomodelle zu harmonisieren. Der von einer Bank selbst errechnete Kapitalbedarf darf nicht unter 72,5% des nach einem Standardmodell ermittelten Wertes fallen. Die Neuerung wird ab 2022 gelten und soll danach über fünf Jahre stufenweise verwirklicht werden.
[21] Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur, Vietnam
[22] USA 16.73%, Japan 6.23%, China 6.16%, Deutschland 5.39%, Frankreich 4.09%, UK 4.09%, Italien 3.06%, Indien 2.67%, Russland 2.63%, Brasilien 2.25%
[23] Spezifisches Merkmal der Bank ist, dass jedes Mittglied den gleichen Kapitalbeitrag zu leisten hat und folglich auch über den gleichen Anteil der Stimmen verfügt.
[24] Sie sollen 6% des Welthandels betreffen.
[25] Arbeitsgruppe, an der sich alle Mitgliedstaaten beteiligen können.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ursprung des Begriffs "internationale Beziehungen"?
Der Begriff wurde 1780 von Jeremy Bentham geprägt, als das koloniale England Märkte über seinen politischen Einflussbereich hinaus benötigte.
Was sind die drei Stufen grenzüberschreitender Beziehungen?
- International: Staaten spielen die zentrale Rolle.
- Transnational: Multinationale Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen gewinnen an Einfluss.
- Global: Einzelne Bürger sind als Subjekte an grenzüberschreitenden Aktivitäten beteiligt.
Welche historischen Beispiele für Globalisierung gibt es?
- Die Besiedlung der Kontinente durch afrikanische Vorfahren.
- Die Sesshaftwerdung der ersten Nomaden.
- Das Zeitalter der antiken Imperien (Mesopotamien, Ägypten, Persien, Indien, China, römisches Reich).
- Das chinesische Imperium mit seinen epochalen Erfindungen.
- Der europäische Kolonialismus.
Welche epochalen Erfindungen wurden im chinesischen Imperium gemacht?
Magnetischer Kompass, Papier, Buchdruck, Papiergeld, Vereinheitlichung von Massen und Gewichten, Schiesspulver, mechanische Uhren, Nutzung von Erdgas.
Welche Rolle spielten religiöse Minderheiten im grenzüberschreitenden Handel?
Sie betrieben häufig grenzüberschreitenden Handel, religiöse Gemeinschaften waren transnationale Vorreiter mit Ritualen und Pilgerfahrten.
Was zeichnete das Mongolenreich aus?
Brutale Eroberungsmethoden, aber erstaunliche Offenheit gegenüber den besiegten Völkern.
Was war neu am europäischen Kolonialismus?
Die Akteure waren nicht mehr mächtige Imperien, sondern eher kleine Monarchien, die untereinander in Konkurrenz standen.
Welche europäischen Mächte waren am Kolonialismus beteiligt?
Spanien, Portugal, England, die Niederlande und Frankreich.
Was ist die "East Indian Company"?
Eine englische Gesellschaft, die sich vor allem auf den Handel mit Indien spezialisierte.
Was waren die Folgen der englischen Industrialisierung?
Massive Steigerungen der Arbeitsproduktivität durch Erfindungen wie die Dampfmaschine und den mechanischen Webstuhl. Verbesserte Methoden zur Gewinnung von Eisenerz und die Entwicklung der Eisenbahnen. Drastische Senkung der Transportkosten über weite Distanzen.
Was waren die Ziele der Berliner Konferenz von 1884-1885?
Die Aufteilung des afrikanischen Kontinents unter den europäischen Mächten.
Was waren die Motive für die Kolonialisierung?
Zivilisierung der zurückgebliebenen Völker, Rohstoffbeschaffung, Schaffung neuer Absatzmärkte, Ventil für Emigration, machtpolitisches Prestigedenken.
Was ist neu an der Globalisierung im Vergleich zum 19. Jahrhundert?
Starkes Wachstum in den westlichen Demokratien nach dem Zweiten Weltkrieg, Entstehung der "asiatischen Tiger", neue Wirtschaftspolitik im kommunistischen China, Zusammenbruch des Sowjetblocks, Zunahme des Welthandels und der Dienstleistungen, Zunahme der Auslandinvestitionen, transnationale Unternehmen, internationale Finanzströme, technologische Innovationen im Kommunikations- und Verkehrswesen, multikulturelle Erfahrungswelt, Zunahme des Tourismus.
Was sind transnationale Unternehmen?
Wirtschaftliche Akteure, deren Produktionsprozesse sich über eine Vielzahl von Ländern erstrecken.
Was ist die "G-20"?
Eine Gruppe, in die neben den alten Industriestaaten der G-7 eine Reihe aufstrebender Entwicklungsländer aufgenommen wurden.
Welche Umweltprobleme werden im Text genannt?
Verschmutzte Flüsse und Seen, Luftverschmutzung, Waldsterben, Zerstörung der Ozonschicht, Verlust der Biodiversität, Klimawandel.
Was ist der Atomsperrvertrag?
Ein Vertrag, der den legitimen Besitz von Atomwaffen auf die fünf Mächte beschränkt, die vor dem 1. Januar 1967 erfolgreich einen Test durchgeführt hatten.
Welche Formen von transnationaler Kriminalität werden im Text genannt?
Drogen- und Waffenhandel, Prostitution, gefälschte Marken, Handel mit raren Spezies und antiker Kunst, Schlepperei von Flüchtlingen, Attacken im Cyber-Raum.
Was ist der "Konsens von Washington"?
Ein Katalog neoliberaler Prinzipien, der von konservativen Machthabern des Nordens vorangetrieben wurde. Zu den Prinzipien gehören: Abbau staatlicher Haushaltsdefizite, Privatisierung öffentlicher Unternehmen, Liberalisierung der Märkte und die Eliminierung von Subventionen.
Was sind "faire trade" und "Transparenz in Bezug auf die Herstellungsbedingungen von Produkten"?
Ein Konzept um im grenzüberschreitenden Handel direktere Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten herzustellen. Bestrebungen, dem Konsumenten genauere Angaben über die Herstellungsbedingungen von Produkten zu liefern.
Was ist die "Tobin-Steuer"?
Eine Steuer auf Finanztransaktionen, die von James Tobin vorgeschlagen wurde, um schwächeren Ländern mehr Autonomie für ihre Wirtschaftspolitik zurückzugeben.
Was sind die Ziele des "Weltsozialforums"?
Das Ziel des Weltsozialforums ist es, eine bessere Welt nicht über den neoliberalen Weg zu erreichen, sondern auf globaler Ebene zu mehr sozialer Gerechtigkeit zu kommen.
Wer sind Joseph Stiglitz, Paul Krugman und Dani Rodrik?
Drei amerikanische Ökonomen, die die Vorteile der Globalisierung nicht in Frage stellen, aber ebenfalls dafür plädieren, dass diese anders zu gestalten sei.
Was war das "Europäische Konzert"?
Ein Konsultationsmechanismus europäischer Siegermächte nach Napoleon, um das Gleichgewicht in Europa zu sichern.
Was war das Ziel des "Völkerbundes"?
Die politische Unabhängigkeit und die territorialen Grenzen von kleinen wie grossen Staaten zu sichern.
Was waren die Gründe für das Scheitern des Völkerbundes?
Eine schwammige Satzung, eine bröckelnde Mitgliedschaft, das Handikap des Nicht-Beitritts der USA, das Aufkommen totalitärer Parteien und unterschiedliche Interessen der demokratischen Grossmächte.
Was sind die Hauptorgane der UNO?
Generalversammlung, Sicherheitsrat, Wirtschafts- und Sozialrat, Treuhandrat, Internationaler Gerichtshof, Sekretariat.
Was ist die Schutzverantwortung ("responsability to protect")?
Das Prinzip, dass die internationale Gemeinschaft das Recht hat, in einem Staat zu intervenieren, wenn dieser seine Bürger nicht vor Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schützt.
Welche Abrüstungsabkommen werden im Text genannt?
Antarktis-Vertrag, Teststoppabkommen, Weltraumvertrag, Atomwaffensperrvertrag, Meeresbodenvertrag, Biowaffenkonvention, Umweltkonvention, Chemiewaffenabkommen, Allgemeiner Kernwaffenteststoppvertrag, SALT I, ABM-Vertrag, SALT II, START I, INF-Vertrag, US-sowjetisches Abkommen über Chemiewaffen, START II, SORT - Vertrag, START III, New Start, nuklearfreie Zonen.
Welche Massnahmen wurden gegen den internationalen Terrorismus ergriffen?
Internationale Abkommen zu Flugzeugentführungen, Schutz von Atommaterial, Strafen bei Attentaten auf Diplomaten, Verbot von Geiselnahmen, Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus, Schaffung von Ausschüssen und Sonderstäben in der UNO.
Was sind die Ziele der "UNO-Spezialorganisationen"?
Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts, Achtung der Menschenrechte.
Was ist die Aufgabe des "Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC)"?
Der "Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC)" sollte Daten über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sammeln und Vorschläge für Verbesserungen unterbreiten. Ferner hatte er die von der Generalversammlung oder von ihm geschaffenen Programme und Hilfswerke zu beaufsichtigen und für die Koordination unter den UNO-Spezialisationen besorgt zu sein.
Welche UNO-Spezialorganisationen werden im Text genannt?
UNICEF, World Food Programm, UNO-Entwicklungsprogrammes, UNWRA, UNHCR, UN-Bevölkerungsfonds, UN-Women, General Agreement on Tariffs and Trade, International Monetary Fund, Weltbank, International Atomic Energy Agency, World Trade Organization, International Labour Organization, World Health Organization, UNESCO.
Was ist das "Ziel der "Sustainable Development Goals""?
Das Ziel des "Sustainable Development Goals" ist es "die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.".
Was war das Ziel des "Europäische Konzert"?
Das Ziel des "Europäische Konzert" war es, die alte Gleichgewichtspolitik wiederherzustellen, um den Frieden in Europa zu sichern.
- Citar trabajo
- Armin Ritz (Autor), 2017, Globalisierung und Politik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412061