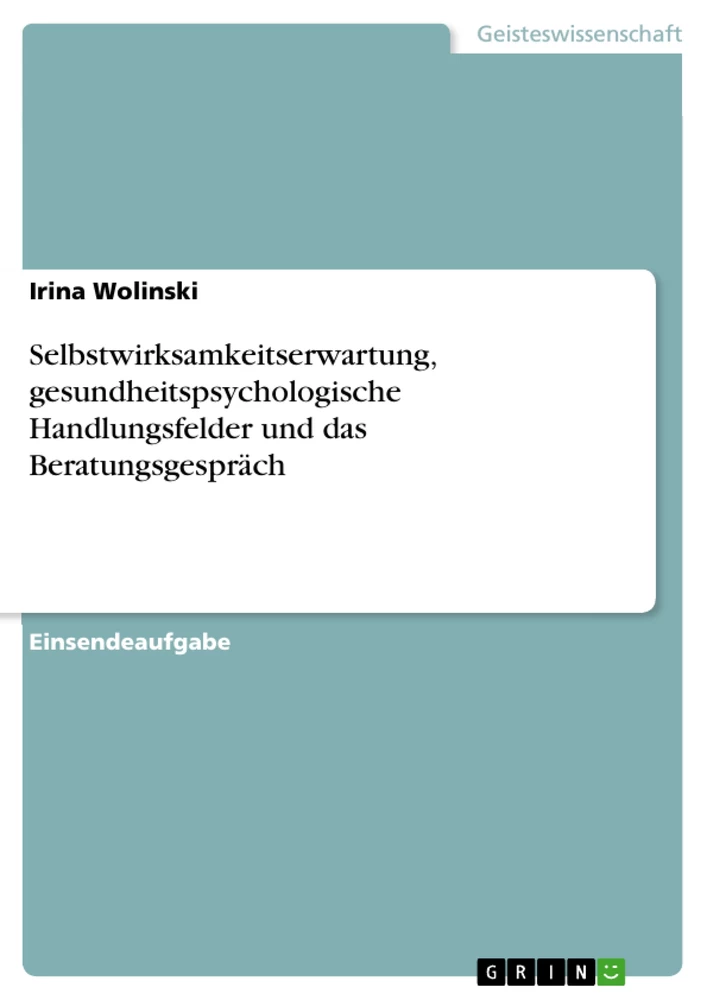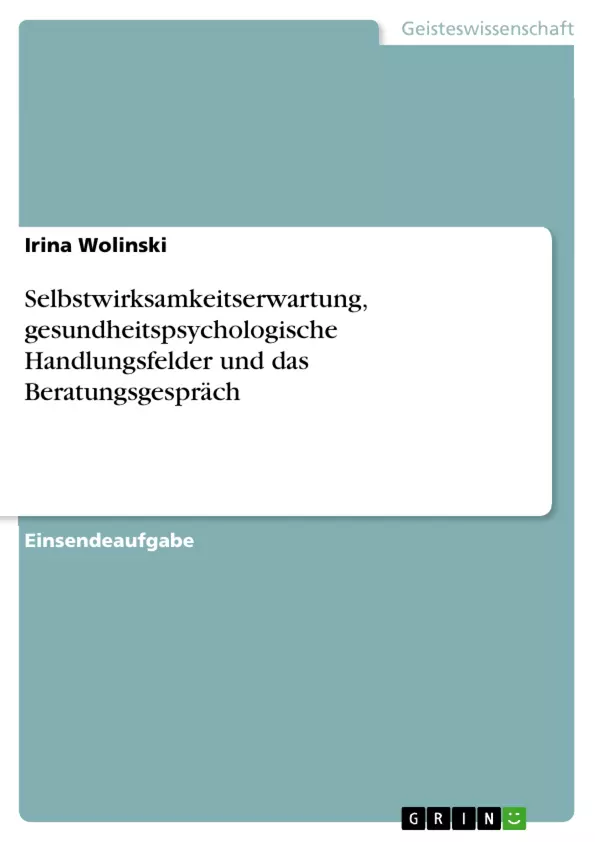Die Selbstwirksamkeitserwartung, auch Kompetenzerwartung genannt, wurde von dem Psychologen Bandura im Zusammenhang mit der sozialen Lerntheorie entwickelt. Sie ist eine „individuell unterschiedlich ausgeprägte Überzeugung“ eines Individuums, eine Leistung innerhalb einer bestimmten Situation erbringen zu können. Die subjektive Überzeugung stellt die eigenen Fähigkeiten dar, die zur Organisation und Ausführung zielgerichteter Handlungen notwendig werden. Es kann sich eine sowohl positive als auch negative Einstellung zu der eigenen Persönlichkeit und Handlungskompetenz darstellen. Diese Einstellung beeinflusst sowohl die Wahrnehmung und Motivation eines Individuums als auch seine Leistungsfähigkeit (Pieter, 2014, S. 135). Durch die Selbstwirksamkeit wird die Auswahl der Situationen beeinflusst, in die sich das Individuum begibt (Pieter, 2014, S. 139). Ein Mensch ist demnach erst dann in der Lage eine Handlung durchzuführen, wenn er das Gefühl hat, dass er das vorhandene Problem lösen kann. Weiterhin bestimmt sie über die Anstrengungsbereitschaft und die Ausdauer bei der Bewältigung von Aufgaben (Pieter, 2014, S. 140). Man geht davon aus, dass einmal vorhandene positive Erwartungen, auf neue Situationen angewendet werden können. Die Selbstwirksamkeit hängt von den täglichen Leistungen, von unseren Beobachtungen der Leistung anderer, von Überzeugungen, die wir von anderen übernommen oder selbst aufgebaut haben, und von der Beobachtung unserer emotionalen Zustände, während wir über eine Aufgabe nachdenken oder uns an eine Aufgabe heranwagen, ab (Pieter, 2014, S. 136).
Inhaltsverzeichnis
- 1 SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG
- 1.1 Definition der „Selbstwirksamkeitserwartung“ bzw. „Kompetenzerwartung“
- 1.2 Erarbeitung eines Fragebogens
- 1.3 Bearbeitung und Auswertung des Fragebogens
- 1.4 Recherche über die Selbstwirksamkeitserwartung
- 2 GESUNDHEITSPSYCHOLOGISCHE HANDLUNGSFELDER
- 3 DAS BERATUNGSGESPRÄCH
- 3.1 Beschreibung des Klienten
- 3.2 Beschreibung des Beraters
- 3.3 Einordnung des Klienten in eine Stufe der Verhaltensänderung
- 3.4 Darstellung des Gesprächsverlaufs
- 3.5 Kritische Reflektion des Gesprächs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Selbstwirksamkeitserwartung im Kontext sportlicher Aktivität. Ziel ist es, die Selbstwirksamkeitserwartung zu definieren, einen Fragebogen zur Erfassung derselben zu entwickeln und anzuwenden, und die Ergebnisse auszuwerten. Zusätzlich wird eine Literaturrecherche zum Thema durchgeführt.
- Definition und Bedeutung der Selbstwirksamkeitserwartung
- Entwicklung und Anwendung eines Fragebogens zur Erfassung der Selbstwirksamkeitserwartung
- Auswertung der Fragebogendaten und Interpretation der Ergebnisse
- Literaturrecherche zu relevanten Studien und Theorien
- Anwendung der Ergebnisse im Kontext eines Beratungsgesprächs (Kapitel 3)
Zusammenfassung der Kapitel
1 SELBSTWIRKSAMKEITSERWARTUNG: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit dem Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung, auch bekannt als Kompetenzerwartung, basierend auf Banduras sozialer Lerntheorie. Es definiert den Begriff und erläutert, wie die subjektive Überzeugung eines Individuums, eine bestimmte Leistung erbringen zu können, dessen Wahrnehmung, Motivation und Leistungsfähigkeit beeinflusst. Das Kapitel beschreibt, wie die Selbstwirksamkeit die Auswahl von Situationen, die Anstrengungsbereitschaft und die Ausdauer bei der Bewältigung von Aufgaben bestimmt. Es werden verschiedene Aspekte der Selbstwirksamkeitserwartung, wie Niveau, Allgemeinheitsgrad und Gewissheit, näher beleuchtet und die Möglichkeit ihrer Diagnose mittels Fragebogen erörtert. Die ausführliche Darstellung der Selbstwirksamkeitserwartung bildet die Grundlage für die folgenden Kapitel.
2 GESUNDHEITSPSYCHOLOGISCHE HANDLUNGSFELDER: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext, daher kann hier keine Zusammenfassung geliefert werden)
3 DAS BERATUNGSGESPRÄCH: Dieses Kapitel präsentiert einen Fallstudie eines Beratungsgesprächs. Es beschreibt den Klienten und den Berater, ordnet den Klienten in eine Stufe der Verhaltensänderung ein und dokumentiert den detaillierten Verlauf des Gesprächs. Eine anschließende kritische Reflektion des Gesprächsverlaufs analysiert Stärken und Schwächen des Beratungsansatzes und beleuchtet mögliche Verbesserungen. Der Fokus liegt auf der Anwendung der im vorherigen Kapitel erläuterten Theorie der Selbstwirksamkeitserwartung in einem realen Kontext.
Schlüsselwörter
Selbstwirksamkeitserwartung, Kompetenzerwartung, soziale Lerntheorie, Bandura, Fragebogen, Auswertung, Beratungsgespräch, Verhaltensänderung, Motivation, Leistungsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Selbstwirksamkeitserwartung im Kontext sportlicher Aktivität
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Selbstwirksamkeitserwartung im Kontext sportlicher Aktivität. Sie beinhaltet die Definition der Selbstwirksamkeitserwartung, die Entwicklung und Anwendung eines Fragebogens zu deren Erfassung, die Auswertung der Ergebnisse und eine Literaturrecherche zum Thema. Zusätzlich wird ein Beratungsgespräch analysiert, um die Anwendung der theoretischen Erkenntnisse in der Praxis zu demonstrieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln: Kapitel 1 befasst sich umfassend mit der Selbstwirksamkeitserwartung, inklusive Definition, Fragebogenentwicklung und -auswertung. Kapitel 2 behandelt gesundheits-psychologische Handlungsfelder (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext). Kapitel 3 präsentiert und analysiert ein Beratungsgespräch unter Einbezug der vorherigen Kapitel.
Wie wird die Selbstwirksamkeitserwartung definiert?
Die Selbstwirksamkeitserwartung, auch Kompetenzerwartung genannt, wird basierend auf Banduras sozialer Lerntheorie definiert. Sie beschreibt die subjektive Überzeugung eines Individuums, eine bestimmte Leistung erbringen zu können, und beeinflusst Wahrnehmung, Motivation und Leistungsfähigkeit. Aspekte wie Niveau, Allgemeinheitsgrad und Gewissheit der Selbstwirksamkeit werden näher beleuchtet.
Welchen Fragebogen verwendet die Arbeit?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung eines eigenen Fragebogens zur Erfassung der Selbstwirksamkeitserwartung. Details zum Aufbau und den konkreten Fragen des Fragebogens sind im Originaltext nicht explizit aufgeführt.
Wie werden die Ergebnisse des Fragebogens ausgewertet?
Die Arbeit beschreibt die Auswertung der Fragebogendaten und die Interpretation der Ergebnisse, ohne jedoch konkrete Methoden oder Ergebnisse zu nennen.
Welche Rolle spielt die Literaturrecherche?
Eine Literaturrecherche zu relevanten Studien und Theorien über die Selbstwirksamkeitserwartung bildet einen wichtigen Bestandteil der Arbeit und dient der fundierten Einbettung der eigenen Untersuchung.
Was ist der Fokus des Beratungsgesprächs (Kapitel 3)?
Kapitel 3 präsentiert eine Fallstudie eines Beratungsgesprächs. Es beschreibt den Klienten und den Berater, ordnet den Klienten einer Stufe der Verhaltensänderung zu und dokumentiert den Gesprächsverlauf. Eine kritische Reflexion analysiert Stärken und Schwächen des Ansatzes und mögliche Verbesserungen. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der Theorie der Selbstwirksamkeitserwartung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstwirksamkeitserwartung, Kompetenzerwartung, soziale Lerntheorie, Bandura, Fragebogen, Auswertung, Beratungsgespräch, Verhaltensänderung, Motivation, Leistungsfähigkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Selbstwirksamkeitserwartung zu definieren, einen Fragebogen zur Erfassung zu entwickeln und anzuwenden, die Ergebnisse auszuwerten und eine Literaturrecherche durchzuführen. Die Anwendung der Ergebnisse im Kontext eines Beratungsgesprächs ist ein weiterer Schwerpunkt.
- Citar trabajo
- Irina Wolinski (Autor), 2015, Selbstwirksamkeitserwartung, gesundheitspsychologische Handlungsfelder und das Beratungsgespräch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412063