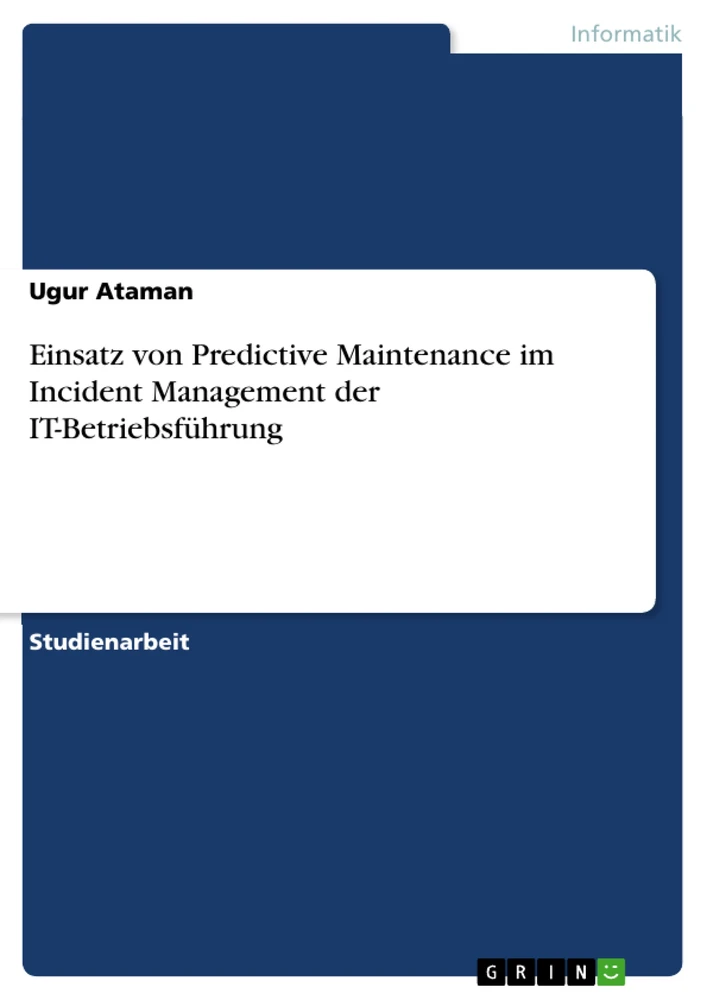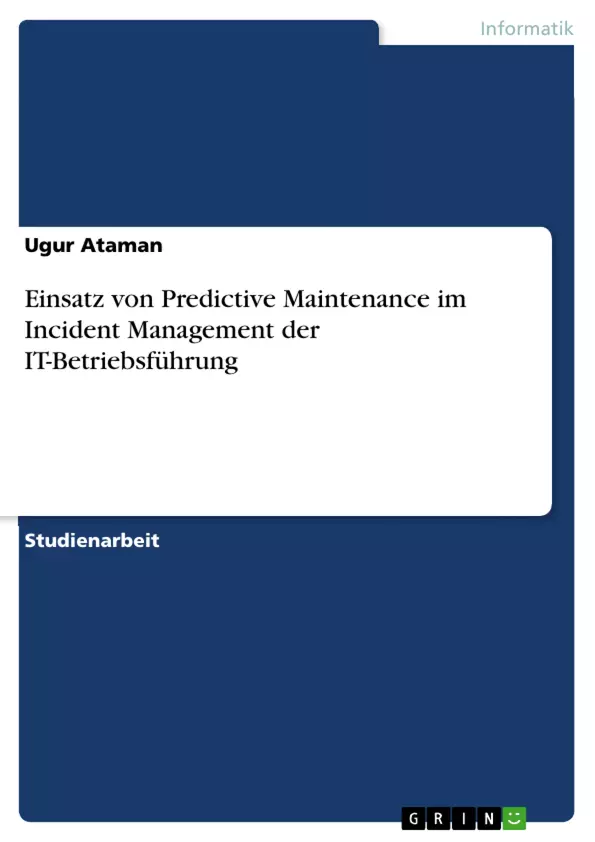In den neunziger Jahren des letzten Jahrtausends gehörten Ausfälle in der Informationstechnologie (IT) zum Alltag und waren nichts Ungewöhnliches. Für das Bestehen im Wettbewerb und Erfolg der Unternehmen ist es heute wichtig, einen sorgfältig geplanten, soliden und ausfallsicheren IT-Betrieb zu führen. Die hohe IT-Verfügbarkeit gehört heute zu einem Muss.
Für die Steigerung der Effizienz und Transparenz sowie die strikte Planung, Steuerung und Kontrolle des IT-Betriebs hat sich in den letzten Jahrzehnten in vielen Unternehmen und Organisationen das Framework IT Infrastructure Library (ITIL) etabliert. Das ITIL-Framework umfasst eine zentrale Anlaufstelle für Störungen und Anfragen. Dies beinhaltet das Incident Management (IM), welches vor allem für die Instandhaltung der IT-Systeme und Komponenten wesentlich ist. Das IM dokumentiert eingehende Störungen, sogenannte Incidents, und hat die Aufgabe, diese möglichst schnell zu bearbeiten und die Services umgehend wiederherzustellen. Viele Unternehmen sind jedoch mit vielen Incidents konfrontiert, welche die Wirtschaftlichkeit negativ beeinflussen und hohe Kosten verursachen.
Mit der zunehmenden Relevanz der Digitalisierung und Instandhaltung hat sich Predictive Mainentance, kurz PdM, als eine beliebte und moderne Instandhaltungsstrategie durchgesetzt. Im Zuge aktueller Digitalisierungs- und Vernetzungsmöglichkeiten können Unternehmen das zukünftige Verhalten ihrer IT-Systeme und Komponenten vorhersagen. Das PdM soll ermöglichen, Störungen und Ausfälle im Voraus zu erkennen, bevor sie tatsächlich auftreten. Somit bietet PdM ein hohes Einsparpotenzial für Unternehmen. Das amerikanische Schienenverkehrsunternehmen Union Pacific Railroad spart dank PdM bereits jährlich rund 100 Millionen Dollar ein.
Diese Arbeit soll nun in erster Linie die Herausforderungen in der IT-Betriebsführung erläutern. Die Arbeit fokussiert sich auf den Einsatz von PdM im Incident Management (IM) der IT-Betriebsführung. Mit welchen Incidents ist der IT-Betrieb am häufigsten betroffen und welche Möglichkeiten existieren, um mit PdM die Anzahl der Störungen und Ausfälle im IM zu reduzieren?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Motivation und Wahl der Thematik
- 1.2 Methodik
- 1.3 Aufbau und Struktur
- 2. Grundlagen
- 2.1 IT Infrastructure Library (ITIL)
- 2.2 Incident Management (IM)
- 2.3 Maintenance
- 2.4 Predictive Maintenance (PdM)
- 3. Herausforderungen in der IT-Betriebsführung
- 4. Einsatz von Predictive Maintenance im Incident Management
- 4.1 Ursachen von Incidents
- 4.2 Einsatz von PdM bei Software
- 4.3 Einsatz von PdM bei Hardware
- 4.4 Einsatz von PdM bei Logdaten
- 5. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einsatz von Predictive Maintenance (PdM) im Incident Management der IT-Betriebsführung. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen von PdM zur Verbesserung der IT-Verfügbarkeit und -Effizienz zu analysieren.
- Predictive Maintenance im Kontext von ITIL
- Ursachen von Incidents in der IT-Infrastruktur
- Anwendungsbeispiele von PdM für Software und Hardware
- Auswertung von Logdaten für prädiktive Wartung
- Potenziale und Limitationen von PdM im Incident Management
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Predictive Maintenance (PdM) im Incident Management ein und begründet die Wahl der Thematik. Sie beschreibt die Methodik der Arbeit und gibt einen Überblick über den Aufbau und die Struktur der folgenden Kapitel. Die Motivation wird dargelegt und der Leser wird auf die Bedeutung von effizientem Incident Management in der IT-Betriebsführung vorbereitet.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Arbeit. Es erläutert die IT Infrastructure Library (ITIL) als etablierten Rahmen für IT Service Management und beschreibt den Prozess des Incident Managements im Detail. Die verschiedenen Arten der Maintenance werden definiert, wobei ein besonderer Fokus auf Predictive Maintenance (PdM) und seinen Eigenschaften, Vorteilen und Herausforderungen gelegt wird. Dieses Kapitel bildet die essentielle Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel.
3. Herausforderungen in der IT-Betriebsführung: Hier werden die Herausforderungen im Kontext der IT-Betriebsführung beleuchtet, die durch den Einsatz von PdM adressiert werden können. Der Fokus liegt auf den Schwierigkeiten, die bei der Identifikation, Prävention und Behebung von Incidents auftreten. Das Kapitel bereitet den Boden für die nachfolgenden Ausführungen, indem es die Problematik und die Notwendigkeit für innovative Lösungsansätze wie PdM aufzeigt.
4. Einsatz von Predictive Maintenance im Incident Management: Dieses Kapitel stellt den Kern der Arbeit dar. Es analysiert detailliert, wie PdM in verschiedenen Bereichen des Incident Managements eingesetzt werden kann – bei Software, Hardware und der Auswertung von Logdaten. Für jeden Bereich werden konkrete Beispiele und Anwendungsfälle diskutiert, um die Möglichkeiten und das Potenzial von PdM aufzuzeigen. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der PdM-Anwendungen in diesen Bereichen werden gründlich beleuchtet und in einen Gesamtkontext eingeordnet.
Schlüsselwörter
Predictive Maintenance, Incident Management, ITIL, IT-Betriebsführung, IT-Infrastruktur, Software, Hardware, Logdatenanalyse, Verfügbarkeit, Effizienz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Einsatz von Predictive Maintenance im Incident Management"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einsatz von Predictive Maintenance (PdM) im Incident Management der IT-Betriebsführung. Das Ziel ist die Analyse der Möglichkeiten und Herausforderungen von PdM zur Verbesserung der IT-Verfügbarkeit und -Effizienz.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem Predictive Maintenance im Kontext von ITIL, die Ursachen von Incidents in der IT-Infrastruktur, Anwendungsbeispiele von PdM für Software und Hardware, die Auswertung von Logdaten für prädiktive Wartung sowie die Potenziale und Limitationen von PdM im Incident Management.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Motivation, Methodik, Aufbau), Grundlagen (ITIL, Incident Management, Maintenance, PdM), Herausforderungen in der IT-Betriebsführung, Einsatz von PdM im Incident Management (Software, Hardware, Logdaten) und Zusammenfassung und Fazit.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema PdM im Incident Management ein, begründet die Themenwahl, beschreibt die Methodik der Arbeit und gibt einen Überblick über den Aufbau. Die Motivation wird dargelegt und die Bedeutung effizienten Incident Managements hervorgehoben.
Welche Grundlagen werden im zweiten Kapitel behandelt?
Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar. Es erläutert ITIL als Rahmen für IT Service Management, beschreibt detailliert das Incident Management und definiert verschiedene Arten von Maintenance mit Fokus auf PdM, dessen Eigenschaften, Vorteile und Herausforderungen.
Welche Herausforderungen in der IT-Betriebsführung werden beleuchtet?
Kapitel 3 beleuchtet die Herausforderungen in der IT-Betriebsführung, die durch PdM adressiert werden können. Der Fokus liegt auf Schwierigkeiten bei der Identifikation, Prävention und Behebung von Incidents. Es wird die Problematik und der Bedarf an innovativen Lösungen wie PdM aufgezeigt.
Wie wird der Einsatz von PdM im Incident Management analysiert?
Kapitel 4 analysiert detailliert den Einsatz von PdM in verschiedenen Bereichen des Incident Managements (Software, Hardware, Logdatenanalyse). Es werden konkrete Beispiele und Anwendungsfälle diskutiert, um Möglichkeiten und Potenziale von PdM aufzuzeigen, inklusive Vor- und Nachteile.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Predictive Maintenance, Incident Management, ITIL, IT-Betriebsführung, IT-Infrastruktur, Software, Hardware, Logdatenanalyse, Verfügbarkeit, Effizienz.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit IT-Betriebsführung, Incident Management und Predictive Maintenance beschäftigen, insbesondere für Studierende, Wissenschaftler und Fachleute im IT-Bereich.
Wo finde ich die vollständige Arbeit?
Die vollständige Arbeit ist leider nicht in diesem FAQ enthalten. Dieser Text stellt lediglich eine Zusammenfassung und einen Überblick über den Inhalt dar.
- Quote paper
- Ugur Ataman (Author), 2017, Einsatz von Predictive Maintenance im Incident Management der IT-Betriebsführung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412235