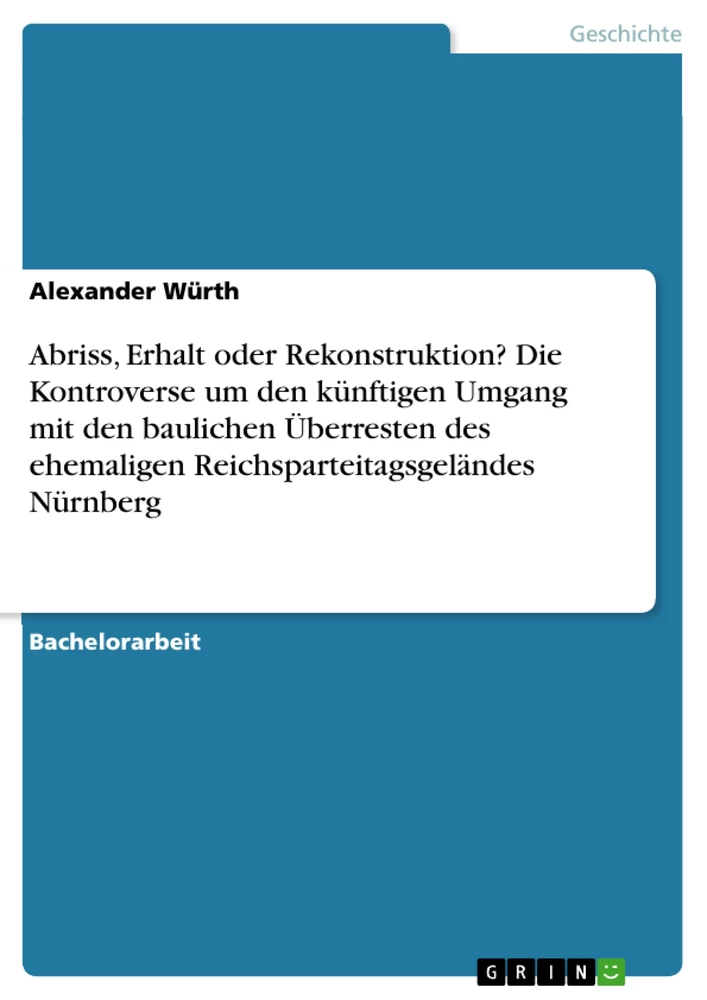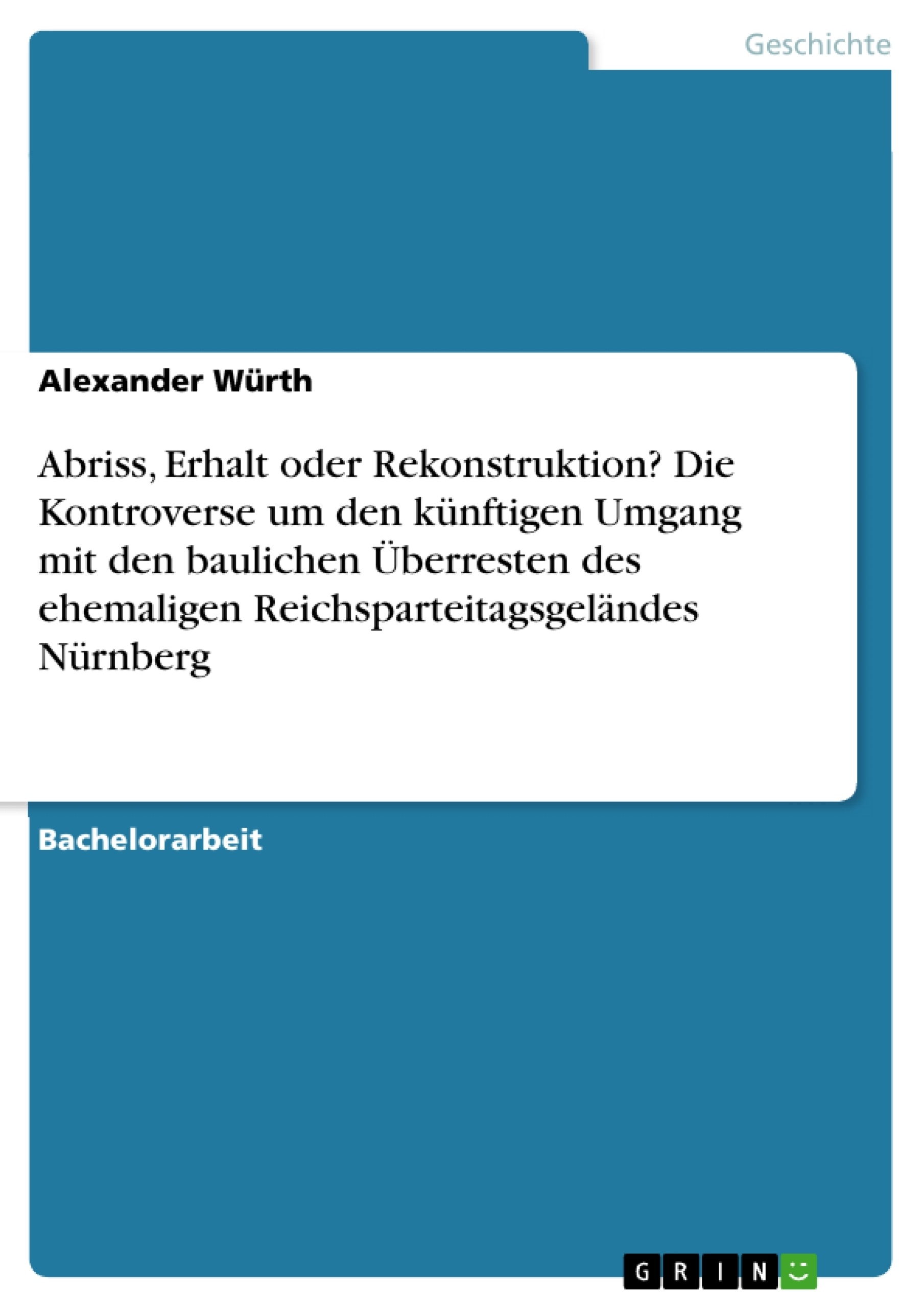Im Nationalsozialismus hatte die Architektur, die Hitler zur Staatskunst erhoben hatte, herausgehobene propagandistische Funktionen. Die in Nürnberg entstandenen Bauten der nationalsozialistischen Architektur, wurden von Hitler und seinen Architekten als Beleg für den Ewigkeitsanspruch des "Dritten Reiches" entworfen. Sie waren nach wenigen Reichsparteitagen und sechs Kriegsjahren nichts weiter als ein riesiges Aufmarschgelände mit mehreren stillgelegten Großbaustellen vor den Toren des fast vollständig zerstörten Nürnbergs.
Dennoch sind die baulichen Hinterlassenschaften im Kontrast zur sonstigen Bebauung und Infrastruktur so überdimensional, dass sie bis heute den Südosten Nürnbergs optisch prägen. Wie mit dieser Hinterlassenschaft, dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände, umgegangen werden soll, hat die Nürnberger Bevölkerung und auch überregionale Öffentlichkeit seit Kriegsende 1945 schon mehrfach beschäftigt. Mehrere Generationen haben sich mit dem Erbe der baulichen Überreste nationalsozialistischer Selbstinszenierung auseinandergesetzt - und dies geschah über die vergangenen 70 Jahre hinweg auf unterschiedliche Weise: Zunächst herrschten Pragmatismus und Verdrängung vor. Pragmatismus deshalb, weil das Wenige, das nutzbar schien, weitergenutzt wurde - die Zeppelintribüne als das, was sie auch bei den Reichsparteitagen war, als Zuschauertribüne und das Zeppelinfeld als Versammlungs- und Veranstaltungsort für Massenveranstaltungen. Verdrängung deshalb, weil auch Teile des Geländes und der Bauten einfach beseitigt wurden. Von der Luitpoldarena und ihren Zuschauertribünen, vom Märzfeld mit seinen gigantischen Türmen ist nichts mehr zu sehen. Die Kolonnaden der Zeppelintribüne wurden 1967 gesprengt, die Seitentürme abgetragen. Über die Beseitigungen hinaus ist auch die Weiternutzung der Bauten jahrzehntelang ohne jeglichen Hinweis auf die Geschichte und Bedeutung des Geländes geblieben, die "trivialisierte Nutzung" der Bauten außerhalb historischer Einordnung kann auch als Verdrängung interpretiert werden.
So steht Nürnberg und das Reichsparteitagsgelände durchaus symptomatisch für einen nicht nur hier vorzufindenden wechselhaften Umgang mit dem Erbe des Nationalsozialismus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz
- Fragestellung und Methode
- Forschungsstand und Quellenlage
- Reichsparteitagsgelände - Eine Kontroverse
- Geschichte des Areals bis 1945
- Vom Wasserspeicher zum Freizeitpark
- Errichtung des Reichsparteitagsgeländes und Erweiterungspläne
- Kulisse für die Inszenierung des Nationalsozialismus
- Kriegsjahre
- Nutzung nach 1945
- Pragmatismus
- Verdrängung
- Aufarbeitung
- Positionen zum künftigen Umgang
- Bestandserhalt
- Kontrollierter Verfall
- Rückbau
- Rekonstruktion
- Künstlerische Nutzung
- Beseitigung
- Rechts- und Beschlusslage
- Denkmalschutz
- Stadt Nürnberg
- Freistaat Bayern
- Bundesrepublik Deutschland
- Aktuelle Maßnahmen
- Schluss
- Bewertung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Kontroverse um den Umgang mit den baulichen Überresten des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg. Ziel ist es, die verschiedenen Positionen und die historische Entwicklung der Auseinandersetzung mit diesem NS-Erbe zu analysieren und zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Nutzungen des Geländes seit 1945 und die damit verbundenen politischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Aspekte.
- Die Geschichte des Reichsparteitagsgeländes von seiner Entstehung bis zur Gegenwart.
- Die unterschiedlichen Positionen zum künftigen Umgang mit den baulichen Überresten.
- Die Rolle des Denkmalschutzes und der politischen Entscheidungsfindung.
- Die Auseinandersetzung der Nürnberger Bevölkerung und Öffentlichkeit mit dem NS-Erbe.
- Die Entwicklung des Umgangs mit dem Gelände von Pragmatismus und Verdrängung hin zur Aufarbeitung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung legt die Relevanz der Thematik dar, indem sie Hitlers Aussage über die Ewigkeit der Reichsparteitagbauten zitiert und den Kontrast zur Realität nach dem Krieg beschreibt. Sie skizziert die Fragestellung der Arbeit und die verwendete Methode. Die Einleitung hebt die langjährige und vielschichtige Auseinandersetzung der Nürnberger Bevölkerung mit dem Erbe des Geländes hervor, von anfänglichem Pragmatismus und Verdrängung bis hin zur heutigen Aufarbeitung. Der Fokus liegt auf der einzigartigen Bedeutung der Bauten als zentrale Stätte nationalsozialistischer Machtinszenierung.
Reichsparteitagsgelände - Eine Kontroverse: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte des Geländes, beginnend mit seiner Nutzung vor 1945 als Wasserspeicher und Freizeitpark bis hin zur Errichtung der monumentalen Bauten der NS-Zeit. Es beschreibt detailliert die Rolle des Geländes als Kulisse für die nationalsozialistische Propaganda und seine Nutzung während des Krieges. Im Anschluss analysiert das Kapitel den Umgang mit dem Gelände nach 1945, von pragmatischer Weiternutzung über Verdrängung bis hin zur wachsenden Aufarbeitung des NS-Erbes. Die verschiedenen Positionen zum künftigen Umgang mit den Überresten (Bestandserhalt, kontrollierter Verfall, Rückbau, Rekonstruktion, künstlerische Nutzung, Beseitigung) werden vorgestellt. Schließlich werden die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie aktuelle Maßnahmen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Reichsparteitagsgelände, Nürnberg, Nationalsozialismus, NS-Architektur, Denkmalschutz, Erinnerungskultur, Aufarbeitung, Kontroverse, Pragmatismus, Verdrängung, Bestandserhalt, Rückbau, Rekonstruktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: "Reichsparteitagsgelände Nürnberg - Eine Kontroverse"
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert die Kontroverse um den Umgang mit den baulichen Überresten des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg. Sie untersucht die verschiedenen Positionen und die historische Entwicklung der Auseinandersetzung mit diesem NS-Erbe.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Geschichte des Geländes von seiner Entstehung bis zur Gegenwart, die unterschiedlichen Positionen zum künftigen Umgang mit den Überresten (Bestandserhalt, kontrollierter Verfall, Rückbau, Rekonstruktion etc.), die Rolle des Denkmalschutzes und der politischen Entscheidungsfindung, die Auseinandersetzung der Nürnberger Bevölkerung mit dem NS-Erbe und die Entwicklung des Umgangs mit dem Gelände von Pragmatismus und Verdrängung hin zur Aufarbeitung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zum Reichsparteitagsgelände als Kontroverse und einen Schluss. Die Einleitung beschreibt die Relevanz des Themas, die Fragestellung und die Methode. Das Hauptkapitel behandelt die Geschichte des Geländes, die verschiedenen Positionen zum Umgang mit den Überresten, die Rechtslage und aktuelle Maßnahmen. Der Schluss beinhaltet eine Bewertung und einen Ausblick.
Welche Positionen zum Umgang mit dem Gelände werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert und diskutiert verschiedene Positionen zum Umgang mit den baulichen Überresten, darunter Bestandserhalt, kontrollierter Verfall, Rückbau, Rekonstruktion, künstlerische Nutzung und Beseitigung.
Welche Rolle spielt der Denkmalschutz?
Die Rolle des Denkmalschutzes und der politischen Entscheidungsfindung auf Bundes-, Landes- und städtischer Ebene wird in der Arbeit analysiert und in Bezug zu den verschiedenen Positionen zum Umgang mit dem Gelände gesetzt.
Wie wird die Entwicklung des Umgangs mit dem Gelände beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung des Umgangs mit dem Gelände von anfänglichem Pragmatismus und Verdrängung hin zu einer umfassenderen Aufarbeitung des NS-Erbes.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf einen Forschungsstand und Quellenlage, die in der Einleitung näher erläutert werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Reichsparteitagsgelände, Nürnberg, Nationalsozialismus, NS-Architektur, Denkmalschutz, Erinnerungskultur, Aufarbeitung, Kontroverse, Pragmatismus, Verdrängung, Bestandserhalt, Rückbau, Rekonstruktion.
Wo finde ich mehr Informationen?
(Hier könnte ein Link zur vollständigen Bachelorarbeit eingefügt werden, falls verfügbar)
- Citation du texte
- B.A. Alexander Würth (Auteur), 2017, Abriss, Erhalt oder Rekonstruktion? Die Kontroverse um den künftigen Umgang mit den baulichen Überresten des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes Nürnberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412335