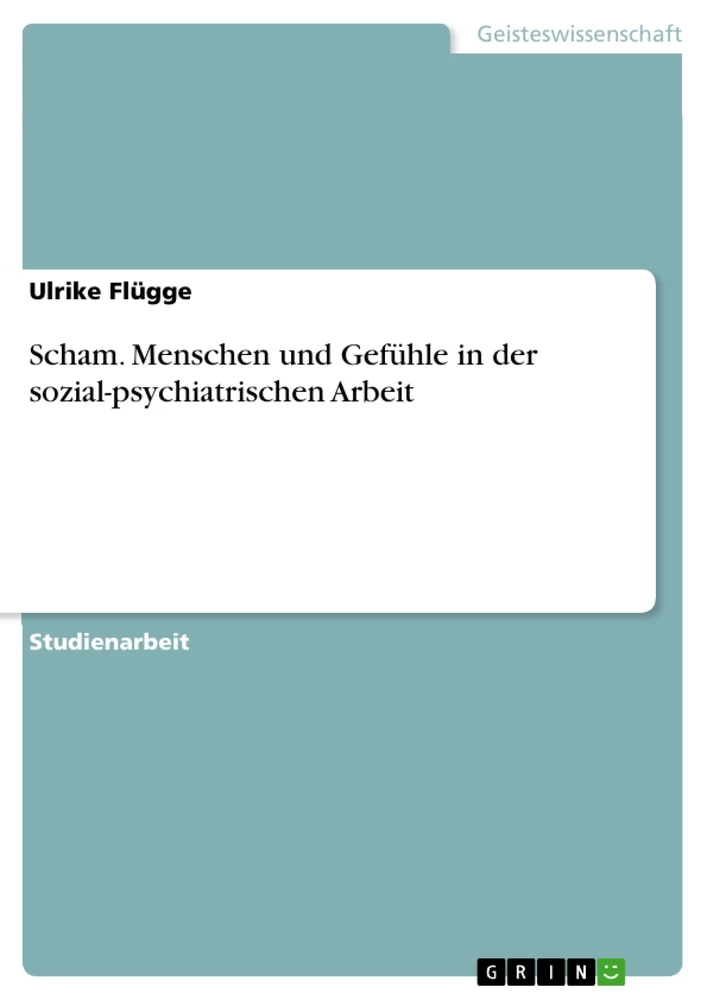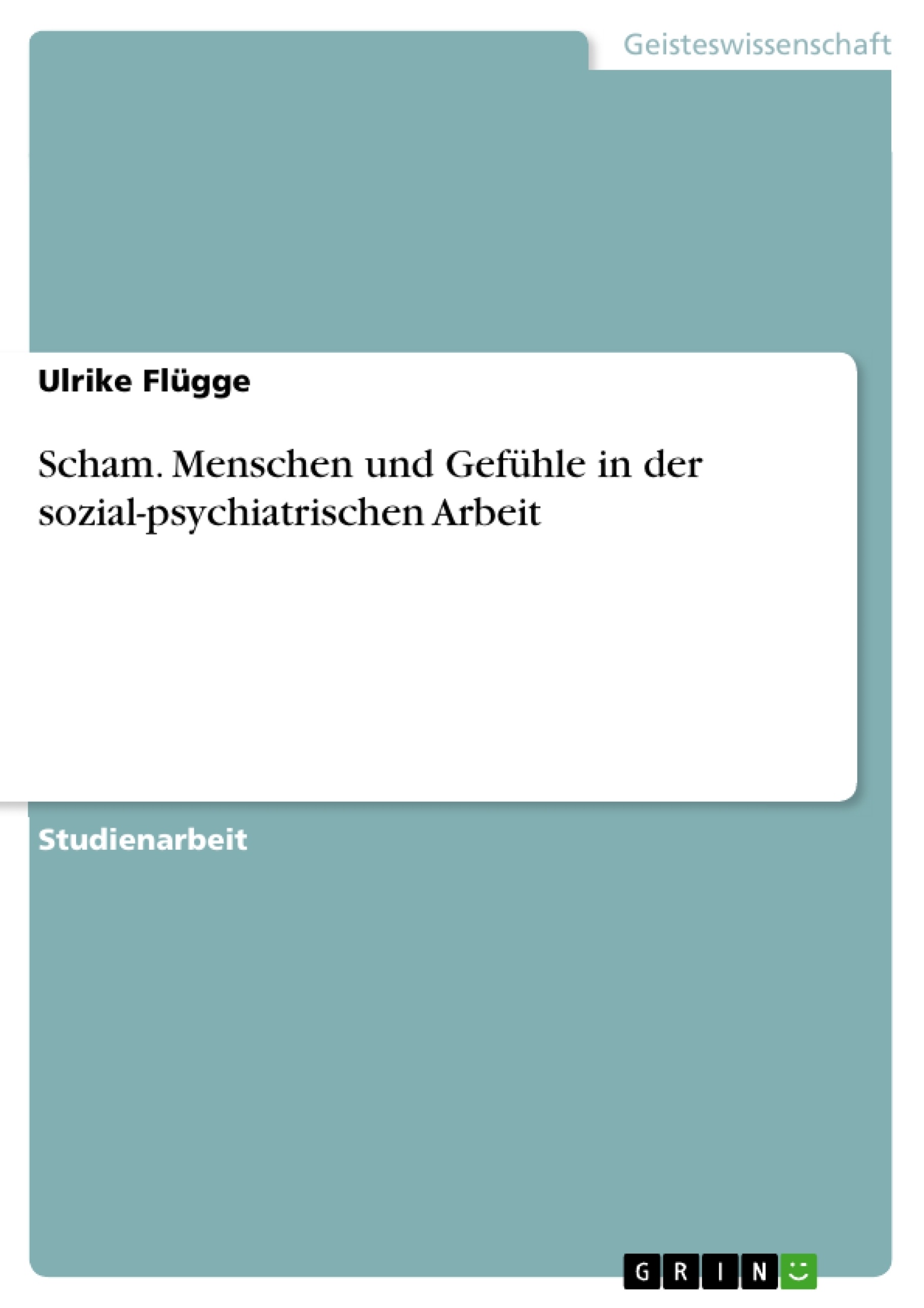Scham ist ein starkes und äußerst unangenehmes Gefühl, das jeder Mensch kennt und wohl keiner gerne spüren will. Es wird oft unterschätzt und hat bei weitem mehr als nur mit Sexualität oder Intimität zu tun. Menschenwohl geläufig. In der allgemeinen Kranken-und Altenpflege begegnet uns Pflegenden das ThemaScham und der Umgang mit Schamgefühlen allerdings sichtbar häufiger und bewusster. Das mag zum Teil sicher daran liegen, dass immer mehr Literatur wie u.a. das Buch Scham und Würde in der Pflege von Immenschuh und Marks auf dem Markt erscheint und an der Tatsache, dass die Medien, ob einiger der Missstände aufmerksamer werden und mehr aus dem Pflegealltag sowie den Zuständen und Behandlungen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern berichten.
Wie bewusst gehen wir nun mit dem Thema Scham und Schamgefühle in der ambulanten psychiatrischen Pflege um? Woran mag es liegen, dass das Thema so wenig Thema ist? Ist es überhaupt ein Thema? Müssen wir uns damit beschäftigen? Auf keinen Fall zu viel oder zu tief über Gefühle reden – werden wir unseren Patienten so wirklich gerecht? Ist es schon Therapie oder geht es nicht zumindest in die Richtung, wenn verdrängte Gefühle zur Sprache kommen? Liegt es somit dann außerhalb unseres Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiches oder unserer Fachkompetenz?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Scham - Menschen und Gefühle in der sozial psychiatrischen Arbeit
- 2.1 Begegnung mit dem Thema Scham
- 2.2 Was sind Schamgefühle?
- 2.3 Was sind Schuldgefühle?
- 2.4 Formen von Scham
- 2.5 Zeichen von Scham
- 2.6 Abwehrmechanismen
- 3. Umgang mit Schamgefühlen in der sozial psychiatrischen Arbeit
- 3.1. Scham hat auch immer eine positive Funktion
- 3.2 Was können wir in unserer Arbeit konkret tun?
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit beschäftigt sich mit dem Thema Scham im Kontext der sozialpsychiatrischen Arbeit. Sie analysiert die Bedeutung von Schamgefühlen für die betroffenen Menschen und die Herausforderungen, die diese Gefühle für die professionelle Arbeit mit psychisch kranken Menschen darstellen. Die Arbeit untersucht die Entstehung von Scham, ihre unterschiedlichen Formen und ihre Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, das Verhalten und die zwischenmenschlichen Beziehungen.
- Scham als ein starkes und oft verdrängtes Gefühl
- Die Entstehung und Ausprägung von Schamgefühlen im Kontext von Kultur, Religion, Erziehung und Umwelt
- Die Auswirkungen von Scham auf das Selbstwertgefühl und das Verhalten
- Die Rolle von Scham in der Entstehung und Bewältigung psychischer Störungen
- Der Umgang mit Scham in der sozialpsychiatrischen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Scham ein und stellt die Relevanz dieses Gefühls im Kontext der sozialpsychiatrischen Arbeit heraus. Sie beleuchtet die Bedeutung von Schamgefühlen für die Lebenswelt psychisch kranker Menschen und verdeutlicht die Notwendigkeit eines professionellen Umgangs mit diesen Gefühlen.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Phänomen Scham. Es beleuchtet die Entstehung von Schamgefühlen und analysiert, wie diese durch verschiedene Faktoren wie Kultur, Religion, Erziehung und Umwelt geprägt werden. Weiterhin werden verschiedene Formen von Scham vorgestellt sowie ihre Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und das Verhalten der Betroffenen.
Kapitel 3 widmet sich dem Umgang mit Schamgefühlen in der sozialpsychiatrischen Arbeit. Es untersucht die Bedeutung der Scham als ein emotionales Signal und ihre Rolle in der Bewältigung psychischer Störungen.
Schlüsselwörter
Scham, Schuld, psychische Erkrankungen, sozialpsychiatrische Arbeit, Selbstwertgefühl, Verhalten, zwischenmenschliche Beziehungen, Affektlogik, Deckaffekte, Lebensereignisse, Therapie, Beziehung, Vertrauen, Verarbeitung, Reflexion, Selbstbewusstsein, Isolation, Verleugnung, Rückzug, Behandlung, Pflege, Interaktion, Veränderung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Scham- und Schuldgefühlen?
Schuld bezieht sich auf eine Tat („Ich habe etwas falsch gemacht“), während Scham die gesamte Person betrifft („Ich bin falsch/unwürdig“).
Warum wird das Thema Scham in der Pflege oft unterschätzt?
Es ist ein äußerst unangenehmes Gefühl, das oft verdrängt wird. In der psychiatrischen Pflege wird es zudem seltener thematisiert als in der körperlichen Pflege.
Welche Zeichen deuten auf Schamgefühle hin?
Körperliche Zeichen können Erröten, Blickvermeidung oder Rückzug sein; psychisch äußert es sich oft durch Abwehrmechanismen oder Verleugnung.
Hat Scham auch eine positive Funktion?
Ja, Scham dient als Schutzfunktion für die eigene Intimität und Würde und signalisiert soziale Grenzen.
Wie sollten Pflegekräfte mit Schamgefühlen umgehen?
Durch einen bewussten Umgang, das Schaffen einer Vertrauensbasis und die Reflexion der eigenen Fachkompetenz können Patienten besser unterstützt werden.
- Quote paper
- Ulrike Flügge (Author), 2015, Scham. Menschen und Gefühle in der sozial-psychiatrischen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412402