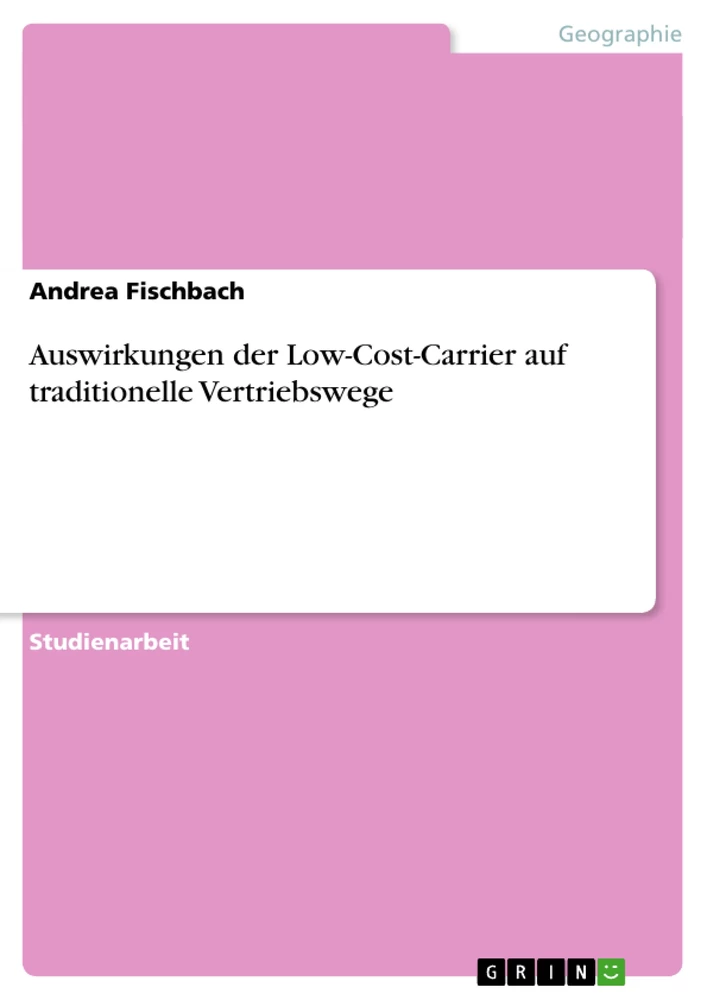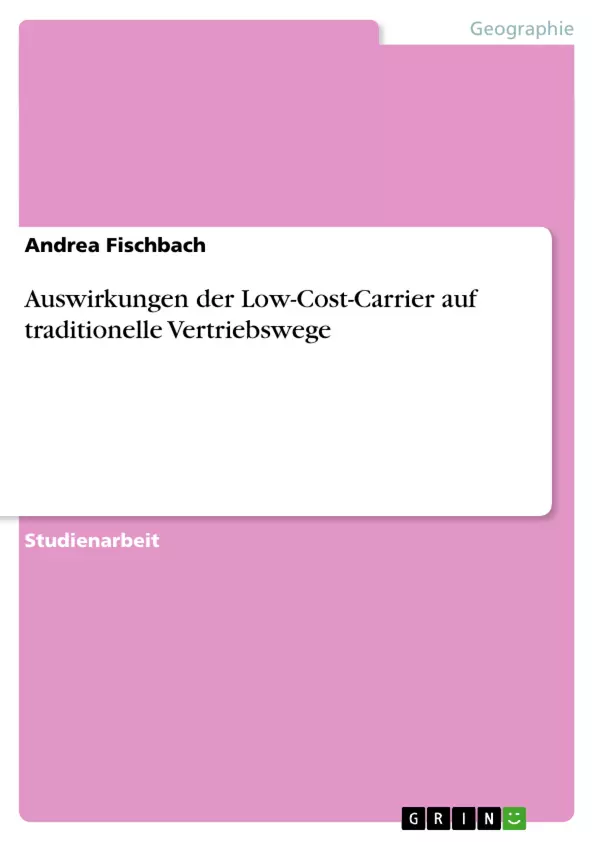Der Tourismus übernimmt eine immer wichtigere Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft. Es ist nahezu normal geworden, mindestens einmal im Jahr zu verreisen. Allerdings ist der Tourismus schon lange kein Massenmarkt mehr. Durch zunehmend bevorzugte Individualreisen sowie steigende, differenzierte Qualitätsansprüche der Reisenden verschärfen sich die Wettbewerbsbedingungen. Um dem enormen Informationsbedarf gerecht werden zu können, benötigt der Markt eine weitreichende Infrastruktur, welche sowohl die Ansprüche der Kunden als auch die der Touristiker erfüllt. Dies hat die Entwicklung der Computerreservierungssysteme hervorgerufen, die als der traditionelle Vertriebsweg gelten.
Die bedeutendste technologische Entwicklung ist jedoch das Internet. Seine Akzeptanz steigt zunehmend und die Zahl der Personen mit Zugang zum Netz hat sich auch bereits vom Jahr 2000 mit ungefähr 14 Mio. auf ungefähr 34 Mio. im Jahr 2003 erhöht. Von dieser Entwicklung profitieren die Low-Cost-Carrier. Ryanair und Co. sind schon fast zur Normalität geworden. Immer häufiger werden selbstständig Kurztrips mit einer Billig-Airline geplant. Der direkte Vertriebsweg, der die Reisebüros übergeht, profitiert von der steigenden Akzeptanz des Internets in der Bevölkerung. Inwieweit dies sich auf die Agenturen auswirkt, ob ihre Existenz wirklich durch die Billigflieger gefährdet ist, wie sie reagieren können und welche Maßnahmen traditionelle Netzcarrier ergreifen, soll vorliegende Arbeit aufweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Reisebürobranche
- Begriffsdefinitionen
- Arten von Reisebüros
- Stellung der Reisebüros im touristischen Vertriebssystem
- Computerreservierungssysteme
- Bedeutung und Entstehung von CRS
- Ziele eines CRS
- Aufbau eines CRS
- Leistungskomponenten eines CRS
- Vergütungsstrukturen eines CRS
- Die bedeutendsten CRS
- Steigende Internetnutzung
- Vertriebsweg der Low-Cost-Carrier
- Vertriebsstrategie von Ryanair
- Vertriebsstrategie der anderen Billig-Airlines
- Buchungsverhalten der Low-Cost-Passagiere
- Mögliche Chance für die Reisebüros
- Reaktion der traditionellen Carrier
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Low-Cost-Carrier auf die traditionellen Vertriebswege im Tourismus, insbesondere auf die Rolle der Reisebüros im Kontext der wachsenden Internetnutzung. Sie analysiert die Vertriebsstrategien der Low-Cost-Carrier, insbesondere von Ryanair, und beleuchtet die Reaktionen der traditionellen Netzcarrier auf den Wettbewerb.
- Einfluss der Low-Cost-Carrier auf die Reisebürobranche
- Bedeutung von Computerreservierungssystemen (CRS) im traditionellen Vertrieb
- Steigende Akzeptanz des Internets und Auswirkungen auf das Reiseverhalten
- Vergleich der Vertriebsstrategien von Low-Cost- und traditionellen Fluggesellschaften
- Potenziale und Herausforderungen für die Reisebüros im Zeitalter der Billigflieger
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit thematisiert die wachsende Bedeutung des Tourismus und die damit verbundenen Herausforderungen im Wettbewerb. Sie stellt die Bedeutung von Computerreservierungssystemen (CRS) und die zunehmende Rolle des Internets im Reisemarkt heraus.
- Einführung in die Reisebürobranche: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Reisemittlers und beschreibt die verschiedenen Arten von Reisebüros. Es beleuchtet die Rolle der Reisebüros im touristischen Vertriebssystem.
- Computerreservierungssysteme: Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Bedeutung, Entstehung und Funktionsweise von CRS. Die wesentlichen Leistungskomponenten, die Struktur und Ziele sowie die Vergütungsstrukturen von Reservierungssystemen werden erläutert.
- Steigende Internetnutzung: Dieses Kapitel zeigt anhand von Daten die steigende Akzeptanz des Internets in der Bevölkerung auf. Es wird untersucht, welche Informationen und Leistungen Internetsurfer im Zusammenhang mit einer Urlaubsreise suchen oder buchen.
- Vertriebsweg der Low-Cost-Carrier: Dieses Kapitel analysiert die Vertriebsstrategien der Low-Cost-Carrier, insbesondere von Ryanair. Es wird auf das Buchungsverhalten der Low-Cost-Passagiere eingegangen.
- Mögliche Chance für die Reisebüros: Das Kapitel erörtert potenzielle Möglichkeiten für Reisebüros, im Geschäft mit den Billigfliegern erfolgreich zu sein.
- Reaktion der traditionellen Carrier: Dieses Kapitel betrachtet die Reaktionen der traditionellen Netzcarrier auf den Wettbewerb durch die Low-Cost-Carrier.
Schlüsselwörter
Low-Cost-Carrier, Reisebürobranche, Vertriebswege, Internet, Computerreservierungssysteme (CRS), Ryanair, traditionelle Netzcarrier, Tourismus, Buchungsverhalten, Vertriebsstrategie.
Häufig gestellte Fragen
Wie gefährden Low-Cost-Carrier traditionelle Reisebüros?
Billigflieger wie Ryanair setzen auf den Direktvertrieb über das Internet und umgehen damit die klassischen Vermittlungswege der Reisebüros.
Was sind Computerreservierungssysteme (CRS)?
CRS gelten als der traditionelle Vertriebsweg, über den Reisebüros Flüge und Leistungen buchen. Sie bilden das Rückgrat der touristischen Infrastruktur.
Warum profitieren Billigflieger so stark vom Internet?
Die steigende Akzeptanz des Internets ermöglicht es Kunden, Kurztrips und Flüge einfach selbst zu planen und direkt bei der Airline zu buchen.
Welche Chancen haben Reisebüros im Wettbewerb mit Billigfliegern?
Die Arbeit untersucht potenzielle Maßnahmen, wie Agenturen durch spezialisierte Beratung oder Zusatzleistungen im Geschäft mit Low-Cost-Passagieren bestehen können.
Wie reagieren traditionelle Netzcarrier (z.B. Lufthansa) auf den Druck?
Traditionelle Fluggesellschaften passen ihre eigenen Vertriebsstrategien und Preismodelle an, um gegen die wachsende Konkurrenz der Billigflieger gewappnet zu sein.
- Quote paper
- Andrea Fischbach (Author), 2004, Auswirkungen der Low-Cost-Carrier auf traditionelle Vertriebswege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41243