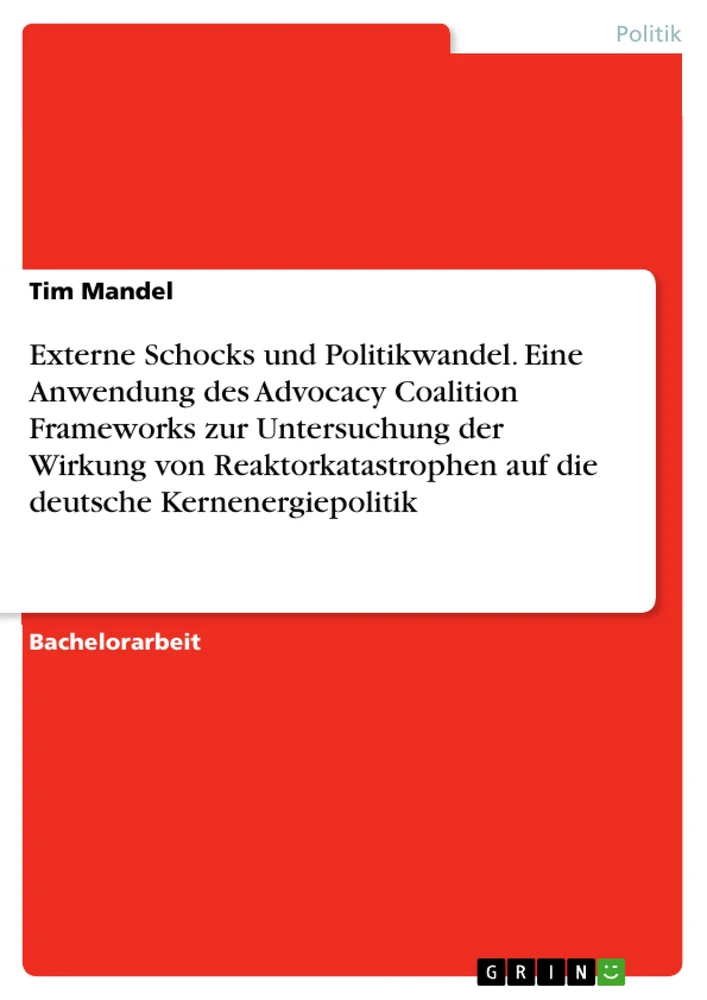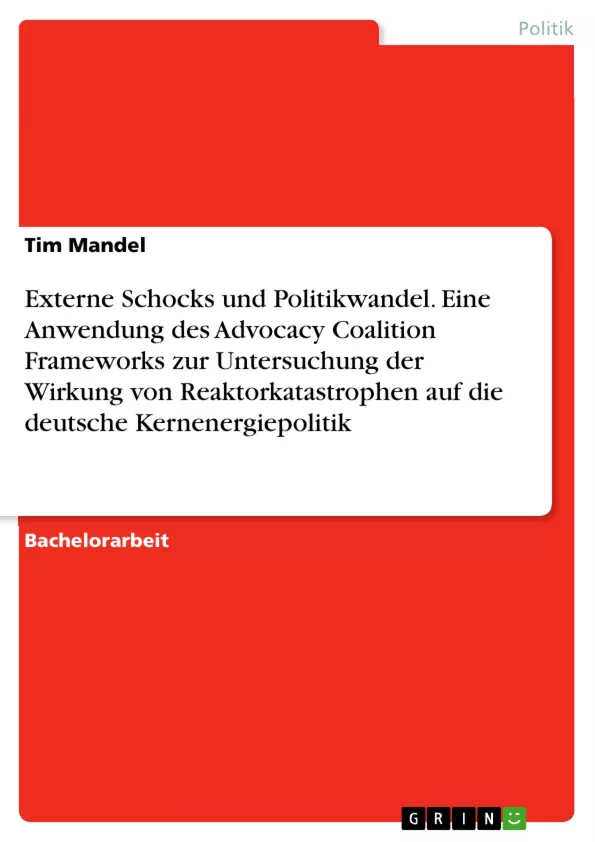Die Geschichte der zivilen Kernenergienutzung ist von zwei schwerwiegenden Katastrophen geprägt. Am 26. April 1986 kommt es im Kernkraftwerk Tschernobyl in der heutigen Ukraine während eines simulierten Stromausfalls zur Explosion des Reaktorkerns, der große Mengen Radioaktivität in die Luft freisetzt, der Wind trägt mehrere radioaktive Wolken nach Europa und kontaminiert weitläufige Gebiete. Knapp 25 Jahre später führt das Tohoku-Seebeben vor der Nordküste Japans und mit damit ausgelösten Tsunami-Welle im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in drei Reaktoren der Anlage zu Kernschmelzen sowie zu mehreren Explosionen im Kraftwerksgebäude, die ebenfalls zu unkontrollierter Freisetzung von Radioaktivität führen.
Beide Katastrophen werden heute als katastrophaler Unfall auf Stufe 7 der INES-Skala eingestuft und lassen sich politikwissenschaftlich in einer von NOHRSTEDT und WEIBLE erstellten Typologie von Krisen beide dem Typ der »Policy-Proximate Crisis« zuordnen. Vergleicht man mit Blick auf Deutschland die politischen Konsequenzen aus beiden Katastrophen, so zeigen sich zwei entgegengesetzte Entwicklungen. Im Zuge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl beschränkt sich die Schwarz-Gelbe Regierung unter Bundeskanzler Kohl, trotz zahlreicher gesellschaftlicher Forderungen nach einem Ausstieg aus der Kernenergienutzung, auf sicherheitstechnische Untersuchungen aller Kernkraftwerke. Eine direkte Kursänderung ist hier keineswegs erkennbar, der Ausbau der Kernenergie wird von der Regierung weiter forciert. Im Gegensatz dazu führt die Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 zu einer politischen Kehrtwende der Schwarz-Gelben Regierung unter Kanzlerin Merkel. Nur wenige Monate zuvor, im September 2010, hatte die Regierung unter großem gesellschaftlichen Protest eine weitreichende Verlängerung der Betriebslaufzeiten für deutsche Kernkraftwerke beschlossen und damit den unter Kanzler Schröder im Jahr 2000 erreichten Atomkonsens für nichtig erklärt. In Anbetracht der fortschreitenden Katastrophe in Fukushima beschließt der Deutsche Bundestag am 30. Juni 2011 jedoch kurzerhand mit großer Mehrheit aus Regierung und Opposition mit der Energiewende ein umfassendes Gesetzespaket.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen - Advocacy Coalition Framework
- 2.1 Entstehung und Ziel des ACF
- 2.2 Zentrale Annahmen und Elemente
- 2.3 Externe Ereignisse und Politikwandel
- 3. Methodische Anmerkungen
- 4. Die Katastrophe von Tschernobyl (Untersuchungszeitraum I)
- 4.1 Stabile Beliefs und Ressourcen vor Tschernobyl
- 4.2 Begrenztes Policy-Lernen
- 4.3 Begrenzte Umverteilung von Ressourcen
- 5. Die Katastrophe von Fukushima (Untersuchungszeitraum II)
- 5.1 Laufzeitverlängerung und Energiekonzept vor Fukushima
- 5.2 Umfassendes Policy-Lernen
- 5.3 Umfassende Neuverteilung von Ressourcen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima auf die deutsche Kernenergiepolitik. Sie setzt dabei das Advocacy Coalition Framework (ACF) ein, um zu erklären, warum die Katastrophe von Tschernobyl zu einem vergleichsweise geringen Politikwandel führte, während die Katastrophe von Fukushima zu einer umfassenden politischen Kehrtwende führte.
- Das ACF als theoretisches Modell zur Erklärung von Politikwandel
- Die Rolle externer Ereignisse wie Reaktorkatastrophen
- Der Einfluss von Beliefs und Ressourcen auf die Politikgestaltung
- Policy-Lernen und die Umverteilung von Ressourcen im Kontext der Katastrophen
- Die unterschiedlichen Reaktionen auf die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima in der deutschen Kernenergiepolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor, die sich mit den unterschiedlichen politischen Konsequenzen der Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima beschäftigt. Es stellt die beiden Katastrophen im Kontext der deutschen Kernenergiepolitik dar und beleuchtet die Diskrepanz zwischen der vergleichsweise geringen Reaktion auf Tschernobyl und der umfassenden Kehrtwende nach Fukushima.
- Kapitel 2: Theoretischer Rahmen - Advocacy Coalition Framework
Dieses Kapitel erläutert das Advocacy Coalition Framework (ACF) als theoretisches Modell zur Erklärung von Politikwandel. Es stellt die Entstehung und Ziele des ACF sowie zentrale Annahmen und Elemente vor. Darüber hinaus behandelt es die Rolle externer Ereignisse und deren Einfluss auf den Politikprozess im ACF.
- Kapitel 3: Methodische Anmerkungen
Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Ansätze und Vorgehensweisen der Arbeit.
- Kapitel 4: Die Katastrophe von Tschernobyl (Untersuchungszeitraum I)
Dieses Kapitel analysiert die politische Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986. Es untersucht die Stabilität der Beliefs und Ressourcen vor Tschernobyl, das Ausmaß des Policy-Lernens und die Umverteilung von Ressourcen im Anschluss an die Katastrophe.
- Kapitel 5: Die Katastrophe von Fukushima (Untersuchungszeitraum II)
Dieses Kapitel analysiert die politische Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011. Es untersucht die politische Situation in Deutschland vor Fukushima, das Ausmaß des Policy-Lernens und die Umverteilung von Ressourcen im Anschluss an die Katastrophe.
Schlüsselwörter
Advocacy Coalition Framework, Politikwandel, Reaktorkatastrophe, Tschernobyl, Fukushima, Kernenergie, Deutschland, Beliefs, Ressourcen, Policy-Lernen, Umverteilung von Ressourcen, Status Quo.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Advocacy Coalition Framework (ACF)?
Das ACF ist ein politikwissenschaftliches Modell, das erklärt, wie Koalitionen aus Akteuren mit ähnlichen Glaubenssystemen (Beliefs) den politischen Wandel über lange Zeiträume beeinflussen.
Warum führte Tschernobyl nicht sofort zum Atomausstieg in Deutschland?
Trotz gesellschaftlicher Proteste blieben die Beliefs und Ressourcen der regierenden Koalition stabil; man beschränkte sich auf technische Sicherheitsprüfungen ohne Kursänderung.
Wie löste Fukushima die politische Kehrtwende 2011 aus?
Fukushima wirkte als externer Schock, der zu massivem "Policy-Lernen" und einer Neuverteilung von Ressourcen führte, wodurch die Regierung Merkel den Atomausstieg beschloss.
Was versteht man unter einer „Policy-Proximate Crisis“?
Dies ist ein Krisentyp, der inhaltlich eng mit einem Politikfeld verknüpft ist und dadurch das Potenzial hat, bestehende Überzeugungen und politische Strategien massiv infrage zu stellen.
Welche Rolle spielen Ressourcen im politischen Wandel?
Ressourcen (wie öffentliche Meinung oder Expertenwissen) sind entscheidend. Die Arbeit zeigt, wie sich nach Fukushima die öffentliche Meinung so stark verschob, dass die Pro-Atom-Koalition ihre Machtbasis verlor.
- Citar trabajo
- Tim Mandel (Autor), 2016, Externe Schocks und Politikwandel. Eine Anwendung des Advocacy Coalition Frameworks zur Untersuchung der Wirkung von Reaktorkatastrophen auf die deutsche Kernenergiepolitik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412877