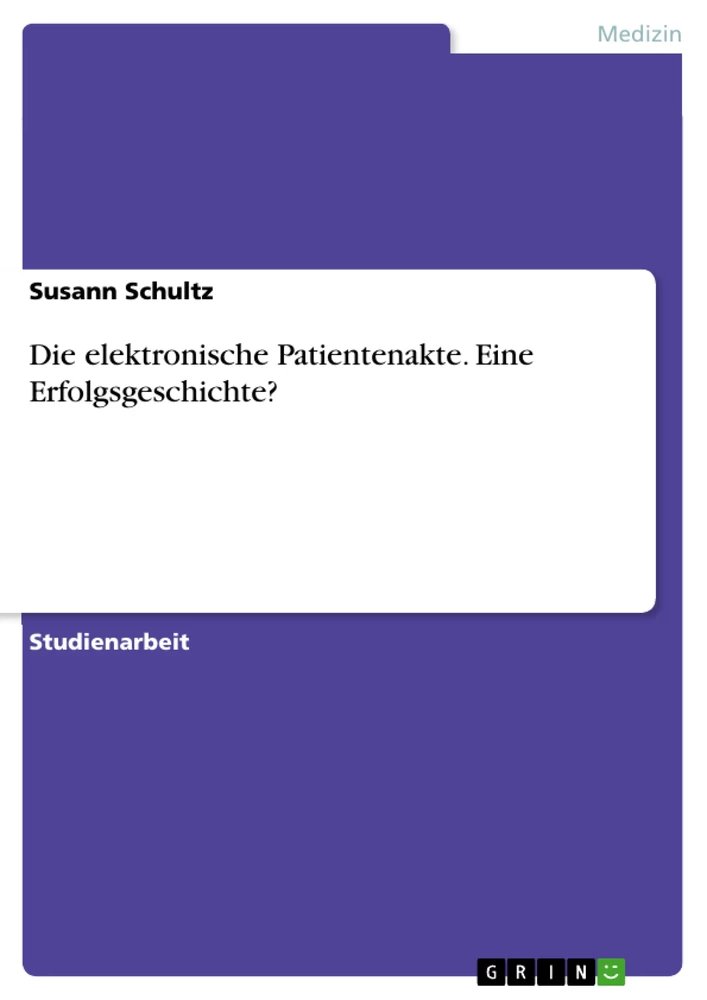Die demographische Entwicklung sowie die sich stetig wandelnde Erwartungshaltung der Gesellschaft betreffend Niveau und Qualität der medizinischen Versorgung sorgen dafür, dass das deutsche Gesundheitswesen stets Veränderungen ausgesetzt ist. Die permanenten regulatorischen Eingriffe in die Vergütungsstrukturen und Rahmenbedingungen der medizinischen Leistungserbringung tragen ihren Teil bei.
Vor dem Hintergrund der zahlreichen Gesundheitsreformen befinden sich Gesundheitsversorgungseinrichtungen in einem Prozess der Restrukturierung, wodurch die Wettbewerbsintensität in der medizinischen Leistungserbringung weiter zunimmt. Kostenreduzierung und Versorgungsqualität heißt es in Einklang zu bekommen. Ein vielversprechender Ansatz diesem Dilemma entgegenzuwirken bietet der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologie als ein Instrument zur Digitalisierung und Optimierung von Abläufen, Prozessen und Dokumentationsstrukturen. Die elektronische Patientenakte hat dabei eine Schlüsselrolle inne. Mit dem Ziel den am Behandlungsprozess eines Patienten beteiligten Personen die richtigen Informationen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bereitzustellen, soll sie dazu beitragen die Versorgung zu verbessern, die Qualität zu erhöhen und Kosten einzusparen.
Diese Arbeit befasst sich mit der elektronischen Patientenakte (EPA) und deren Vorteile gegenüber der papierbasierten Krankenakte, die in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen noch immer zum Standard gehört. Nach einführenden Begrifflichkeiten und der Erläuterung der verschiedenen Formen einer EPA werden technische, rechtliche und personelle Anforderungen im Zuge der Einführung einer elektronischen Patientenakte beschrieben. Anschließend wird ein Überblick über die aktuelle Marktsituation in Deutschland sowie im internationalen Raum zur Entwicklung und Nutzung einer EPA gegeben. Anhand des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und der dort eingesetzten Softwarelösung Soarian der Siemens AG wird schließlich ein Projekt vorgestellt, das als „Paradebeispiel“ für eine erfolgreiche Umsetzung der EPA dienen kann. Abschließend folgt eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer rechnergestützten Patientendokumentation.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ausgangssituation: Medizinische Dokumentation und papierbasierte Krankenakte
- 2 Die elektronische Patientenakte (EPA)
- 2.1 Definitionen und Begriffe / Formen der EPA
- 2.2 Inhalte der EPA
- 2.3 Ziele und Nutzen einer EPA
- 3 Anforderungen / Voraussetzungen der EPA
- 3.1 Rechtliche Anforderungen
- 3.1.1 Inhalte
- 3.1.2 Datenschutz
- 3.1.3 Datensicherheit
- 3.2 Technische Anforderungen
- 3.2.1 Interoperabilität
- 3.2.2 Technisches Umfeld
- 3.3 Personelle Anforderungen
- 3.4 Akzeptanzvoraussetzung
- 4 Internationaler Überblick
- 4.1 Deutschland
- 4.2 Österreich
- 4.3 Frankreich
- 4.4 Vereinigte Staaten
- 4.5 Australien
- 4.6 Asien
- 4.6.1 Singapur
- 4.6.2 Hong Kong
- 4.6.3 Taiwan
- 4.6.4 Japan
- 5 Praxisbeispiel: Soarian am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)
- 5.1 Über das UKE
- 5.2 Systemlandschaft / Einführung von Soarian
- 5.2.1 Soarian Clinicals
- 5.2.2 Soarian Health Archive
- 5.3 Papierloses Krankenhaus
- 5.3.1 Datenschutz und Datensicherheit
- 5.3.2 ISO-27001 Zertifizierung und EMRAM Award
- 6 Abwägung der Vor- und Nachteile
- 6.1 Vorteile
- 6.2 Nachteile
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die elektronische Patientenakte (EPA) und bewertet deren Erfolgspotenzial. Sie beleuchtet die Vor- und Nachteile im Vergleich zur papierbasierten Krankenakte und analysiert die Anforderungen an eine erfolgreiche Implementierung.
- Vergleich zwischen konventioneller und elektronischer Patientenakte
- Rechtliche und technische Anforderungen an die EPA
- Internationale Beispiele für die Einführung von EPAs
- Analyse eines Praxisbeispiels (Soarian am UKE)
- Abwägung der Vor- und Nachteile einer EPA
Zusammenfassung der Kapitel
1 Ausgangssituation: Medizinische Dokumentation und papierbasierte Krankenakte: Dieses Kapitel beschreibt die konventionelle Patientenakte, ihre Funktionsweise und Limitationen. Es wird deutlich, dass die papierbasierte Akte zwar Informationen zum Gesundheitszustand enthält, diese aber oft unstrukturiert, an einen Ort gebunden und nur eingeschränkt zugänglich sind. Die mangelnde Übersichtlichkeit und die Schwierigkeiten bei der Datenverarbeitung werden als zentrale Nachteile hervorgehoben, die zu Informationsverlusten und ineffizienten Arbeitsabläufen führen können. Die beschränkte Zugänglichkeit der Informationen für verschiedene Ärzte und Einrichtungen wird als weiterer wichtiger Kritikpunkt dargestellt.
2 Die elektronische Patientenakte (EPA): Dieses Kapitel führt den Leser in das Konzept der elektronischen Patientenakte ein. Es werden verschiedene Definitionen und Bezeichnungen der EPA vorgestellt und die Vorteile gegenüber der papierbasierten Akte herausgestellt. Die höhere Datenverfügbarkeit, die Möglichkeit des parallelen Zugriffs von verschiedenen Standorten und die verbesserte Übersichtlichkeit großer Datenmengen werden als Kernvorteile genannt. Das Kapitel legt den Grundstein für die detailliertere Betrachtung der EPA in den folgenden Kapiteln.
3 Anforderungen / Voraussetzungen der EPA: Dieses Kapitel fokussiert auf die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung der EPA. Es unterteilt die Anforderungen in rechtliche, technische und personelle Aspekte sowie die Akzeptanz der Nutzer. Die rechtlichen Anforderungen beinhalten Datenschutz und Datensicherheit, während die technischen Anforderungen Interoperabilität und das technische Umfeld umfassen. Die personellen Anforderungen beziehen sich auf die Schulung und Qualifikation des Personals. Die Akzeptanz der Nutzer spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der EPA-Einführung.
4 Internationaler Überblick: Der internationale Überblick bietet einen Vergleich der EPA-Einführung in verschiedenen Ländern (Deutschland, Österreich, Frankreich, USA, Australien und einigen asiatischen Ländern). Dieses Kapitel dient dazu, den Kontext und die unterschiedlichen Ansätze in der Umsetzung von elektronischen Patientenakten weltweit zu zeigen und einen umfassenderen Blick auf den Gegenstand zu ermöglichen.
5 Praxisbeispiel: Soarian am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE): Dieses Kapitel präsentiert ein detailliertes Praxisbeispiel der erfolgreichen Implementierung des Soarian-Systems am UKE. Es wird die Systemlandschaft beschrieben, die Implementierung von Soarian Clinicals und Soarian Health Archive erläutert und der Weg zum papierlosen Krankenhaus dargestellt. Die Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit sowie die Erlangung der ISO-27001 Zertifizierung und des EMRAM Awards werden als positive Beispiele für eine erfolgreiche Umsetzung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Elektronische Patientenakte (EPA), papierbasierte Krankenakte, Datenschutz, Datensicherheit, Interoperabilität, Rechtliche Anforderungen, Technische Anforderungen, Praxisbeispiel, Soarian, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Vorteile, Nachteile, internationaler Vergleich.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Elektronische Patientenakte (EPA)
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die elektronische Patientenakte (EPA) und bewertet deren Erfolgspotenzial im Vergleich zur papierbasierten Krankenakte. Sie analysiert die Anforderungen an eine erfolgreiche Implementierung und beleuchtet Vor- und Nachteile.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen Vergleich zwischen konventioneller und elektronischer Patientenakte, die rechtlichen und technischen Anforderungen an die EPA, internationale Beispiele für die Einführung von EPAs, eine Analyse eines Praxisbeispiels (Soarian am UKE) und eine Abwägung der Vor- und Nachteile einer EPA.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung mit Ausgangssituation (papierbasierte Krankenakte), eine Einführung in die elektronische Patientenakte (EPA), die Anforderungen an eine EPA (rechtliche, technische, personelle und Akzeptanz), einen internationalen Überblick zur EPA-Einführung in verschiedenen Ländern, ein Praxisbeispiel am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) mit dem Soarian-System und abschließend eine Abwägung der Vor- und Nachteile.
Welche Vorteile bietet eine elektronische Patientenakte?
Eine EPA bietet Vorteile wie höhere Datenverfügbarkeit, parallelen Zugriff von verschiedenen Standorten, verbesserte Übersichtlichkeit großer Datenmengen und effizientere Arbeitsabläufe im Vergleich zur papierbasierten Akte.
Welche Nachteile weist eine elektronische Patientenakte auf?
Die Hausarbeit analysiert auch die Nachteile einer EPA, die im Detail im entsprechenden Kapitel behandelt werden.
Welche rechtlichen Anforderungen müssen bei der Implementierung einer EPA beachtet werden?
Die rechtlichen Anforderungen umfassen insbesondere Datenschutz und Datensicherheit. Details dazu finden sich im Kapitel zu den Anforderungen an eine EPA.
Welche technischen Anforderungen sind für eine erfolgreiche EPA-Implementierung notwendig?
Zu den technischen Anforderungen gehören Interoperabilität und die Berücksichtigung des technischen Umfelds. Weitere Informationen bietet das Kapitel über die Voraussetzungen einer EPA.
Welches Praxisbeispiel wird in der Hausarbeit vorgestellt?
Die Hausarbeit präsentiert ein detailliertes Praxisbeispiel der erfolgreichen Implementierung des Soarian-Systems am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).
Welche Aspekte des Praxisbeispiels UKE werden behandelt?
Das Praxisbeispiel beschreibt die Systemlandschaft, die Implementierung von Soarian Clinicals und Soarian Health Archive, den Weg zum papierlosen Krankenhaus, Datenschutz und Datensicherheit sowie die ISO-27001 Zertifizierung und den EMRAM Award.
Welche Länder werden im internationalen Überblick zur EPA-Einführung betrachtet?
Der internationale Überblick umfasst Deutschland, Österreich, Frankreich, die Vereinigten Staaten, Australien und einige asiatische Länder (Singapur, Hong Kong, Taiwan, Japan).
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Elektronische Patientenakte (EPA), papierbasierte Krankenakte, Datenschutz, Datensicherheit, Interoperabilität, rechtliche Anforderungen, technische Anforderungen, Praxisbeispiel, Soarian, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Vorteile, Nachteile, internationaler Vergleich.
- Citar trabajo
- Dipl.-Inf. (FH) Susann Schultz (Autor), 2015, Die elektronische Patientenakte. Eine Erfolgsgeschichte?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412958