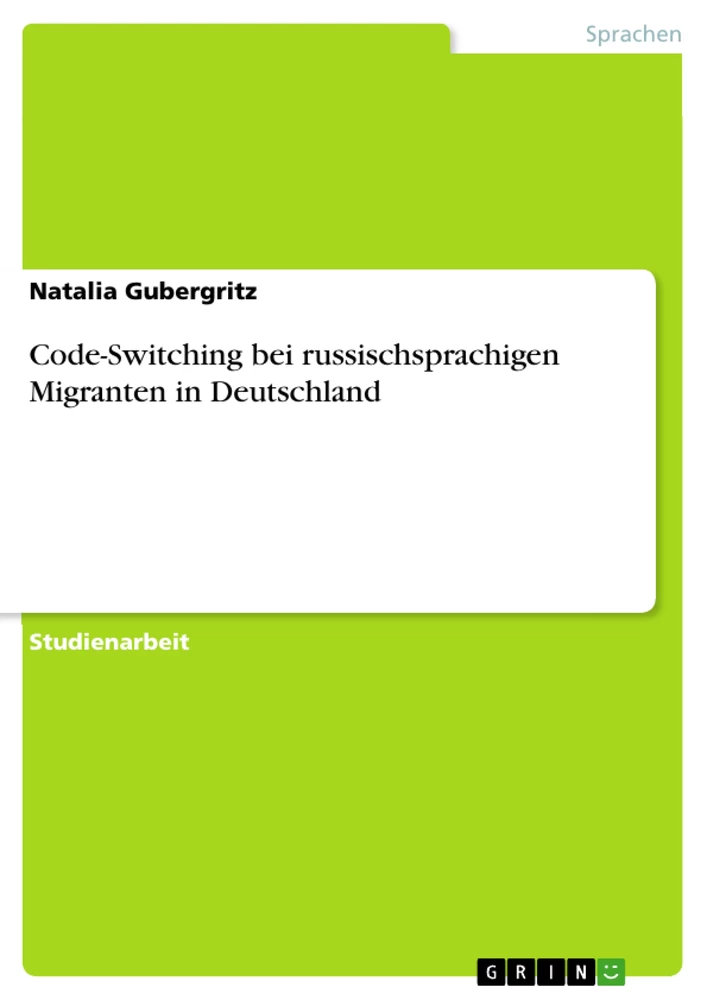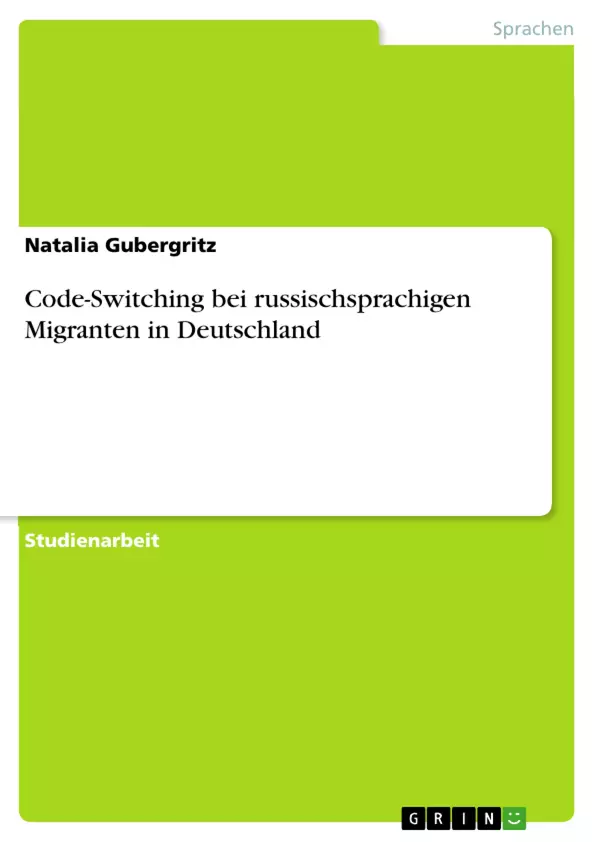Oft hört man beispielsweise Russlanddeutsche, die nach Zerfall der Sowjetunion zurück nach Deutschland immigriert sind, in einer „Mischsprache“ miteinander reden, und innerhalb einer Äußerung deutsch und russisch abwechselnd verwenden. Dieses interessante Phänomen nennt sich in der Linguistik Code-Switching. Dieses Code-Switching, insbesondere im Bezug auf russischsprachige Migranten, die in Deutschland leben, soll nun der Gegenstand dieser Arbeit sein. Im Folgenden soll der Begriff und die Definition des Code-Switching in der Forschung untersucht, eine Abgrenzung zur Entlehnung geschafft und geklärt werden, welche Auslöser es für dieses Phänomen gibt, und wie Konstruktionen der deutsch-russischen Mischsprache zustande kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Begrifflichkeit und Definition
- Code-Switching vs. Entlehnung
- Das Code-Switching bei russischsprachigen Migranten
- Wie entsteht Code-Switching? – Soziolinguistischer Ansatz
- Wie entsteht Code-Switching? – Psycholinguistischer Ansatz
- Wie entsteht Code-Switching? – Grammatikalischer Aspekt
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Code-Switching bei russischsprachigen Migranten in Deutschland. Sie untersucht den Begriff und die Definition des Code-Switching, grenzt ihn von Entlehnung ab und analysiert die Auslöser für dieses Phänomen.
- Begriff und Definition von Code-Switching
- Abgrenzung von Code-Switching und Entlehnung
- Soziolinguistische, psycholinguistische und grammatikalische Aspekte des Code-Switching
- Konstruktion der deutsch-russischen Mischsprache
- Bedeutung des Code-Switching für die kulturelle Identität von Migranten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext von Migration und Sprachkontakt in Deutschland und führt das Phänomen des Code-Switching bei russischsprachigen Migranten ein.
Zur Begrifflichkeit und Definition: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Begriffs „Bilingualismus“ in der Linguistik und zeigt die unterschiedlichen Ansätze zur Definition von Code-Switching.
Code-Switching vs. Entlehnung: Dieses Kapitel grenzt Code-Switching von Entlehnung ab, um die Unterschiede zwischen diesen Sprachkontaktphänomenen zu verdeutlichen.
Das Code-Switching bei russischsprachigen Migranten: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Ansätze zur Entstehung von Code-Switching, nämlich den soziolinguistischen, den psycholinguistischen und den grammatikalischen Aspekt.
Schlüsselwörter
Code-Switching, Bilingualismus, russischsprachige Migranten, Sprachkontakt, deutsch-russische Mischsprache, Soziolinguistik, Psycholinguistik, Grammatik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Code-Switching?
Code-Switching bezeichnet den fließenden Wechsel zwischen zwei Sprachen innerhalb eines Gesprächs oder sogar eines Satzes.
Warum nutzen russischsprachige Migranten Code-Switching?
Es dient oft als Ausdruck einer hybriden kulturellen Identität und wird sowohl durch soziale Faktoren als auch durch psycholinguistische Prozesse ausgelöst.
Was ist der Unterschied zwischen Code-Switching und Entlehnung?
Während Entlehnungen feste Bestandteile einer Sprache geworden sind, ist Code-Switching ein spontaner Wechsel zwischen zwei eigenständigen Sprachsystemen.
Welche soziolinguistischen Ansätze erklären das Phänomen?
Diese Ansätze untersuchen, wie Gesprächssituationen, Sprecherrollen und die soziale Umgebung den Sprachwechsel beeinflussen.
Wie entstehen deutsch-russische Mischsätze grammatikalisch?
Die Arbeit analysiert die grammatikalischen Regeln und Strukturen, die bestimmen, an welchen Stellen ein Sprachwechsel innerhalb eines Satzes möglich ist.
Ist Code-Switching ein Zeichen mangelnder Sprachkenntnisse?
Nein, in der Linguistik wird es oft als Ausdruck hoher bilingualer Kompetenz gesehen, da beide Sprachsysteme gleichzeitig beherrscht und koordiniert werden.
- Quote paper
- Natalia Gubergritz (Author), 2009, Code-Switching bei russischsprachigen Migranten in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412992