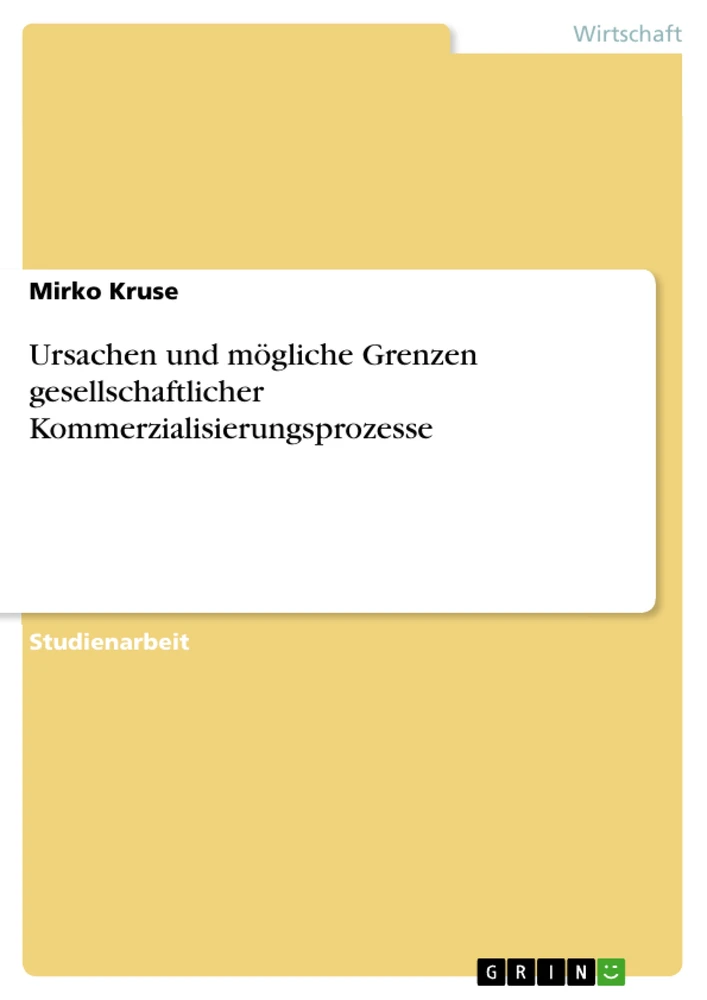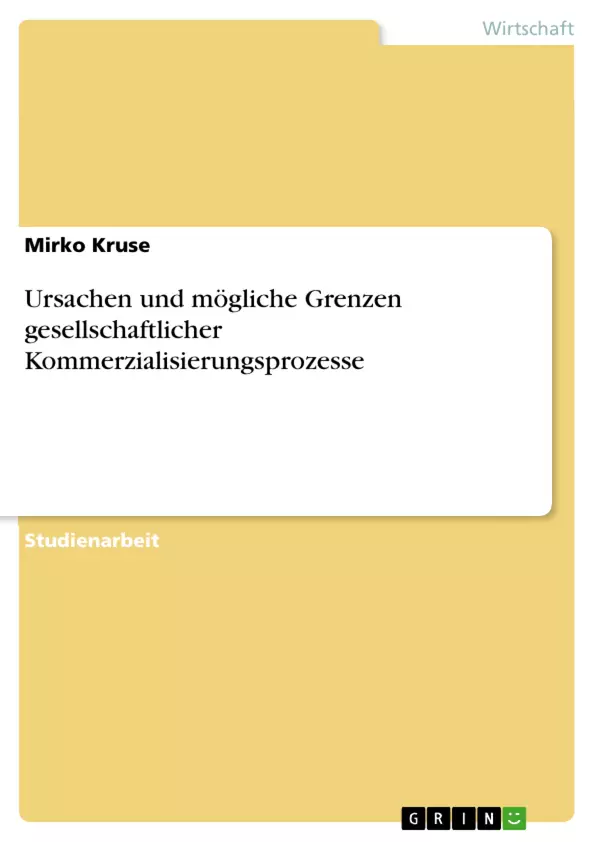In seinem Buch „Was man für Geld nicht kaufen kann“ erhebt Michael J. Sandel den Anspruch, die moralischen Grenzen des Marktes zu erkunden. Anhand empirischer Beispiele zeigt der Autor, dass der Charakter einer Dienstleistung bzw. eines Gutes in dem Moment eine Veränderung erfährt, in dem diese zu einer, auf dem Markt gehandelten und mit Geld zu erwerbenden, Ware gemacht wird. Allgemein ist der Prozess der Ausdehnung des Marktes, im folgenden als „Kommerzialisierung“ bezeichnet, ein bekanntes Phänomen der heutigen Gesellschaft. Trotz der kritischen Einschätzung Sandels scheint bisher jedoch keine Trendwende im Sinne einer verlangsamten oder gar beendeten Kommerzialisierung erkennbar.
Diese Ausarbeitung stellt daher einen Versuch dar, die Thesen Sandels auf ihre Aktualität und empirische Relevanz zu prüfen und den thematisch begrenzten Fokus um zwei Themenkomplexe zu erweitern. Einerseits soll untersucht werden, worin die systemischen Ursachen zunehmender Kommerzialisierung zu finden sind und sich der Frage zu nähern, wieso eine Trendumkehr bisher nicht erfolgt ist. Darüber hinaus wird eine sektorale Betrachtung vorgenommen, die am Beispiel des Gesundheitssektors eruieren soll, wie sich die Auswirkungen von Kommerzialisierung darstellen und inwiefern hier die moralische Grenze zu finden sein könnte, die Sandel im Untertitel seines Buches impliziert. Auf dieses Weise wird neben der gesellschaftlichen ebenso die unternehmerisch-individuelle Ebene in die Analyse mit einbezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung und strukturelle Ursachen des Kommerzialisierungsdrangs
- Kommerzialisierung in der Praxis
- Der Gesundheitssektor als Beispiel
- Diskussion möglicher Grenzen
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich mit der Frage der Kommerzialisierung und untersucht die These von Michael J. Sandel, dass der Charakter einer Dienstleistung oder eines Gutes durch Kommerzialisierung verändert wird. Die Arbeit geht auf die Ursachen und Auswirkungen der Kommerzialisierung ein und analysiert, wie diese sich im Gesundheitssektor widerspiegeln.
- Systemische Ursachen zunehmender Kommerzialisierung
- Auswirkungen der Kommerzialisierung im Gesundheitssektor
- Ethische Grenzen der Kommerzialisierung
- Moralische Bedenken im Kontext des menschlichen Körpers
- Die Rolle des Kapitalismus in der Kommerzialisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema Kommerzialisierung vor und führt in die Argumentation von Michael J. Sandel ein. Sie skizziert die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit und die Themen, die im weiteren Verlauf behandelt werden.
- Entwicklung und strukturelle Ursachen des Kommerzialisierungsdrangs: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Kommerzialisierungsprozesses und untersucht seine strukturellen Ursachen. Es beleuchtet den systemischen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Kommerzialisierung sowie die Rolle von Wachstum und Überproduktion.
- Kommerzialisierung in der Praxis: Das Kapitel beleuchtet die praktische Seite der Kommerzialisierung anhand des Beispiels des Gesundheitssektors. Es untersucht die ethischen Argumente gegen die Kommerzialisierung und sucht nach möglichen Grenzen.
Schlüsselwörter
Kommerzialisierung, Markt, Kapitalismus, Wachstum, Gesundheitssektor, Moral, Ethik, Sandel, Überproduktion, Externalisierungsgesellschaft, Entindividualisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Michael Sandel unter der Kommerzialisierung der Gesellschaft?
Sandel argumentiert, dass der Charakter von Gütern und sozialen Praktiken korrumpiert wird, wenn sie in Waren verwandelt werden, die man mit Geld kaufen kann.
Was sind die systemischen Ursachen der zunehmenden Kommerzialisierung?
Die Arbeit sieht die Ursachen im kapitalistischen Wachstumszwang, der Überproduktion und dem Drang, immer neue Lebensbereiche für den Markt zu erschließen.
Wie zeigt sich Kommerzialisierung im Gesundheitssektor?
Durch die Ökonomisierung von Krankenhausleistungen, bei der Profitabilität oft über das Patientenwohl gestellt wird, was zu ethischen Konflikten führt.
Gibt es moralische Grenzen für den Markt?
Ja, die Arbeit diskutiert Grenzen insbesondere dort, wo die Menschenwürde oder der menschliche Körper (z. B. Organhandel, Leihmutterschaft) zum Spekulationsobjekt werden.
Was bedeutet "Entindividualisierung" in diesem Kontext?
Es beschreibt den Prozess, in dem der Mensch in kommerzialisierten Systemen (wie dem Gesundheitswesen) zunehmend als bloßer Kostenfaktor oder Fallnummer wahrgenommen wird.
- Citation du texte
- Mirko Kruse (Auteur), 2017, Ursachen und mögliche Grenzen gesellschaftlicher Kommerzialisierungsprozesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413007