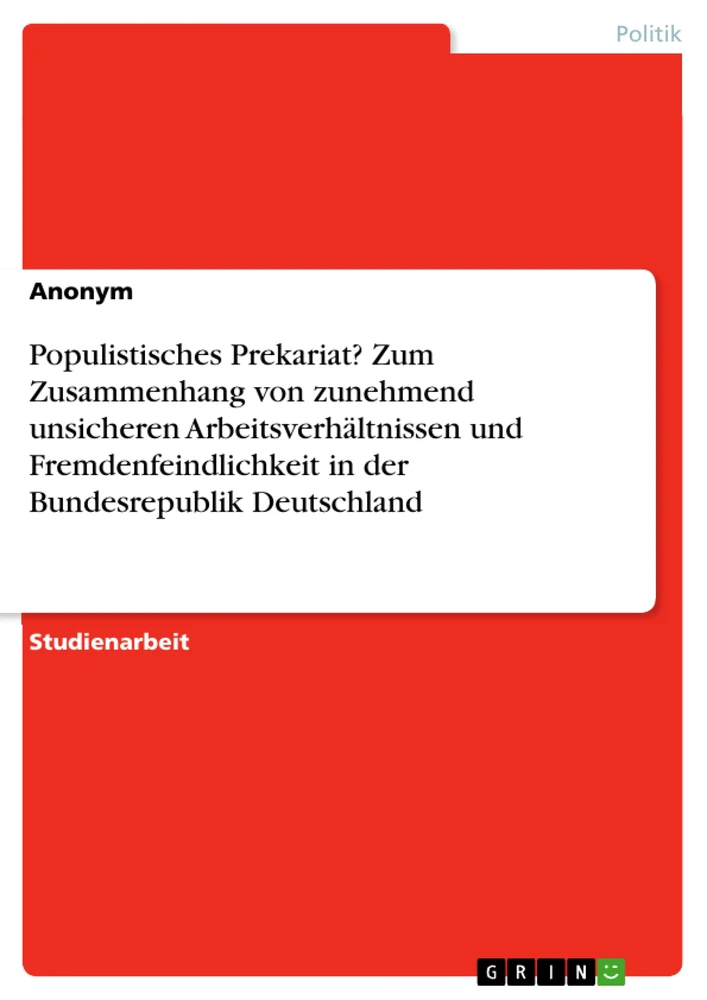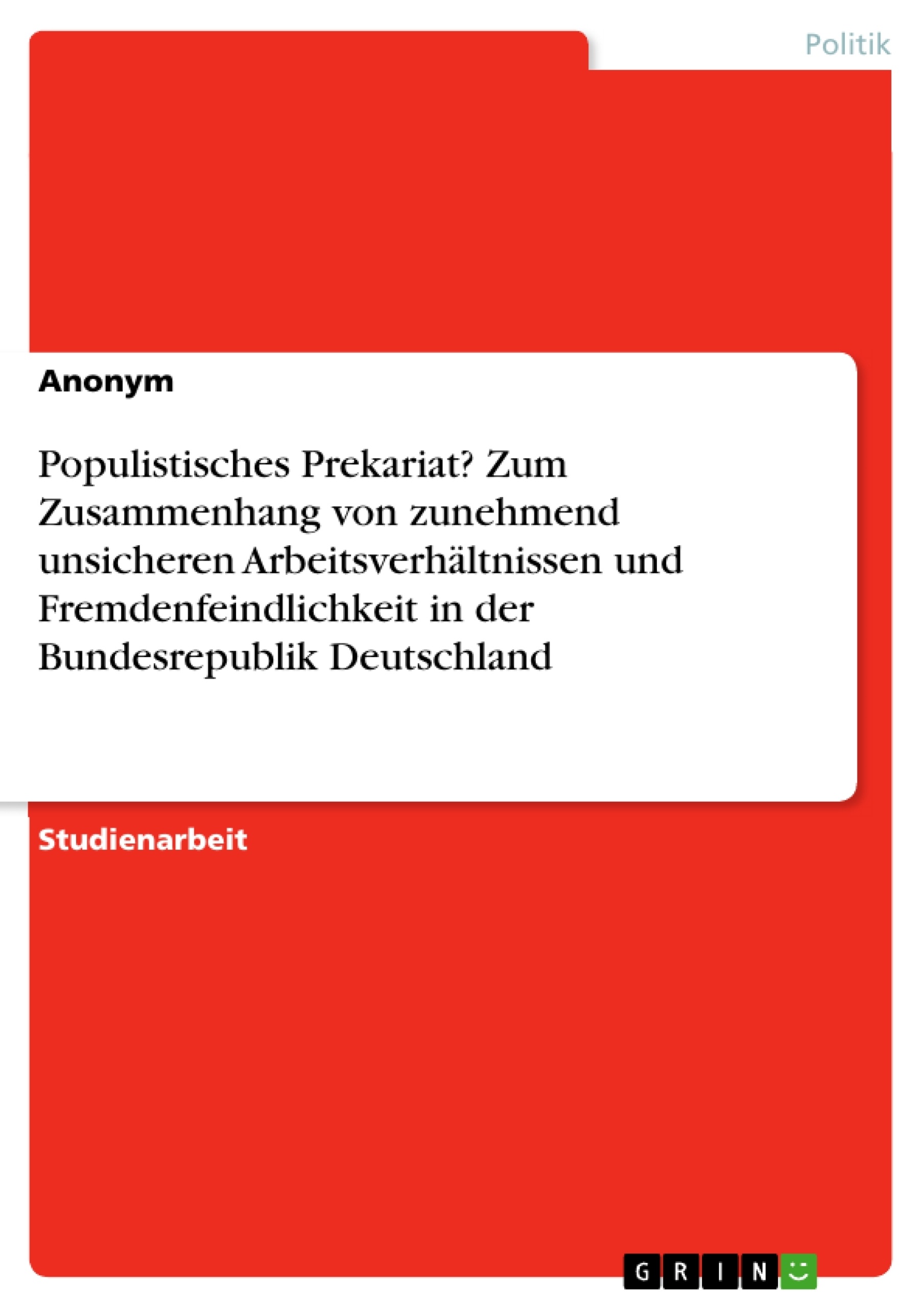Diese Arbeit untersucht, vor dem Hintergrund zunehmender Fremdenfeindlichkeit im öffentlichen Raum während der sogenannten ,,Flüchtlingskrise’’, die These, dass besonders ökonomisch abgehängte Schichten anfällig für rechtsextreme Ansichten seien.
So zählt die Polizei seit Beginn des Jahres bis Mitte September 2016 507 Vorfälle fremdenfeindlicher Gewalt (was beinahe dem doppelten Wert des Vorjahres entspricht); über 1800 politisch motivierte Straftaten gegenüber Geflüchteten und Asylbewerbern sowie 78 Fälle von Brandstiftung und sieben Tötungsdelikte. Weiterhin war die sich selbst als ,,asylkritisch’’ bezeichnende Gruppierung Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA) unmittelbar nach ihrer Gründung Ende 2014 bereits am 12.01.2015 in der Lage, auf einer Dresdner Demonstration ca. 25.000 Teilnehmer zu mobilisieren. Auf selbiger Demonstration kam es unter anderem zu polizeilichen Ermittlungen auf Grund der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass die ,,europaskeptische’’ und nach Eigenaussage ,,asylkritische’’ Partei Alternative für Deutschland (AfD) während der Landtagswahlen 2016 15,1 Prozent der Stimmen in Baden-Württemberg; 12,6 Prozent der Stimmen in Rheinland-Pfalz; 24,3 der Stimmen in Sachsen-Anhalt sowie 20,8 Prozent der Stimmen in Mecklenburg-Vorpommern für sich beanspruchen konnte. Außerdem erhielt diese 14,2 Prozent der Stimmen bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl 2016.
Im Kontext dieser Arbeit wird untersucht, ob eine generelle Korrelation zwischen zunehmend prekären Arbeitsverhältnissen und einer steigenden Tendenz fremdenfeindlicher Ansichten besteht. Die Arbeitshypothese lautet, dass durch die Entsicherung des Arbeitsmarktes ein Prozess der Prekarisierung losgetreten worden ist, der ein Unsicherheitsvakuum bis in die Mitte der Gesellschaft hinein erzeugt hat. Dieses Vakuum wiederum eröffnet rechtspopulistisch ausgerichteten Strömungen einen weiten Handlungsspielraum. Außerdem wird angenommen, dass nicht nur die objektiv benachteiligten Gesellschaftsschichten von einer zunehmend affirmativen Haltung gegenüber Rechtspopulismus betroffen sind, sondern sich auf Grund des Phänomens der relativen Deprivation auch weite Teile der objektiv besser situierten Bevölkerungsschichten zum subjektiven Prekariat hinzuzählen – und so, aufgrund einer empfundenen Ungerechtigkeit, das rechtspopulistische Wählerpotential vergrößern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Von der Prekarisierung zum Populismus
- 2. Die Genese des modernen Prekariats
- 3. Prekarität und Fremdenfeindlichkeit
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der These, dass ökonomisch abgehängte Schichten anfällig für rechtsextreme Ansichten sind, und untersucht den Zusammenhang zwischen zunehmend unsicheren Arbeitsverhältnissen und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Sie analysiert die Korrelation zwischen dem Phänomen der Prekarisierung und der Verbreitung fremdenfeindlicher Einstellungen in der Bundesrepublik.
- Prekarisierung des Arbeitsmarktes und die Entstehung eines Unsicherheitsvakuums in der Gesellschaft
- Rechtspopulistische Strömungen und die Nutzung des Unsicherheitsvakuums zur Mobilisierung von Wählern
- Der Einfluss der relativen Deprivation auf die Verbreitung fremdenfeindlicher Ansichten
- Die Rolle des Rechtspopulismus im Kontext der "Flüchtlingskrise"
- Die Verbindung zwischen Prekarisierung und Fremdenfeindlichkeit im Hinblick auf die Zunahme von rechtsextremen Einstellungen und Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Von der Prekarisierung zum Populismus
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Spielarten des Rechtspopulismus, insbesondere den Nationalpopulismus, und erklärt dessen Mechanismen zur Mobilisierung von Ressentiments gegen Asylsuchende. Die Arbeit argumentiert, dass die zunehmende Erosion ökonomischer Sicherheiten die Verbreitung von "Wir-Gefühl"-stiftenden Ressentiments im Kontext des Nationalpopulismus verstärkt.
- Kapitel 2: Die Genese des modernen Prekariats
Kapitel 2 zeichnet einen Überblick über die Marktliberalisierung in Deutschland und die daraus resultierende Prekarisierung des Arbeitsmarktes. Es erläutert die Entstehung des "Prekariats" und die Folgen der wachsenden Unsicherheit für die Gesellschaft.
- Kapitel 3: Prekarität und Fremdenfeindlichkeit
Im dritten Kapitel wird die mögliche Korrelation zwischen der (empfundenen) Zugehörigkeit zum Prekariat und Fremdenfeindlichkeit untersucht. Die Arbeit analysiert den Einfluss der relativen Deprivation und die Entwicklung einer abwertenden und ausgrenzenden Haltung gegenüber Migranten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind Prekarisierung, Rechtspopulismus, Fremdenfeindlichkeit, relative Deprivation, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF), Arbeitsmarkt, "Flüchtlingskrise", "Wir-Gefühl", Nationalpopulismus, und die AfD.
Häufig gestellte Fragen
Hängt Fremdenfeindlichkeit mit unsicheren Arbeitsplätzen zusammen?
Die Arbeit untersucht die These, dass ökonomische Prekarisierung ein Unsicherheitsvakuum schafft, das Menschen anfälliger für rechtspopulistische und fremdenfeindliche Ansichten macht.
Was ist das "Prekariat"?
Als Prekariat bezeichnet man Bevölkerungsschichten, die aufgrund unsicherer Arbeitsverhältnisse (Leiharbeit, Befristung) und geringen Einkommens sozial abgehängt sind.
Was bedeutet "relative Deprivation"?
Dies ist das Gefühl, im Vergleich zu anderen Gruppen (oder Geflüchteten) benachteiligt zu sein, auch wenn man objektiv nicht in Armut lebt.
Warum profitiert der Rechtspopulismus von der Prekarisierung?
Rechtspopulistische Strömungen bieten einfache Sündenböcke und ein "Wir-Gefühl", das die durch den Arbeitsmarkt verloren gegangene Sicherheit scheinbar ersetzt.
Was versteht man unter Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF)?
Es ist ein Konzept, das verschiedene Formen der Abwertung von Gruppen (Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie) als zusammenhängendes Phänomen betrachtet.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Populistisches Prekariat? Zum Zusammenhang von zunehmend unsicheren Arbeitsverhältnissen und Fremdenfeindlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413365