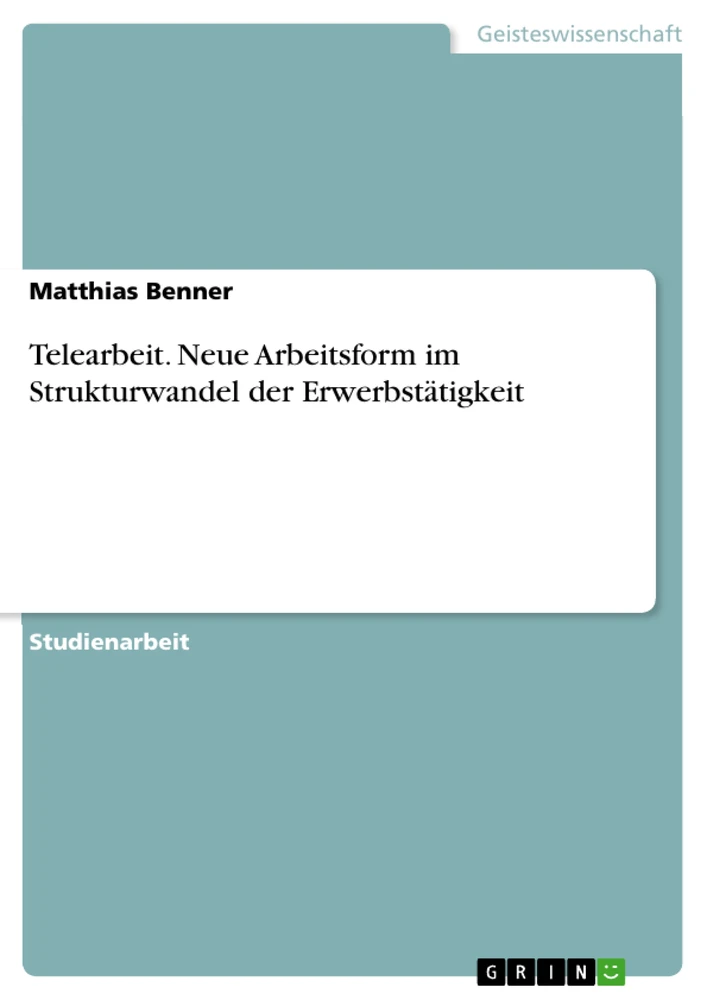Seit den fünfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts haben Informations- und Telekommunikationstechnologien – insbesondere damit verbunden der Computer – die Arbeitswelt zunächst langsam, dann aber immer schneller, revolutioniert. So nutzten 1979 erst 14% der in Deutschland beschäftigten Arbeitskräfte einen Computer, während es 1999 bereits 63% waren.
Parallel zu dieser Entwicklung ist auch ein Wandel von der traditionellen Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft beobachtbar. Gingen im Bereich des sekundären Sektors, also dem industriellen Sektor, seit den sechziger Jahren massiv Arbeitsplätze verloren, wuchs die Beschäftigtenzahl im tertiären Sektor, dem Dienstleistungssektor, seit dieser Zeit um 7,7 Millionen. Einen Großteil der Arbeitsplatzverluste im industriellen Sektor wurde somit vom Dienstleistungssektor kompensiert.
Inhaltsverzeichnis
- Wandel der Erwerbsstrukturen
- Definition von Telearbeit
- Heimbasierte Telearbeit
- Centerbasierte Telearbeit
- Mobile Telearbeit
- Entwicklung und Verbreitung von Telearbeit
- Entwicklung und Verbreitung der Telearbeit in Deutschland
- Verbreitung der Telearbeit in Europa
- Verbreitung der Telearbeit in den USA
- Vor- und Nachteile von Telearbeit
- Vor- und Nachteile aus Arbeitgebersicht
- Vor- und Nachteile aus Arbeitnehmerperspektive
- Diffusionsprobleme der Telearbeit
- Exkurs: Grundlagen des Neuen Soziologischen Institutionalismus
- Institutionen
- Legitimation
- Telearbeit - Legitimation und Adaption
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Telearbeit als neue Arbeitsform im Kontext des Strukturwandels der Erwerbstätigkeit. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Warum ist Telearbeit in Deutschland trotz des technologischen Fortschritts immer noch vergleichsweise selten?
- Wandel der Erwerbsstrukturen und der Übergang zu einer Wissensgesellschaft
- Definition und verschiedene Formen der Telearbeit
- Entwicklung und Verbreitung von Telearbeit in verschiedenen Ländern (Deutschland, Europa, USA)
- Vor- und Nachteile der Telearbeit aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerperspektive
- Institutionelle und soziologische Faktoren, die die Diffusion von Telearbeit beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
Wandel der Erwerbsstrukturen: Dieses Kapitel beschreibt den tiefgreifenden Wandel der Erwerbsstrukturen seit den 1950er Jahren, geprägt durch den technologischen Fortschritt (insbesondere die zunehmende Verbreitung von Computern) und den Übergang von einer Industrie- zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Der Verlust von Arbeitsplätzen im sekundären Sektor wurde zum Teil durch den Wachstum im tertiären Sektor kompensiert. Die Entwicklung eines quartären Sektors, des Wissenssektors, wird hervorgehoben, der durch neue Technologien und Wissensarbeit gekennzeichnet ist und potenziell eine Wissensgesellschaft hervorbringen könnte. Das Kapitel analysiert kritisch den Taylorismus und Fordismus mit ihren Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit und Produktivität und zeigt einen Paradigmenwechsel hin zu flexibleren Produktionssystemen auf.
Definition von Telearbeit: Dieses Kapitel definiert Telearbeit als eine räumlich flexible Arbeitsform und unterscheidet zwischen heimbasierter, centerbasierter und mobiler Telearbeit. Es legt die Grundlage für das Verständnis der verschiedenen Ausprägungen dieser neuen Arbeitsweise und ihrer spezifischen Herausforderungen und Chancen. Die verschiedenen Ausführungen dieser Arbeitsform werden detailliert beschrieben und voneinander abgegrenzt, um ein umfassendes Bild der Thematik zu schaffen.
Entwicklung und Verbreitung von Telearbeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung und Verbreitung von Telearbeit in Deutschland, Europa und den USA. Es untersucht die unterschiedlichen Entwicklungsverläufe und versucht, die Gründe für die stärkere Verbreitung in Ländern wie den USA im Vergleich zu Deutschland zu erklären. Der Fokus liegt auf den historischen und sozioökonomischen Faktoren, die die Adaption dieser Arbeitsform beeinflussen. Der Vergleich ermöglicht die Identifizierung von Erfolgsfaktoren und Hemmnissen für die Verbreitung von Telearbeit in unterschiedlichen Kontexten.
Vor- und Nachteile von Telearbeit: Dieses Kapitel analysiert die Vor- und Nachteile der Telearbeit aus der Perspektive von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Es beleuchtet die potenziellen Vorteile wie erhöhte Produktivität, Flexibilität und Kostenersparnisse für Arbeitgeber sowie verbesserte Work-Life-Balance und mehr Autonomie für Arbeitnehmer. Gleichzeitig werden die Herausforderungen wie Kommunikationsprobleme, soziale Isolation und Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen Arbeits- und Privatleben adressiert. Die differenzierte Betrachtung beider Perspektiven liefert ein ausgewogenes Bild der Chancen und Risiken dieser Arbeitsform.
Diffusionsprobleme der Telearbeit: Dieses Kapitel untersucht die Gründe für die vergleichsweise geringe Verbreitung von Telearbeit in Deutschland. Es nutzt den Neuen Soziologischen Institutionalismus als theoretisches Rahmenwerk, um die institutionellen und legitimatorischen Aspekte zu analysieren, die die Akzeptanz und Implementierung von Telearbeit behindern. Der Exkurs zum Neuen Soziologischen Institutionalismus liefert dabei die notwendigen theoretischen Grundlagen zum Verständnis institutioneller Dynamiken.
Schlüsselwörter
Telearbeit, Flexibilisierung der Arbeit, Strukturwandel, Wissensgesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, Neuer Soziologischer Institutionalismus, Arbeitgeberperspektive, Arbeitnehmerperspektive, Deutschland, Europa, USA, Produktivität, Work-Life-Balance, Institutionen, Legitimation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Telearbeit in Deutschland
Was ist der zentrale Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Telearbeit als neue Arbeitsform im Kontext des Strukturwandels der Erwerbstätigkeit in Deutschland und fragt nach den Gründen für deren vergleichsweise geringe Verbreitung trotz technologischen Fortschritts.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel der Erwerbsstrukturen, die Definition und verschiedene Formen der Telearbeit (heimbasiert, centerbasiert, mobil), die Entwicklung und Verbreitung von Telearbeit in Deutschland, Europa und den USA, die Vor- und Nachteile aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerperspektive sowie institutionelle und soziologische Faktoren, die die Diffusion von Telearbeit beeinflussen. Ein Exkurs zum Neuen Soziologischen Institutionalismus liefert dazu theoretische Grundlagen.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu den folgenden Themen: Wandel der Erwerbsstrukturen, Definition von Telearbeit, Entwicklung und Verbreitung von Telearbeit, Vor- und Nachteile von Telearbeit, Diffusionsprobleme der Telearbeit (inkl. Exkurs zum Neuen Soziologischen Institutionalismus) und ein Fazit. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Welche Definition von Telearbeit wird verwendet?
Telearbeit wird als räumlich flexible Arbeitsform definiert, wobei zwischen heimbasierter, centerbasierter und mobiler Telearbeit unterschieden wird.
Wie wird die Verbreitung von Telearbeit in verschiedenen Ländern verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Entwicklung und Verbreitung von Telearbeit in Deutschland, Europa und den USA, um Unterschiede und deren Ursachen zu analysieren. Der Fokus liegt auf historischen und sozioökonomischen Faktoren.
Welche Vor- und Nachteile von Telearbeit werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Vor- und Nachteile aus der Perspektive von Arbeitgebern (z.B. erhöhte Produktivität, Kostenersparnisse) und Arbeitnehmern (z.B. verbesserte Work-Life-Balance, mehr Autonomie), aber auch Herausforderungen wie Kommunikationsprobleme und soziale Isolation.
Welche Rolle spielt der Neue Soziologische Institutionalismus?
Der Neue Soziologische Institutionalismus dient als theoretisches Rahmenwerk, um die institutionellen und legitimatorischen Aspekte zu analysieren, die die Akzeptanz und Implementierung von Telearbeit in Deutschland beeinflussen. Der Exkurs erklärt die Konzepte von Institutionen und Legitimation in diesem Kontext.
Welche Schlussfolgerung zieht die Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Gründe für die geringe Verbreitung von Telearbeit in Deutschland, insbesondere im Lichte der institutionellen und soziologischen Faktoren, die im Rahmen des Neuen Soziologischen Institutionalismus analysiert werden. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Telearbeit, Flexibilisierung der Arbeit, Strukturwandel, Wissensgesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, Neuer Soziologischer Institutionalismus, Arbeitgeberperspektive, Arbeitnehmerperspektive, Deutschland, Europa, USA, Produktivität, Work-Life-Balance, Institutionen, Legitimation.
- Citar trabajo
- Matthias Benner (Autor), 2005, Telearbeit. Neue Arbeitsform im Strukturwandel der Erwerbstätigkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413385