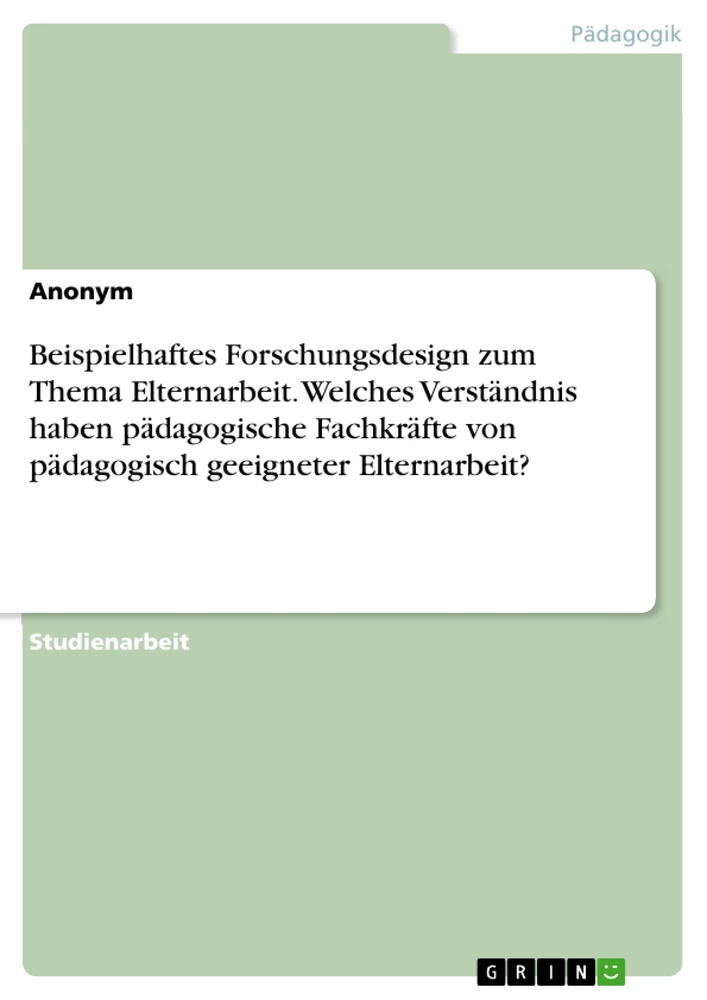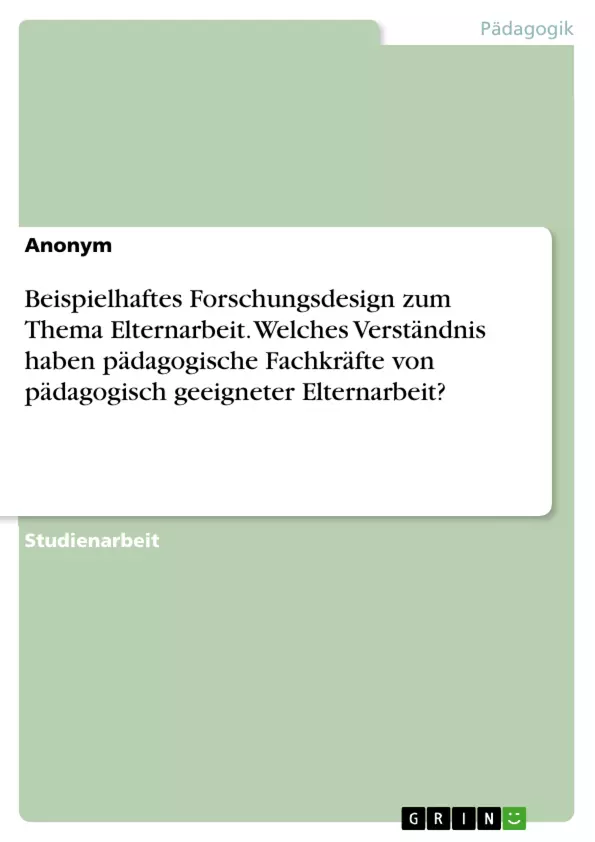Diese Forschungsarbeit befasst sich mit dem Thema Elternarbeit. Basierend auf den Daten, die im Rahmen der wissenschaftlichen Erhebung generiert werden sollen, wird sich mit folgender Forschungsfrage zum Thema Elternarbeit beschäftigt: Welches Verständnis haben pädagogische Fachkräfte von pädagogisch geeigneter Elternarbeit?
Um diese Frage tatsächlich beantworten zu können, sollen Fachkräfte aus der Kita einer Befragung unterzogen. Dies erfolgt in Form einer qualitativen Erhebung. Dadurch können sich Fachkräfte zu dem Thema äußern. Die vorliegende Arbeit versucht, die verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses zu beschreiben. Zunächst wird die Forschungsmethode dargestellt und begründet, anschließend die Datenerhebung bzw. deren Umfang beschrieben und begründet. Auch die geplante Auswertung der Daten sowie die Ergebnisse der Untersuchung Darstellung bestimmen das Forschungsdesign. Schließlich wird ein Zeitplan für das Forschungsvorhaben erstellt und das Forschungsvorhaben reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Forschungsstand
- Beschreibung der verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses
- Erhebungsmethode
- Datenerhebung
- Auswertung der Ergebnisse
- Zeitplan
- Vorläufiges Inhaltsverzeichnis
- Ethische Reflextion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Elternarbeit in der frühkindlichen Bildung, insbesondere in der Kita. Das Forschungsvorhaben zielt darauf ab, das Verständnis von pädagogisch geeigneter Elternarbeit aus Sicht pädagogischer Fachkräfte zu erforschen. Hierzu wird eine qualitative Befragung von Fachkräften aus einer Kita durchgeführt, um die verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen zu erfassen. Die gewonnenen Daten sollen anschließend zur Entwicklung eines Konzeptes für pädagogisch gute Elternarbeit in der Kita dienen.
- Das Verständnis von pädagogisch geeigneter Elternarbeit
- Die Bedeutung der Elternarbeit in der Kita
- Die Erwartungen und Bedürfnisse von Eltern und Fachkräften
- Die Gestaltung einer effektiven Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften
- Die Entwicklung eines Konzepts für pädagogisch gute Elternarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Elternarbeit ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der frühkindlichen Bildung. Es wird die Frage gestellt, was pädagogisch gute Elternarbeit ausmacht und welche Herausforderungen sich für Fachkräfte im Umgang mit Eltern ergeben. Die Fragestellung der Arbeit wird vorgestellt, die sich auf das Verständnis von pädagogisch geeigneter Elternarbeit von Fachkräften fokussiert.
Im Kapitel „Forschungsstand“ wird ein Überblick über die vorhandene Literatur zum Thema Elternarbeit gegeben. Es werden verschiedene Forschungsarbeiten und Publikationen vorgestellt, die sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten der Elternarbeit, den Erwartungen von Eltern und Fachkräften sowie der Entwicklung von Konzepten für eine gelungene Zusammenarbeit befassen.
Das Kapitel „Beschreibung der verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses“ beschreibt die Methodik der Forschungsarbeit. Es werden die Erhebungsmethode, die Datenerhebung, die Auswertung der Ergebnisse und der Zeitplan des Forschungsprojekts dargestellt. Die ethischen Aspekte des Forschungsprozesses werden im Kapitel „Ethische Reflextion“ beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind Elternarbeit, frühkindliche Bildung, Kita, pädagogische Fachkräfte, Erwartungen, Bedürfnisse, Zusammenarbeit, Konzeptentwicklung, qualitative Befragung, Forschungsdesign, Forschungsstand.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit zur Elternarbeit?
Die Arbeit untersucht: Welches Verständnis haben pädagogische Fachkräfte in Kitas von pädagogisch geeigneter Elternarbeit?
Welche Forschungsmethode wird verwendet?
Es wird eine qualitative Erhebung in Form von Befragungen durchgeführt, um detaillierte Perspektiven und Erfahrungen der Fachkräfte zu erfassen.
Warum ist Elternarbeit in der Kita so wichtig?
Eine effektive Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften ist entscheidend für die bestmögliche Förderung des Kindes und die Abstimmung von Erziehungszielen.
Welche Phasen des Forschungsprozesses werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Erhebungsmethode, die Datenerhebung, die Auswertung der Ergebnisse, die ethische Reflexion sowie den Zeitplan des Projekts.
Was soll das Ergebnis der Untersuchung sein?
Die gewonnenen Daten sollen als Grundlage für die Entwicklung eines praxisnahen Konzepts für gelungene Elternarbeit in Kindertagesstätten dienen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Beispielhaftes Forschungsdesign zum Thema Elternarbeit. Welches Verständnis haben pädagogische Fachkräfte von pädagogisch geeigneter Elternarbeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413404