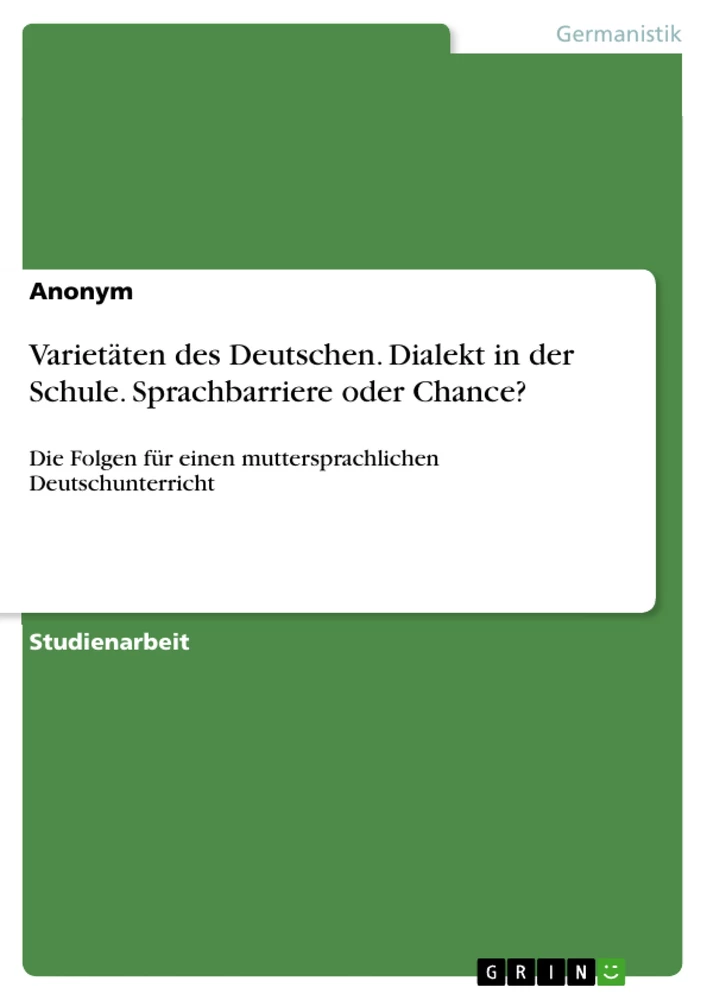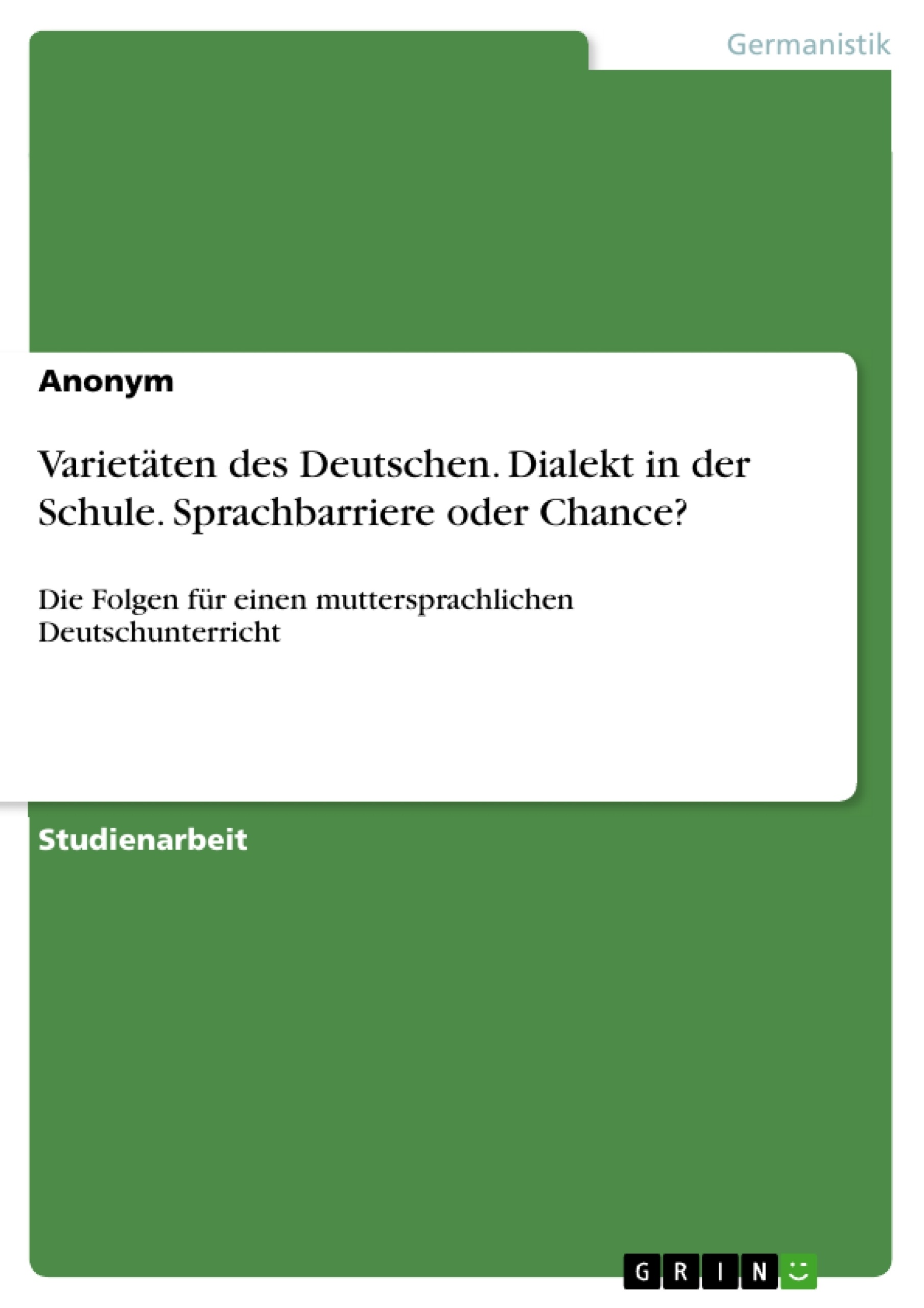Obwohl die Zahlen der „reinen“ Dialektsprecher rückläufig sind und überregionale Sprachformen kleinräumige Varietäten ersetzen, ist der Deutschunterricht nach wie vor mit regionalsprachlichen Varietäten konfrontiert. Dabei ist die Sprache eines jedem dialektal geprägt, ob nun bewusst oder unbewusst, bei dem einem stärker ausgeprägt als bei dem anderen. Daher ist der Dialekt ein wichtiger Bestandteil der deutschen Sprache, die sich durch ihre Vielfalt und Varietät auszeichnet. Im muttersprachlichen Deutschunterricht sollen die Schülerinnen und Schüler, nach den Bildungsstandards des Faches Deutsch, im Laufe ihres Schriftspracherwerbs allerdings zu einem überregionalen Standard hingeführt werden. Gerade bei Kindern, deren Sprache stark dialektbedingt ist, kann es in Folge des standarisierten Schriftspracherwerbs zu dialektalen Folgefehlern kommen.
Welche Fehler dies sind und wie die Sprachdidaktik damit umgeht soll Gegenstand dieser Arbeit werden. Hierzu erfolgt eine Analyse der Bildungsstandards und des Lehrplans, ebenso soll die Aufbereitung im Schulbuch untersucht werden, bevor abschließend Unterrichtsvorschläge erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Varietät - Dialekt und Standardsprache
- Begriffsbestimmung: Dialekt
- Abgrenzung von Dialekt und Hoch- bzw. Standardsprache
- Dialekt und Schule
- Dialekt und Standardsprache in der Geschichte des Deutschunterrichts
- Dialekt als Sprachbarriere – eine Fehleranalyse
- Dialekt in der Sprachdidaktik
- Dialekt in Lehrplan und Bildungsstandards
- Lehrwerksanalyse
- Ein Unterrichtsvorschlag zum Thema Dialekt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Problematik des Dialekts im muttersprachlichen Deutschunterricht. Sie analysiert, ob Dialekt als Sprachbarriere oder als Chance für den Spracherwerb betrachtet werden kann. Die Arbeit untersucht dabei die historische Entwicklung des Deutschunterrichts im Hinblick auf die Rolle des Dialekts, analysiert dialektale Folgefehler und beleuchtet den Umgang der Sprachdidaktik mit der inneren Mehrsprachigkeit des Deutschen.
- Historische Entwicklung des Deutschunterrichts im Hinblick auf den Dialekt
- Analyse dialektaler Folgefehler
- Umgang der Sprachdidaktik mit der inneren Mehrsprachigkeit des Deutschen
- Bedeutung des Dialekts als Sprachbarriere oder als Chance für den Spracherwerb
- Lehrplananalyse und Schulbuchuntersuchung im Kontext des Dialekts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Dialekts im muttersprachlichen Deutschunterricht dar und definiert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Begriffen Dialekt und Standardsprache, ihrer Abgrenzung und ihrer Bedeutung für den Spracherwerb. Kapitel 3 beleuchtet die Rolle des Dialekts in der Geschichte des Deutschunterrichts und analysiert die Folgen des Dialekts für den Schriftspracherwerb. Kapitel 4 betrachtet die aktuelle Rolle des Dialekts in der Sprachdidaktik, insbesondere die Bedeutung von Lehrplänen, Bildungsstandards und Lehrwerken. Der Fokus liegt auf der Frage, wie der Deutschunterricht mit der inneren Mehrsprachigkeit des Deutschen umgehen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Dialekt, Standardsprache, innere Mehrsprachigkeit, Sprachbarriere, Sprachdidaktik, Deutschunterricht, Lehrplan, Bildungsstandards, Lehrwerke, Fehleranalyse, regionale Sprachvarietäten, Schriftspracherwerb.
Häufig gestellte Fragen
Ist Dialekt in der Schule eine Sprachbarriere?
Starker Dialektgebrauch kann beim Schriftspracherwerb zu spezifischen Fehlern führen, wird aber in der modernen Didaktik auch als Form der inneren Mehrsprachigkeit und Chance begriffen.
Was sind dialektale Folgefehler?
Dies sind Rechtschreib- oder Grammatikfehler, die entstehen, weil Schüler Wörter so schreiben, wie sie diese in ihrem regionalen Dialekt aussprechen.
Wie gehen Bildungsstandards mit Dialekten um?
Bildungsstandards fordern die Hinführung zur überregionalen Standardsprache, betonen aber zunehmend auch die Kompetenz, zwischen verschiedenen Sprachvarietäten (Code-Switching) wechseln zu können.
Was bedeutet „innere Mehrsprachigkeit“?
Es beschreibt die Fähigkeit eines Sprechers, innerhalb einer Sprache verschiedene Varietäten wie Dialekt, Umgangssprache und Standardsprache situativ angemessen zu nutzen.
Sollte Dialekt im Deutschunterricht verboten werden?
Nein, die moderne Sprachdidaktik empfiehlt einen bewussten Umgang mit Dialekten, um das Sprachbewusstsein zu fördern und den Kontrast zur Standardsprache als Lernhilfe zu nutzen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2017, Varietäten des Deutschen. Dialekt in der Schule. Sprachbarriere oder Chance?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413460