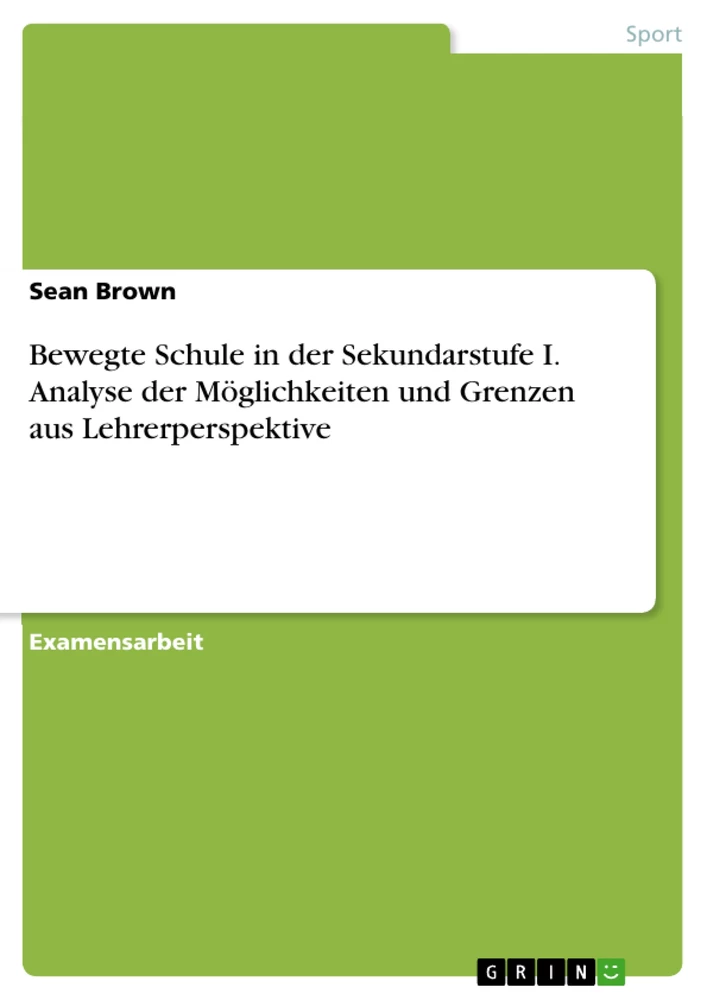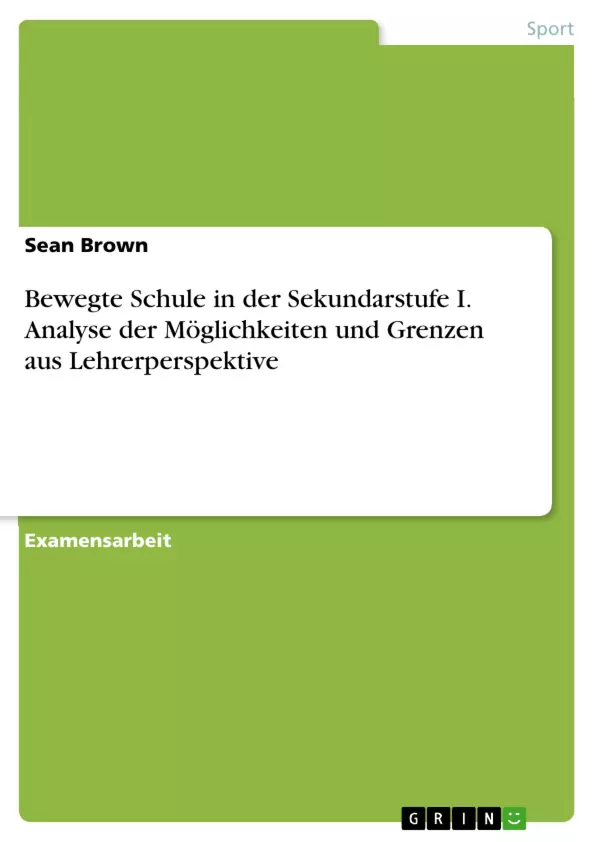Das Ziel dieser Arbeit ist es die Frage zu klären, ob und inwiefern, das Konzept der „Bewegten Schule“ auch in der Sekundarstufe I durchführbar ist.
In erster Linie sollen Möglichkeiten und Grenzen, die eine Umsetzung mit sich bringen würde, herausgearbeitet werden.
Auf die subjektiven Einschätzungen von Lehrern wird dabei ein besonderes Augenmerk gelegt.
Im folgenden 2. Kapitel, dem theoretischen Teil, wird zuerst der geschichtliche Hintergrund der „Bewegten Schule“ betrachtet. Im Anschluss daran folgen die Begründungsmuster. Hier werden die Argumente für mehr Bewegung im Schulalltag erläutert. Daran anschließend werden die Merkmale der „Bewegten Schule“ skizziert sowie mögliche Unterrichtsbeispiele zum „Bewegten Lernen“ aufgezeigt. Den Abschnitt abschließen werden kritische Thesen, die die Konzeption betreffen.
Das 3. Kapitel beinhaltet den methodischen Teil dieser Arbeit. Die durchgeführte Forschungsarbeit wird ausführlich beschrieben. Dazu gehört das Design plus der Ablauf der Studie, der erstellte Leitfaden des Interviews sowie das Auswertungsverfahren.
Wie das Konzept in der Sekundarstufe I Anwendung finden kann, soll ein Porträt einer „Bewegten Schule“, an der die Untersuchung zum Teil stattfand, zeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung.
- 2 Theoretischer Teil........
- 2.1 Historie
- 2.2 Begründungsmuster einer „Bewegten Schule“..
- 2.2.1 Entwicklungs- und Lerntheoretische Gründe..
- 2.2.2 Medizinisch-Gesundheitliche Gründe.......
- 2.2.3 Schulprogrammatische Gründe.............
- 2.3 Merkmale der „Bewegten Schule“..
- 2.3.1 Rahmenmerkmale der „Bewegten Schule“..
- 2.3.1.1 der pädagogisch-personalstrukturelle Rahmen......
- 2.3.1.2 infrastruktureller Rahmen..........\n
- 2.3.2 Inhaltliche Merkmale der „Bewegten Schule“..
- 2.3.2.1 Unterrichtsinterne Merkmale........
- 2.3.2.2 Unterrichtsexterne Merkmale..........\n
- 2.3.1 Rahmenmerkmale der „Bewegten Schule“..
- 2.4 „Bewegter Unterricht“ - Mögliche Unterrichtsinhalte…...\n
- 2.5 Kritik am Konzept „,Bewegte Schule\".
- 3 Methodischer Teil...........
- 3.1 Qualitative Sozialforschung....
- 3.1.1 Design und Ablauf der Studie......
- 3.1.2 Leitfaden der Interviewfragen...........
- 3.1.3 Auswertungsverfahren\n
- 3.2 Porträt einer „Bewegten Schule“..\n
- 3.3 Auswertung der Interview
- 3.3.1 Einstiegsphase.…………………………..\n
- 3.3.2 Erfahrungen aus dem Schulalltag......
- 3.3.3 Einschätzungen der Befragten zum Konzept....\n
- 3.3.4 Möglichkeiten und Grenzen......\n
- 3.4 Müller – Petzold Studie\n
- 3.1 Qualitative Sozialforschung....
- 4 Konklusion und Ausblick.....
- 5 Literaturverzeichnis..........\n
- 6 Anhang..........\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern das Konzept der „Bewegten Schule“ in der Sekundarstufe I umgesetzt werden kann. Im Fokus stehen die Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung aus Lehrerperspektive. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen des Konzepts, untersucht empirisch die Erfahrungen von Lehrkräften an einer „Bewegten Schule“ und diskutiert die Relevanz des Konzepts im Kontext der heutigen Bildungsphilosophie.- Analyse der Historie und Begründungsmuster der „Bewegten Schule“
- Identifizierung der Merkmale und Rahmenbedingungen einer „Bewegten Schule“
- Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung in der Sekundarstufe I
- Empirische Untersuchung der Perspektiven und Erfahrungen von Lehrkräften
- Diskussion der Relevanz des Konzepts im Hinblick auf aktuelle Bildungsdebatten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der „Bewegten Schule“ ein und stellt die Problematik der zunehmenden Bewegungsarmut von Kindern und Jugendlichen im Kontext des Schulalltags dar. Die Bedeutung von Bewegung für die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung der Schüler wird betont, und das Ziel der Arbeit, die Umsetzbarkeit des Konzepts in der Sekundarstufe I zu analysieren, wird klar formuliert.
- Kapitel 2: Theoretischer Teil: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der „Bewegten Schule“. Zunächst wird ein historischer Überblick über die Entwicklung des Konzepts gegeben, gefolgt von einer detaillierten Darstellung der Begründungsmuster, die die Notwendigkeit von mehr Bewegung im Schulalltag unterstreichen. Anschließend werden die Merkmale einer „Bewegten Schule“ definiert, sowohl im Hinblick auf strukturelle Aspekte (wie den pädagogisch-personalstrukturellen Rahmen und die infrastrukturellen Voraussetzungen) als auch im Hinblick auf inhaltliche Aspekte (wie die Integration von Bewegung in den Unterricht). Schließlich werden mögliche Unterrichtsformen und -inhalte für ein „Bewegtes Lernen“ vorgestellt, und kritische Punkte hinsichtlich der Umsetzung des Konzepts werden diskutiert.
- Kapitel 3: Methodischer Teil: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Vorgehensweise der Arbeit. Es wird die qualitative Sozialforschung als Forschungsmethode erläutert, die das Design und den Ablauf der Studie, den Leitfaden der Interviewfragen und das Auswertungsverfahren umfasst. Ein Porträt einer „Bewegten Schule“ an der die Untersuchung stattfand, verdeutlicht die praktische Anwendung des Konzepts. Die Auswertung der Interviews mit Lehrkräften beleuchtet die Erfahrungen und Einschätzungen der Befragten hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen des Konzepts. Die Ergebnisse der Müller-Petzold-Studie, die die Bedeutung von Bewegung im Schulalltag untersucht, werden ebenfalls herangezogen.
Schlüsselwörter
Bewegte Schule, Sekundarstufe I, Bewegungsarmut, körperliche Aktivität, kognitive Entwicklung, Lehrerperspektive, Möglichkeiten, Grenzen, Qualitative Sozialforschung, Interviewstudie.- Quote paper
- Sean Brown (Author), 2017, Bewegte Schule in der Sekundarstufe I. Analyse der Möglichkeiten und Grenzen aus Lehrerperspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413471