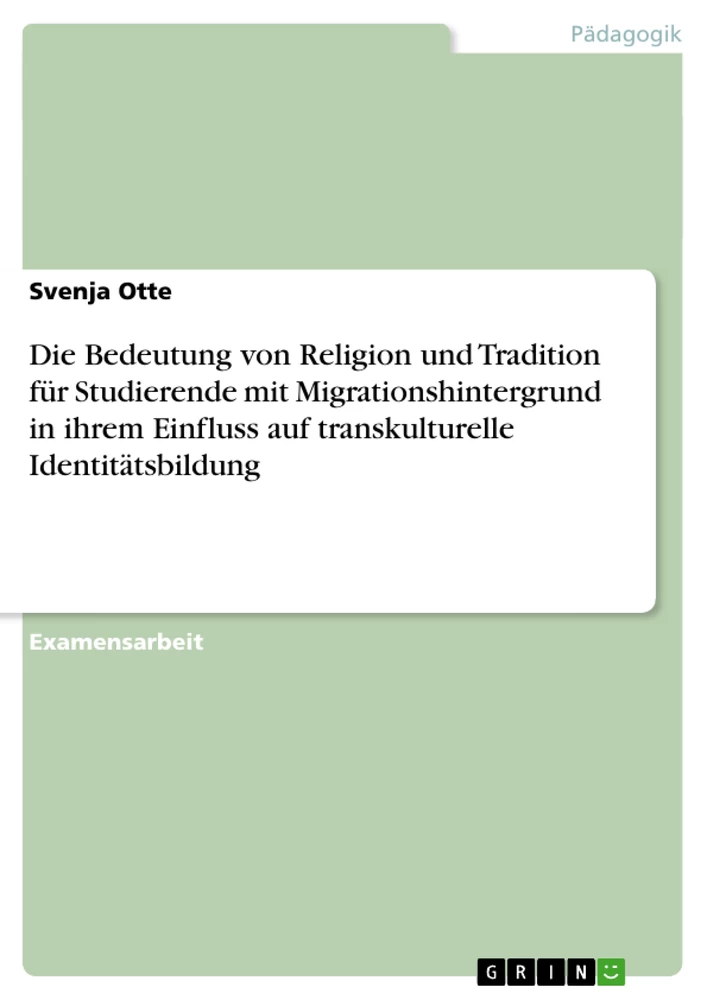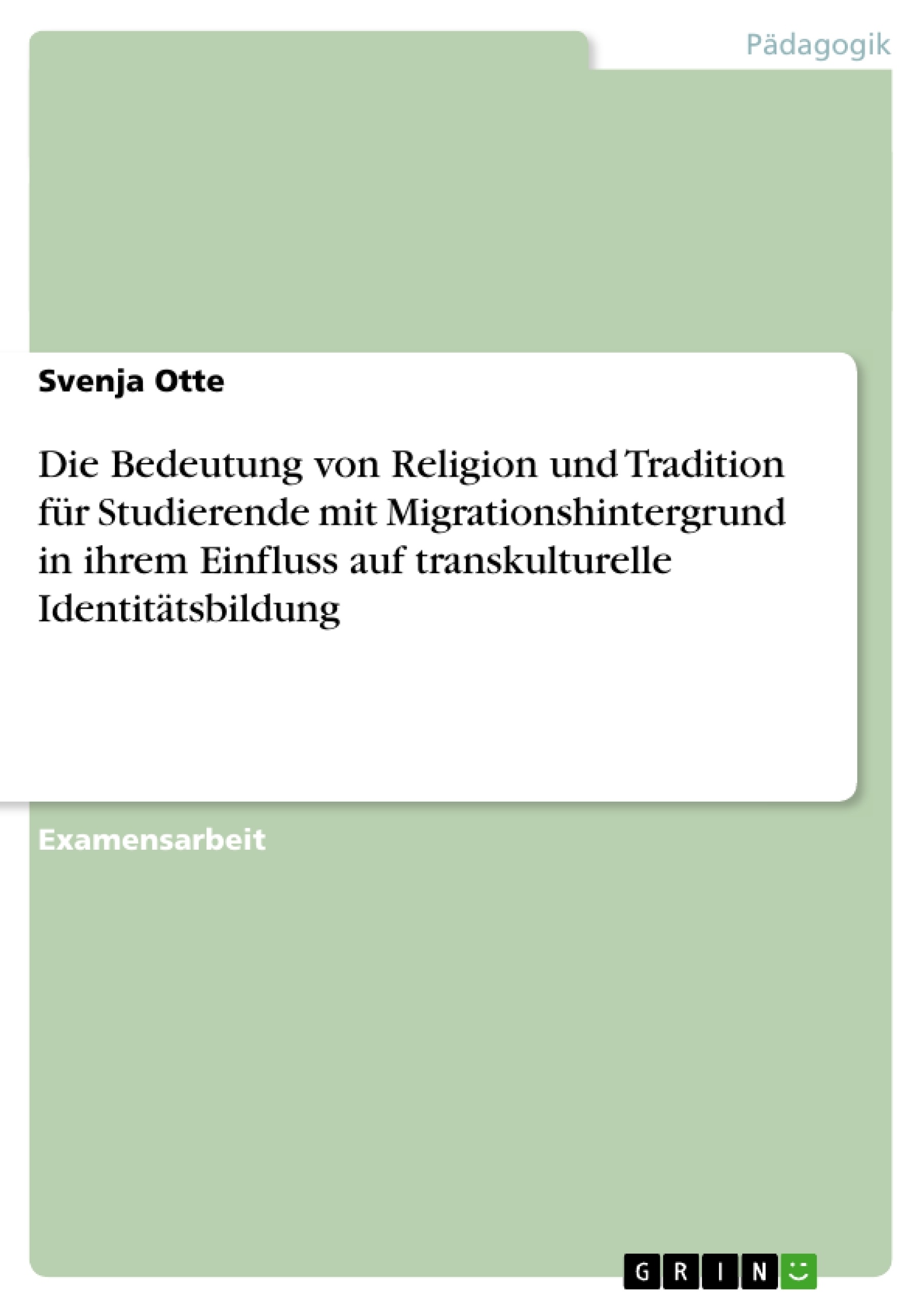Deutschland ist ein Land, in dem viele unterschiedliche Kulturen und Nationalitäten vertreten sind. Da stellt sich die Frage, wie ein Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Nationen ohne rassistische und gewaltsame Auseinandersetzungen möglich sein kann und wie es sich gestaltet.
Wissenschaftler und Pädagogen haben sich aufgrund des starken Anstiegs von Migranten in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg mit der gesellschaftlichen Auswirkung von Einwanderung beschäftigt. Sie stellten Theorien wie die der Multikulturalität und die der Interkulturalität auf. Durch die zunehmende Durchmischung von Migranten und Einheimischen in Deutschland sind die Theorien des Multikulturalismus und des Interkulturalismus überholt. Die Transkulturalität, die traditionelle Grenzen durchdringend, entwickelte sich als neue Theorie des 21. Jahrhunderts. Diese Theorie soll den Folgen der Migration offener und kooperativer entgegen treten und für eine Kultur der Integration stehen.
Die wissenschaftliche Arbeit soll herausfinden, ob die Theorie der Transkulturalität umsetzbar ist und somit ein offeneres Miteinander von Einheimischen und Migranten ermöglichen kann. Dabei ist die Identitätsbildung der Migranten ein wesentlicher Bestandteil.
Durchleben die Migranten eine transkulturelle Identitätsentwicklung aufgrund ihrer Vergangenheit? Entwickelt sich ihre Identität und somit ihre Lebenseinstellung auf der Ebene von zwei Kulturen? Und sind schließlich die Probandinnen und Probanden mit Migrationshintergrund in den pädagogischen Berufen eher in der Lage auf die Problematik der Integration in den Schulen einzugehen, als die Pädagogen ohne Migrationshintergrund?
Diese empirische Arbeit versucht, Antworten auf noch immer offene Fragen zu finden. Dafür werden 37 Studentinnen und Studenten mit Migrationshintergrund und 14 Studentinnen und Studenten ohne Migrationshintergrund befragt und ausgewertet. Dabei nimmt diese Arbeit besonderen Bezug zu den Themen „Religion“ und „Tradi-tion“. Ergänzend werden die Themen „Familie“ und „Kultur“ hinzugezogen, um die Auswertung zu vertiefen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbruch zu neuen Ufern: Integration von Migranten
- Migration: Historischer Exkurs und Hintergründe
- Unterschiedliche Kulturen prallen aufeinander: Ideen und Theorien für eine erfolgreiche Integration
- Was ist eigentlich Kultur? Eine Annäherung an einen Begriff
- Von der multikulturellen zur interkulturellen Gesellschaft
- Exkurs: Interkulturalität und Schule
- Transkulturalität
- Die Begriffe im zusammenhängendem Kontext
- Interreligiosität
- Was ist Religion?
- Worum geht es in den Religionen?
- Das Judentum
- Strömungen des Judentums
- Der Sabbat
- Das Christentum
- Die Bibel
- Östliche und westliche Kirche
- Das Kirchenjahr der Christen
- Die Feste und ihre Bedeutung
- Islam
- Der Koran
- Die Moschee
- Die Fünf Säulen
- Buddhismus
- Tradition
- Religiöse Traditionen
- Alltagstraditionen
- Zusammenfassung
- Praktischer Abschnitt
- Vorstellung des Projekts
- Die Interviews
- Das Problemzentrierte Interview
- Auswertungsverfahren
- Religion
- Deskriptiver Auswertungsschritt
- Studenten mit Migrationshintergrund
- Kontrollgruppe
- Zusammenfassende Interpretation
- Familie
- Deskriptiver Auswertungsschritt
- Zusammenfassende Interpretation
- Traditionen
- Deskriptiver Auswertungsschritt
- Zusammenfassende Interpretation
- Kultur
- Deskriptiver Auswertungsschritt
- Zusammenfassende Interpretation
- Auswertung der Ergebnisse
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Arbeit analysiert die Frage, ob die Theorie der Transkulturalität in der heutigen Gesellschaft Deutschlands anwendbar ist und somit ein offeneres Miteinander von Einheimischen und Migranten ermöglichen kann. Die Untersuchung konzentriert sich dabei auf die Identitätsbildung von Migranten, insbesondere auf die Frage, ob sie eine transkulturelle Identitätsentwicklung aufgrund ihrer Vergangenheit durchleben und ob ihre Identität und Lebenshaltung auf der Ebene von zwei Kulturen ausgeprägt wird. Die Arbeit analysiert zudem, ob Probanden mit Migrationshintergrund im pädagogischen Beruf eher in der Lage sind, auf die Problematik der Integration in den Schulen einzugehen, als Pädagogen ohne Migrationshintergrund.
- Transkulturelle Identitätsbildung von Migranten in Deutschland
- Anwendbarkeit und Tragfähigkeit der Transkulturalitätstheorie
- Einfluss von Religion, Tradition, Familie und Kultur auf die Identitätsbildung
- Interkulturelle Kompetenz von Pädagogen mit und ohne Migrationshintergrund
- Herausforderungen und Chancen der Integration in der heutigen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas der Integration von Migranten in der heutigen deutschen Gesellschaft. Es werden die Herausforderungen und Chancen des Zusammenlebens verschiedener Kulturen angesprochen, sowie die Bedeutung der Identitätsbildung von Migranten in diesem Kontext.
- Aufbruch zu neuen Ufern: Integration von Migranten: Dieses Kapitel beleuchtet den Aspekt der Migration aus verschiedenen Perspektiven und untersucht die Herausforderungen, denen sowohl Migranten als auch Einheimische in einer multikulturellen Gesellschaft gegenüberstehen. Der Fokus liegt auf der Erläuterung verschiedener Theorien zur Integration von Migranten, angefangen von der Multikulturalität, über die Interkulturalität hin zur Transkulturalität, wobei die letzte Theorie als eine vielversprechende Antwort auf die Herausforderungen der Integration im 21. Jahrhundert präsentiert wird.
- Migration: Historischer Exkurs und Hintergründe: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Migration" und gibt einen Einblick in die Geschichte und Hintergründe der Migration in Deutschland. Es werden verschiedene Aspekte der Migration beleuchtet, wie die Herausforderungen der Einwanderung, die Rolle von Kultur und Identität sowie die Bedeutung der Integration in die Gesellschaft.
- Unterschiedliche Kulturen prallen aufeinander: Ideen und Theorien für eine erfolgreiche Integration: Dieses Kapitel widmet sich der Frage, wie unterschiedliche Kulturen in der heutigen Gesellschaft zusammenleben können und welche Theorien dabei hilfreich sein können. Die Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Kultur, untersucht verschiedene Theorien der Interkulturalität und schließlich mit der Entstehung und Bedeutung der Transkulturalitätstheorie im Kontext der Integration.
- Interreligiosität: Dieses Kapitel erforscht die Bedeutung der Religion in einer multikulturellen Gesellschaft. Es definiert den Begriff "Religion" und stellt verschiedene Religionen wie Judentum, Christentum, Islam und Buddhismus vor, wobei jeweils die zentralen Lehren und Rituale der einzelnen Religionen erläutert werden.
- Tradition: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss von Traditionen auf die Integration von Migranten. Es unterscheidet zwischen religiösen und alltäglichen Traditionen und untersucht, wie diese die Identitätsbildung von Migranten prägen.
- Praktischer Abschnitt: Dieses Kapitel präsentiert die empirischen Ergebnisse der Studie, die im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit durchgeführt wurde. Es werden die Methoden der Datenerhebung und Datenanalyse vorgestellt, sowie die Ergebnisse der Interviews mit Studierenden mit und ohne Migrationshintergrund im Hinblick auf die Themen Religion, Familie, Tradition und Kultur präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Integration von Migranten in Deutschland, wobei die Identitätsbildung von Migranten im Vordergrund steht. Die wichtigsten Themen sind Transkulturalität, Interkulturalität, Multikulturalität, Religion, Tradition, Familie, Kultur, Migration und Integration. Die Arbeit verwendet dabei qualitative Forschungsmethoden, wie das problemzentrierte Interview, um die Lebenserfahrungen von Studenten mit und ohne Migrationshintergrund zu verstehen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter 'Transkulturalität'?
Transkulturalität ist eine Theorie des 21. Jahrhunderts, die über Multikulturalität hinausgeht und davon ausgeht, dass Kulturen sich gegenseitig durchdringen und vermischen.
Welchen Einfluss hat die Religion auf die Identität von Migranten?
Die Arbeit untersucht, wie religiöse Traditionen (Judentum, Christentum, Islam, Buddhismus) die Identitätsbildung und Lebenseinstellung von Studierenden prägen.
Sind Pädagogen mit Migrationshintergrund besser für die Integration geeignet?
Die empirische Studie geht der Frage nach, ob eigene Migrationserfahrungen helfen, Integrationsprobleme in Schulen sensibler und effektiver anzugehen.
Wie wurde die empirische Untersuchung durchgeführt?
Es wurden 37 Studierende mit und 14 ohne Migrationshintergrund mittels problemzentrierter Interviews zu Themen wie Familie, Religion und Kultur befragt.
Was ist der Unterschied zwischen Interkulturalität und Transkulturalität?
Interkulturalität betont den Dialog zwischen abgrenzbaren Kulturen, während Transkulturalität die Auflösung starrer kultureller Grenzen in den Vordergrund stellt.
- Citar trabajo
- Svenja Otte (Autor), 2003, Die Bedeutung von Religion und Tradition für Studierende mit Migrationshintergrund in ihrem Einfluss auf transkulturelle Identitätsbildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41376