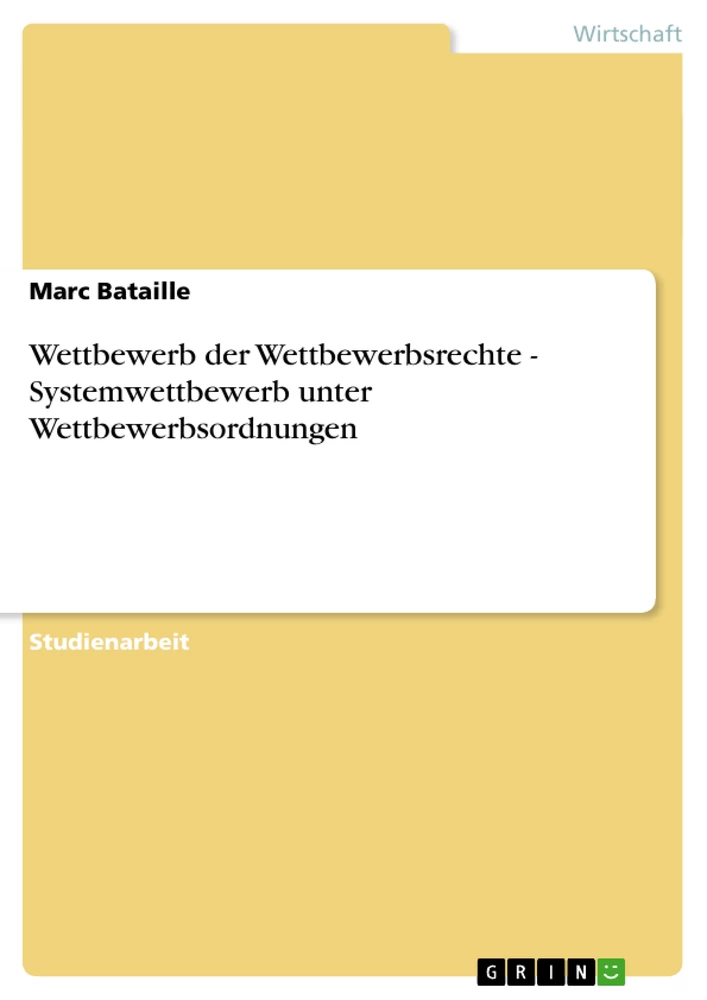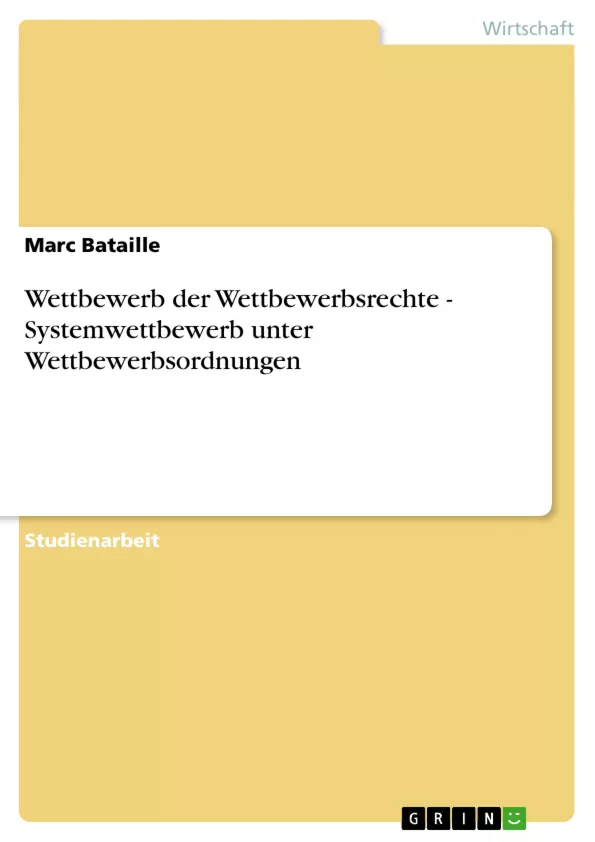1. Einleitung
Betrachtet man die ökonomischen Prozesse der letzten 15 Jahre, dann stößt man als zentrales Merkmal immer wieder auf die Öffnung von Märkten, über nationale Grenzen hinweg. Die Globalisierung wirtschaftlichen Handelns wird in der Ökonomie zumeist als ein wohlfahrtssteigernder Prozess gesehen, der mehr Wettbewerb und die günstigere Allokation internationaler Ressourcen nach sich zieht. Öffnen sich nationale Märkte, dann stehen vormals marktbeherrschende Unternehmen oft unter einem stärkeren Wettbewerbsdruck, da sie sich nicht selten gegen neue starke Konkurrenten verteidigen müssen. Daraus folgt jedoch, dass in den vergangenen Jahren Unternehmen zunehmend versuchen den mittels Internationalisierung gewonnenen Wettbewerbsdruck durch einen verstärkten Drang zu wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen einzudämmen. Entsprechend lässt sich beispielsweise seit Mitte der 90er Jahre eine empirische Tendenz zu einer Erhöhung von Marktanteilen durch internationale Fusionen beobachten. Dabei ist auffällig, dass es verstärkt zu Megafusionen von Unternehmen ähnlicher Größenordnung und ähnlicher Produktpalette kommt. Neben der gestiegenen Zahl an Fusionen, weitet sich seitdem auch die Anzahl und Bedeutung internationaler Preissetzungs- und Exportkartelle aus, wobei allein in den 90er Jahren, 40 besonders schwere Fälle nachgewiesen werden konnten. Hinzu kommen strategische Allianzen und Forschungs- und Entwicklungskooperationen, die je nach wettbewerbsdogmatischer Betrachtungsweise den Innovationswettbewerb einschränken und die zukünftige Bildung weitergehender, wettbewerbsgefährdender Abkommen induzieren.
In diesem Kontext steigt auch die Notwendigkeit nationaler Wettbewerbsordnungen an. In den vergangenen 20 Jahren verdoppelte sich die Zahl der Länder, die über ein Gesetz zum Schutze des Wettbewerbs verfügen, auf fast 80. Problematisch sind in diesem Zusammenhang jedoch Effizienzverluste, die sich aus den unterschiedlichen Wettbe-werbsordnungen und der Tatsache ergeben, dass die Reichweite von Wettbewerbsbeschränkungen in der zunehmend globalisierten Welt, über die Reichweite einzelner Jurisdiktion immer hä ufiger hinausgeht. In diesem Sinne ist die Frage mit der sich diese Arbeit in der Folge beschäftigt, ob eine einheitliche Weltwettbewerbsordnung angestrebt werden sollte oder ob die nationalen Wettbewerbsordnungen in einem Wettbewerb der Wettbewerbsrechte so konditioniert werden können, dass [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wettbewerb auf dem Markt der Wettbewerbsordnungen
- 2.1 Probleme der Bereitstellung des Gutes „Wettbewerbsschutz“ als Clubgut
- 2.2 Funktionsfähigkeit alternativer Wettbewerbsformen
- 2.2.1 Mögliche Formen von Systemwettbewerb der Wettbewerbsrechte
- 2.2.2 Kritische Analyse
- 2.3 Evolution der Wettbewerbsnormen
- 2.4 Allokative Effizienzgewinne
- 2.5 Abschließende Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit von Wettbewerbsrechten
- 3. Ökonomische Probleme bei der Bereitstellung des Gutes Wettbewerbsschutz
- 3.1 Externalitäten und Spill-over Effekte
- 3.2 Transaktionskosten und Skaleneffekte
- 3.3 Rent Seeking- und Prinzipal-Agent-Probleme
- 3.4 Fazit
- 4. Lösungsansätze durch ökonomische Gestaltungsvarianten
- 4.1 Auswirkungsprinzip und Inländerkonzept
- 4.2 Kooperationsstrategie und der Ansatz des ICN
- 4.3 Internationale Wettbewerbsregeln im Mehrebensystem
- 5. Schlussfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob eine einheitliche Weltwettbewerbsordnung angestrebt werden sollte oder ob die nationalen Wettbewerbsordnungen in einem Wettbewerb der Wettbewerbsrechte so konditioniert werden können, dass die Vorteile eines modernen wettbewerblichen Gesellschaftssystems auch auf die Ordnung des privaten Wettbewerbs selber übertragen werden können.
- Analyse der Funktionsfähigkeit von Wettbewerbsordnungen als Clubgut
- Bewertung von Systemwettbewerb und dessen Auswirkungen auf die Allokation von Ressourcen
- Untersuchung der Rolle von Externalitäten und Spill-over Effekten
- Bewertung von Lösungsansätzen durch ökonomische Gestaltungsvarianten
- Diskussion der Notwendigkeit von internationalen Wettbewerbsregeln
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet den Wettbewerb auf dem Markt der Wettbewerbsordnungen und analysiert die Probleme der Bereitstellung des Gutes „Wettbewerbsschutz“ als Clubgut. Es wird festgestellt, dass die fehlende Ausschlussmöglichkeit zu diskriminierenden Formen des Wettbewerbsschutzes führt, die starke Externalitäten nach sich ziehen. Kapitel 3 untersucht die ökonomischen Probleme bei der Bereitstellung des Gutes Wettbewerbsschutz, insbesondere Externalitäten und Spill-over Effekte, Transaktionskosten und Skaleneffekte sowie Rent Seeking- und Prinzipal-Agent-Probleme. Kapitel 4 beleuchtet verschiedene Lösungsansätze durch ökonomische Gestaltungsvarianten wie das Auswirkungsprinzip, die Kooperationsstrategie und die internationalen Wettbewerbsregeln.
Schlüsselwörter
Wettbewerb, Wettbewerbsordnungen, Clubgut, Externalitäten, Spill-over Effekte, Transaktionskosten, Skaleneffekte, Rent Seeking, Prinzipal-Agent-Probleme, Systemwettbewerb, Internationale Wettbewerbsregeln, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema der Arbeit zum Wettbewerbsrecht?
Die Arbeit untersucht, ob eine einheitliche Weltwettbewerbsordnung notwendig ist oder ob ein Systemwettbewerb zwischen nationalen Wettbewerbsrechten effizienter sein kann.
Warum wird Wettbewerbsschutz als „Clubgut“ bezeichnet?
Die Arbeit analysiert die Probleme bei der Bereitstellung von Wettbewerbsschutz, wenn dieser nur für bestimmte Jurisdiktionen gilt, aber externe Effekte auf andere Märkte hat.
Was sind Spill-over-Effekte im internationalen Wettbewerb?
Spill-over-Effekte entstehen, wenn wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen in einem Land (z.B. eine Fusion) direkte ökonomische Auswirkungen auf Märkte in anderen Ländern haben.
Welche Rolle spielt die Globalisierung für nationale Wettbewerbsordnungen?
Durch die Marktöffnung stoßen nationale Gesetze oft an ihre Grenzen, da die Reichweite von Unternehmen und Kartellen zunehmend über die Zuständigkeit einzelner Staaten hinausgeht.
Was ist der Ansatz des ICN (International Competition Network)?
Das ICN wird als Lösungsansatz durch Kooperationsstrategien vorgestellt, um nationale Wettbewerbsbehörden zu vernetzen und Standards ohne eine formale Weltordnung anzugleichen.
- Citar trabajo
- Marc Bataille (Autor), 2005, Wettbewerb der Wettbewerbsrechte - Systemwettbewerb unter Wettbewerbsordnungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41383