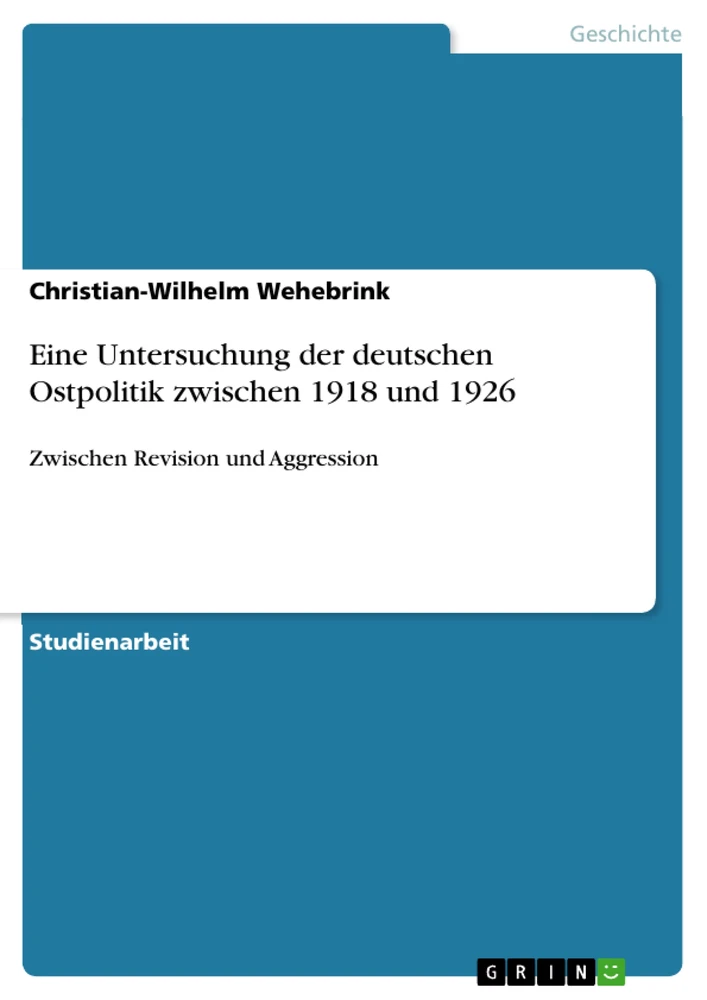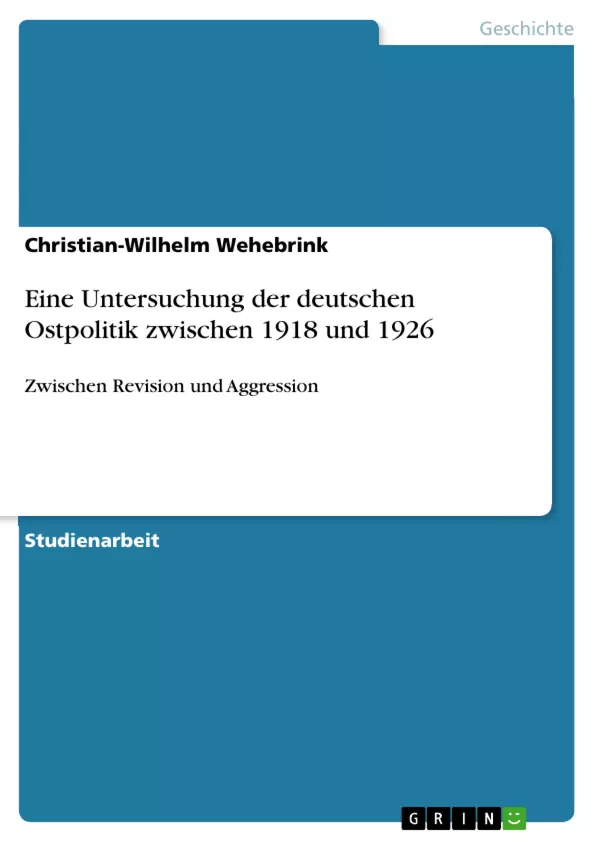Die noch junge deutsche Republik hatte seit dem Zeitpunkt ihrer Ausrufung 1918 mit scheinbar unlösbaren Problemen zu kämpfen: Militärisch besiegt, wirtschaftlich am Boden, innerlich zutiefst gespalten, lag sie in ständiger Gefahr eines Bürgerkrieges. Auch außenpolitisch stand die Republik von Weimar auf schwankendem Boden. Als Verlierer des Weltkrieges wurde Deutschland unter den Nationen isoliert. Zudem erwiesen sich die harten Bestimmungen, die dem Deutschen Reich im Versailler Vertrag auferlegt wurden als fast unlösbar: Schmerzhafte Gebietsabtretungen, der Verlust aller Kolonien und der gesamten Handelsflotte, sowie die horrenden Reparationszahlungen schwächten das vom Krieg gezeichnete Deutschland weiter und stärkten das in der Bevölkerung verbreitete Bild des „Diktats von Versailles“. Es wurde somit zum Hauptziel der deutschen Außenpolitik, die Bestimmungen des Versailler Vertrages soweit wie möglich zu revidieren und das Deutsche Reich aus seiner Isolation zu befreien. Die neuen Westgrenzen ließen mit Blick auf Frankreich keine Möglichkeit der Revision zu. Im Osten hingegen konnte zumindest das Planspiel einer Grenzkorrektur in Erwägung gezogen werden. Das Deutsche Reich hatte nach den Bestimmungen von Versailles weitreichende Gebiete im Osten an das wiedergegründete Polen verloren. Der Verlust dieser Gebiete wurde von breiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit als Schmach wahrgenommen. Man sah sich durch das von Frankreich unterstützte Polen bedroht, wenn nicht gar ausgeliefert. Eine Überwindung dieser Schmach und ein Ende der gefühlten Bedrohung durch Polen herbeizuführen, wurden somit zur Triebfeder der deutschen Ostpolitik. Welche Maßnahmen die deutsche Politik bezüglich einer solchen Revision der Ostgrenzen traf und welche Auswirkungen diese Politik auch auf die Polen hatte, soll in der vorliegenden Arbeit erläutert werden. Um diese Fragen zu beleuchten, muss als Erstes die Grundlage für die deutsch-polnischen Beziehungen zur Zeit der Weimarer Republik erörtert werden, also die Zeit vor der Etablierung der Zweiten Polnischen Republik im Jahr 1918 und dem Abschluss des Versailler Vertrages. Die Konsequenzen dieses Vertrages und die sich daraus ergebenden Folgen das für das deutsch-polnische Verhältnis, sowie die direkten Reaktionen der deutschen und polnischen Politik, sollen im Anschluss daran erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutsch-polnisches Konfliktpotential
- Die gemeinsamen Beziehungen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs
- Polen und Deutschland bis zur Unterzeichnung des Versailler Vertrags
- Bestimmungen und Folgen des Versailler Vertrages
- Sonderfall Oberschlesien
- Forderung nach Revision
- Leichte deutsch-polnische Annährung auf wirtschaftlicher Basis
- Deutsch-polnischer Wirtschaftskrieg
- Deutsch-sowjetische Zusammenarbeit gegen Polen
- Erste Annäherungen zweier Geächteter
- Geheime militärische Zusammenarbeit
- Erste Verhandlungen
- Der Vertrag von Rapallo
- Der Vertragsabschluss
- Internationale Reaktionen auf Rapallo
- Berliner Vertrag
- Vermeidung eines Ost-Locarno
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die deutsch-polnischen Beziehungen in der Zeit der Weimarer Republik und beleuchtet die Auswirkungen des Versailler Vertrags auf das deutsch-polnische Verhältnis. Sie analysiert die deutschen Bemühungen um eine Revision der Ostgrenzen und die Rolle Sowjetrusslands in diesem Kontext.
- Die deutsch-polnischen Beziehungen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs
- Der Versailler Vertrag und seine Folgen für das deutsch-polnische Verhältnis
- Die Revision der Ostgrenzen als Ziel der deutschen Außenpolitik
- Die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit gegen Polen
- Die Auswirkungen des Vertrags von Locarno auf die deutsche und polnische Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Situation der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg dar und erläutert die deutsche Motivation zur Revision der Ostgrenzen. Kapitel 2 untersucht die deutsch-polnischen Beziehungen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, einschließlich der Aufteilung Polens, des Kulturkampfs in Preußen und der deutschen Versprechungen eines polnischen Staates im Kontext des Ersten Weltkriegs. Kapitel 2.2 widmet sich der Zeit zwischen dem Waffenstillstand und der Unterzeichnung des Versailler Vertrags und analysiert die verschiedenen Positionen Deutschlands und Polens hinsichtlich der territorialen Gestaltung. Kapitel 2.3 befasst sich mit den Bestimmungen und Folgen des Versailler Vertrags für das deutsch-polnische Verhältnis und insbesondere mit den Auswirkungen auf die deutsche und polnische Politik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die deutsch-polnischen Beziehungen in der Zeit der Weimarer Republik, den Versailler Vertrag, die Revision der Ostgrenzen, die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit und den Vertrag von Locarno. Sie analysiert dabei die deutschen Bemühungen um eine Revision der Ostgrenzen und die Rolle Sowjetrusslands in diesem Kontext. Weitere wichtige Begriffe sind: Kulturkampf, Germanisierungspolitik, Freikorps, Polnisch-sowjetischer Krieg.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Hauptziel der deutschen Ostpolitik nach 1918?
Hauptziel war die Revision der im Versailler Vertrag festgelegten Ostgrenzen, insbesondere die Rückgewinnung von Gebieten, die an Polen verloren gingen.
Welche Bedeutung hatte der Versailler Vertrag für das deutsch-polnische Verhältnis?
Der Vertrag wurde in Deutschland als „Diktat“ empfunden und führte zu tiefen Spannungen, da er weitreichende Gebietsabtretungen an das wiedergegründete Polen vorschrieb.
Was beinhaltete der Vertrag von Rapallo?
Im Vertrag von Rapallo näherten sich Deutschland und Sowjetrussland an, verzichteten auf gegenseitige Entschädigungen und begannen eine geheime militärische Zusammenarbeit.
Warum kam es zum deutsch-polnischen Wirtschaftskrieg?
Er war Teil der deutschen Strategie, Polen wirtschaftlich unter Druck zu setzen, um politische Zugeständnisse bei der Grenzziehung zu erzwingen.
Was versteht man unter dem „Sonderfall Oberschlesien“?
In Oberschlesien kam es nach einer Volksabstimmung zu heftigen Konflikten und Aufständen, die schließlich zur Teilung des wirtschaftlich wichtigen Gebiets führten.
- Citar trabajo
- Christian-Wilhelm Wehebrink (Autor), 2014, Eine Untersuchung der deutschen Ostpolitik zwischen 1918 und 1926, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414257