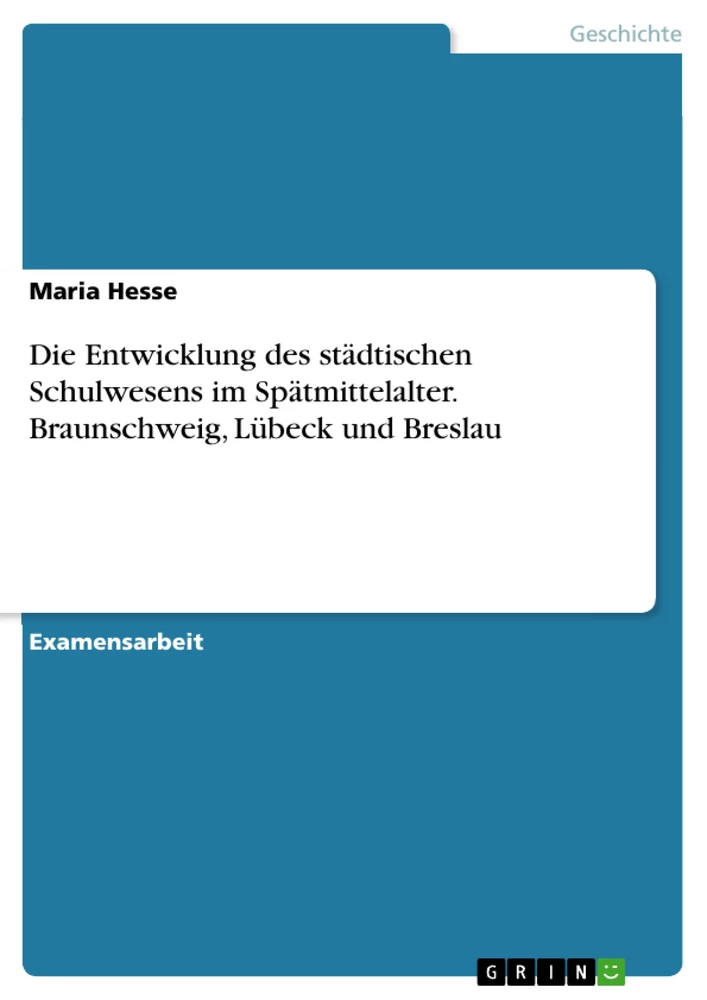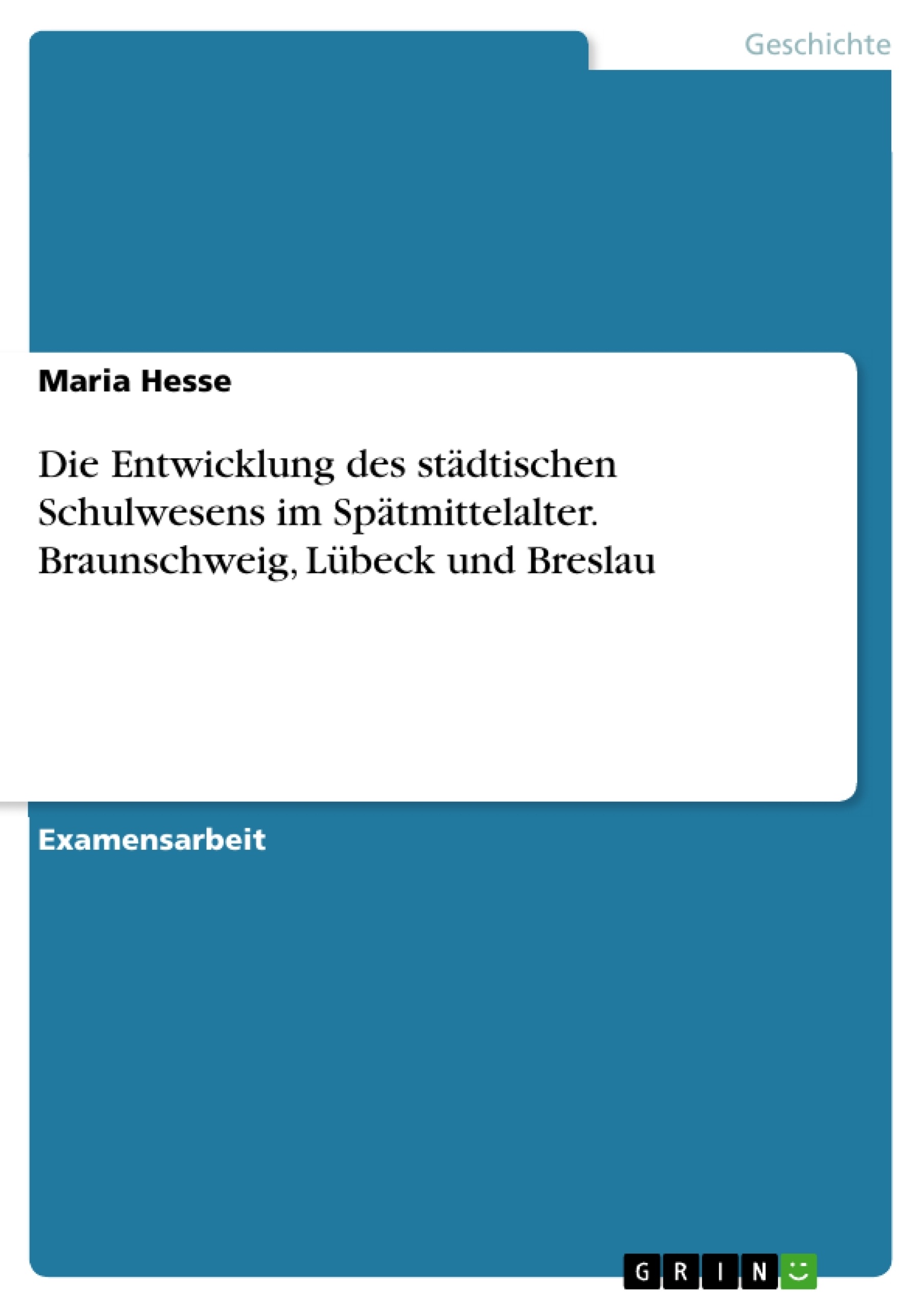Mit dem Aufblühen der Städte im Verlauf des späten Hochmittelalters kam es zu entscheidenden Veränderungen in Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Nicht mehr nur Herzöge und Fürsten bestimmten das Zusammenleben der Gemeinschaft, sondern zunehmend erkämpften sich und erhielten die Bewohner der Städte Rechte und Privilegien, was dazu führte, dass die Funktionsweise der Stadt und das Zusammenleben der Menschen den gemeinsamen Regelungen unterlag. Der Wille zur Selbstbestimmung und Unabhängigkeit wurde immer größer. Somit strebten die Bürger einer Stadt auch die Selbstbestimmung der Jugenderziehung an und versuchten zunehmend, sich von dem Bildungsmonopol der Kirche zu lösen. Es stellt sich hierbei die Frage, welche ausschlaggebenden Aspekte es im 13., 14. und 15. Jahrhundert gab, welche die Bürger einer Stadt dazu veranlasst haben, das Bildungsmonopol der Kirche in Frage zu stellen und anzutasten. Wer erteilte das Recht, eine Schule zu gründen? Wie ging dieser rechtliche Akt vonstatten und welche Auswirkungen brachte diese Veränderung in der Gesellschaft der Stadtbewohner mit sich? Auch ist die Frage zu klären, wie sich im Zuge dieser Veränderungen das Verhältnis von Kirche und Stadtverwaltung kennzeichnete. Diese und weitere Fragen sollen im Verlauf der vorliegenden Arbeit in Bezug auf die Städte Breslau, Lübeck und Braunschweig vergleichend untersucht und geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Quellen- und Forschungsbericht
- 1.3 Aufbau und Methode der Arbeit
- 2. Städte als Motor zur Weiterentwicklung des Schulwesens im Spätmittelalter
- 2.1 Die „neue“ Stadtbevölkerung - der Wille nach Selbstbestimmung
- 2.2 Stadt und Bildung - ein Zusammenhang?
- 3. Städtische Schulen im Spätmittelalter
- 3.1 Die kirchen- und stadtpolitischen Voraussetzungen der Städte
- 3.1.1. Die Geschichte Braunschweigs im Hinblick auf die Gründung der ersten städtischen Schule zu Beginn des 15. Jahrhunderts
- 3.1.2 Lübeck im 12. und 13. Jahrhundert
- 3.1.3 Die Stadtgeschichte Breslaus
- 3.2 Ursachen und Auslöser für städtische bildungsinstitutionelle Bestrebungen
- 3.2.1 Braunschweigs Bestrebungen im 15. Jahrhundert und ihre Ursachen
- 3.2.2 Gründe für das bildungsinstitutionelle Bestreben der Lübecker Stadtbürger
- 3.2.3 Breslaus erste Schulgründung und deren Beweggründe
- 3.3 Vom Antrag zur Gründung der rechtliche Ablauf einer Schulgründung
- 3.4 Exkurs: Schultypen in der Schullandschaft des Spätmittelalters
- 3.5 Städtische Schulen in Abgrenzung zu kirchlichen Bildungseinrichtungen – Pfarrschule und Domschule
- 3.6 Das Spannungsverhältnis zwischen Kirche und Stadt im Zuge der städtischen Schulentwicklung
- 3.6.1 Der Streit um die Schulfrage im spätmittelalterlichen Braunschweig
- 3.6.2 Die Lübecker Schulfrage
- 3.6.3 Die Situation des Breslauer Stadtrats und der Kirche im Zusammenhang mit der Schulfrage
- 3.1 Die kirchen- und stadtpolitischen Voraussetzungen der Städte
- 4. Die Auswirkungen der sich verändernden Schulpolitik im Verlauf des Spätmittelalters - ein Ausblick
- 5. Braunschweig Lübeck Breslau: ein zusammenfassender Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des städtischen Schulwesens im Spätmittelalter und analysiert die entscheidenden Veränderungen im Bildungsbereich im Kontext des wachsenden städtischen Einflusses und der sich wandelnden gesellschaftlichen Strukturen.
- Die Bedeutung der Städte als Motoren der Bildungsentwicklung im Spätmittelalter
- Die Ursachen und Auslöser für die Gründung städtischer Schulen
- Der rechtliche Prozess der Schulgründung und die Rolle von Stadt und Kirche
- Die Spannungen zwischen Kirche und Stadt im Zusammenhang mit der Schulfrage
- Die Auswirkungen der neuen Schulpolitik auf die Gesellschaft im Spätmittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Relevanz der Fragestellung in Bezug auf den Wandel des Schulwesens im Spätmittelalter. Es stellt das historische Umfeld dar und erläutert die Motivation zur Untersuchung des Themas.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Bedeutung der Städte im Spätmittelalter als Motor für die Weiterentwicklung des Bildungswesens. Es wird die Entwicklung der städtischen Bevölkerung und ihr Streben nach Selbstbestimmung hervorgehoben.
Das dritte Kapitel untersucht die Bildungseinrichtungen in den Städten Braunschweig, Lübeck und Breslau. Es werden die historischen Hintergründe und politischen Rahmenbedingungen der Städte betrachtet, die zur Gründung städtischer Schulen führten.
Das vierte Kapitel analysiert die Auswirkungen der Veränderungen in der Schulpolitik auf die Gesellschaft im Spätmittelalter. Es werden die Herausforderungen und Chancen, die mit der neuen Schulpolitik verbunden waren, beleuchtet.
Das fünfte Kapitel stellt einen Vergleich der Entwicklung des Schulwesens in den drei Städten Braunschweig, Lübeck und Breslau dar.
Schlüsselwörter
Städtisches Schulwesen, Spätmittelalter, Bildungsmonopol, Kirche, Stadtverwaltung, Selbstbestimmung, Schulgründung, Rechtlicher Prozess, Spannungsverhältnis, Auswirkungen, Vergleich, Braunschweig, Lübeck, Breslau.
- Citar trabajo
- Maria Hesse (Autor), 2015, Die Entwicklung des städtischen Schulwesens im Spätmittelalter. Braunschweig, Lübeck und Breslau, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414470