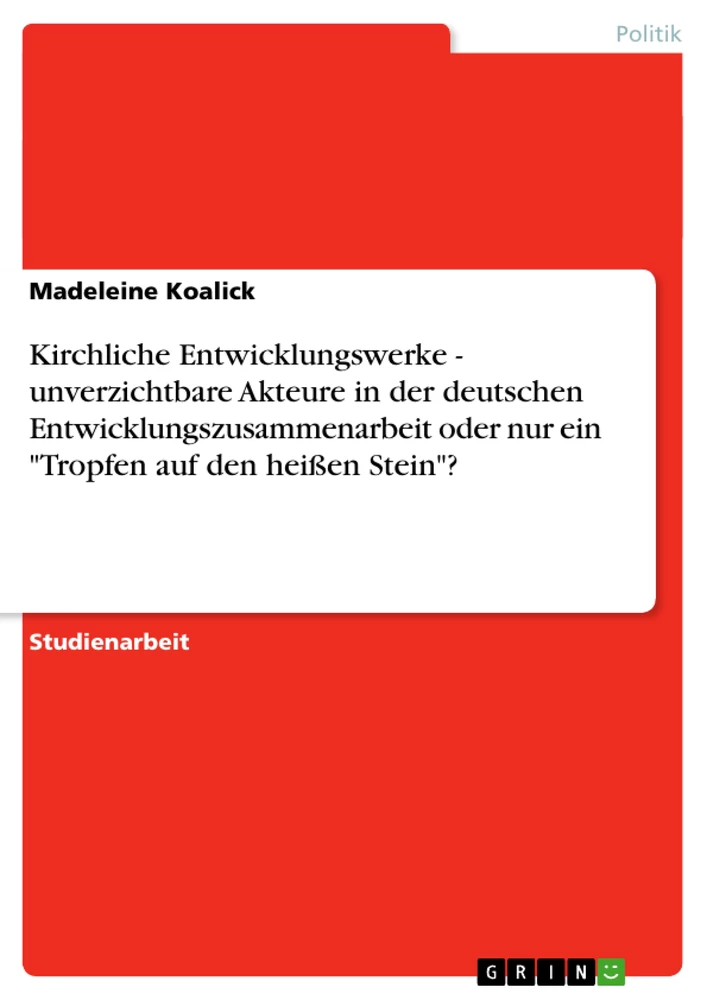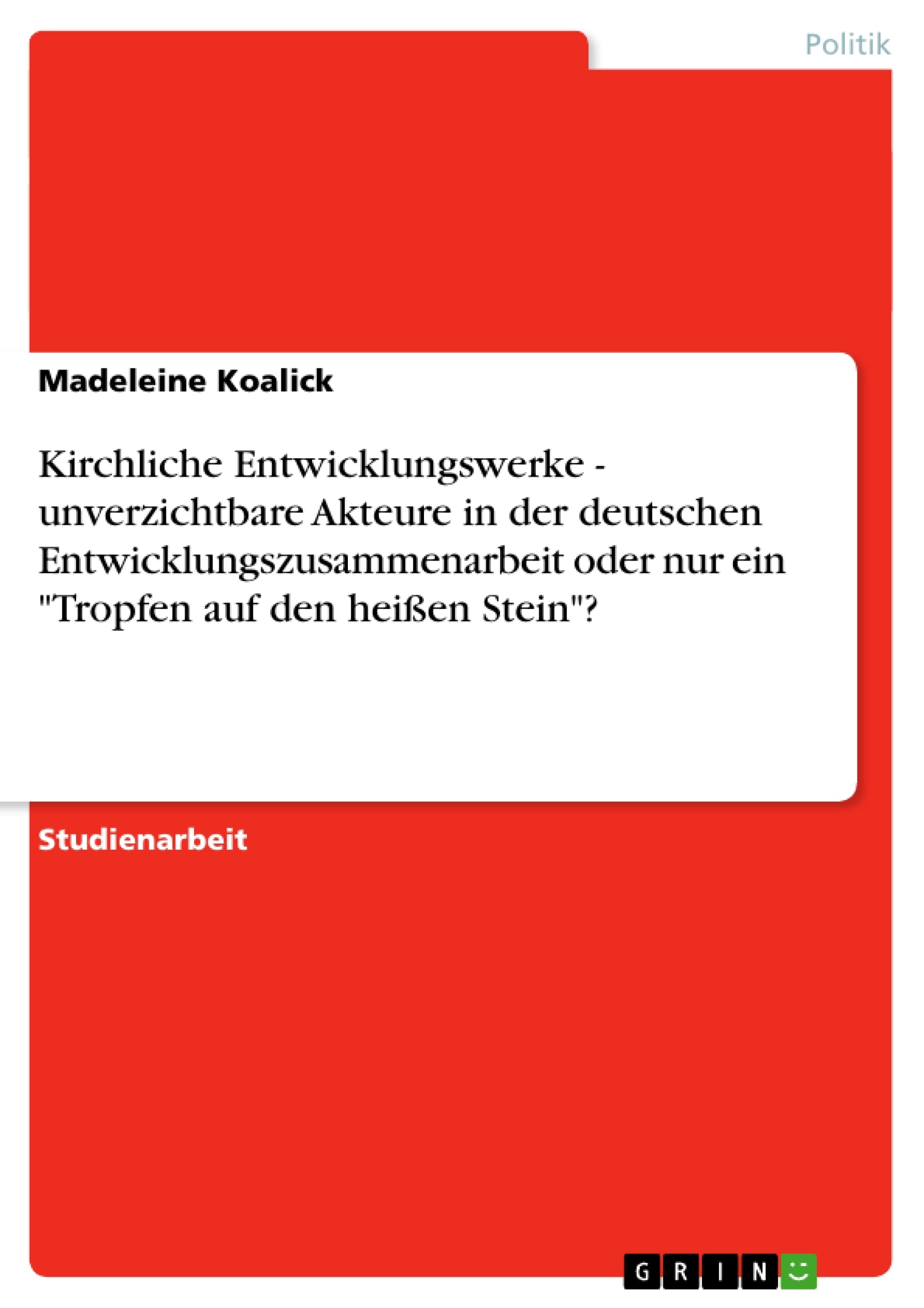Die klassischen Formen der öffentlichen Entwicklungshilfe stecken auch in der Bundesrepublik Deutschland in einer Orientierungs- Finanz-, und Vertrauenskrise. Sobald an der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, wie sie überwiegend vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und seinen Partnern wahr-genommen wird, Kritik laut wird, werden die Nichtregierungsorganisationen (NRO) als neue Hoffnungsträger gefeiert. Sie seien weniger außenpolitisch gebunden, eher armuts- und basisorientiert und damit in der Lage, Schwächen der staatlichen Arbeit auszugleichen. Ein großer Teil nichtstaatlicher Entwicklungsarbeit wird in Deutschland von den kirchlichen Entwicklungswerken der Katholischen und Evangelischen Kirche, wie dem Evangelischen Entwicklungsdienst (EED), Brot für die Welt oder Misereor übernommen.
Kirchliches Entwicklungsengagement geht zurück auf die traditionellen kirchlichen Wirkungsfelder der Mission, Diakonie und Caritas als Ausdruck christlicher Nächstenliebe. Die Anfänge kirchlicher Entwicklungsarbeit liegen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich die Kirchen, bei steigendem Wohlstand in der Bundesrepublik, für die erhaltenen Hilfen an die notleidende deutsche Bevölkerung mit verstärktem Engagement in der Dritten Welt revanchieren wollten. Um ihre von Beginn an armutsorientierte Entwicklungsarbeit effektiv zu gestalten, wurden mit Misereor und Brot für die Welt 1958 und 1959 separate Entwicklungshilfeorganisationen geschaffen. Bereits hier einigte man sich auf eine strikte Trennung zwischen Missions- und Entwicklungswerken. Konzentrierten sich die kirchlichen Hilfswerke zunächst nur auf kurzfristige humanitäre Hilfe, so ließ sich in der Folgezeit eine Tendenz zur Projekt- und Programmarbeit unter dem Schlagwort der „Hilfe zur Selbsthilfe“ erkennen. Verstärkte Forderungen lokaler Gemeinden in den Entwicklungsländern seit den 80er Jahren und die veränderte politische Situation nach Ende des Ost-West Konflikts führten zur Auseinandersetzung mit politischen Themen, wie Menschenechten und Demokratisierung, Strukturanpassung und Systemveränderung. Mit der Integration dieser Aufgabenbereiche in ihre Arbeit beweisen die kirchlichen Hilfswerke trotz ihres Religionsbezuges eine große Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit. Diese zeigt sich auch in Form moderner Advocacy-Arbeit, mit der kirchliche Entwicklungswerke versuchen auf strukturelle Rahmenbedingungen und Entwicklungshemmnisse Einfluss zu nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklungsarbeit deutscher kirchlicher Hilfswerke
- Gesellschaftliche Akzeptanz und organisatorische Besonderheiten
- Vor- und Nachteile der Partnerorientierung kirchlicher Hilfswerke
- Thematische Schwerpunkte der Projektarbeit – armuts-, partizipations- und basisorientierter Graswurzelansatz
- Dualismus von Projekt und Inlandsarbeit
- Kirchlich-staatliche Kooperation im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Rolle deutscher kirchlicher Entwicklungswerke in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Sie beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen ihres Engagements und stellt die Frage, ob sie als unverzichtbare Akteure gelten können oder ihre Arbeit lediglich einen "Tropfen auf den heißen Stein" darstellt.
- Gesellschaftliche Akzeptanz und organisatorische Besonderheiten kirchlicher Entwicklungswerke
- Partnerorientierung und ihre Vor- und Nachteile
- Thematische Schwerpunkte und der armuts-, partizipations- und basisorientierte Graswurzelansatz
- Dualismus von Projekt- und Inlandsarbeit
- Kirchlich-staatliche Kooperation in der Entwicklungszusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Entwicklungszusammenarbeit deutscher kirchlicher Hilfswerke im Kontext staatlicher und anderer nichtstaatlicher Akteure dar. Sie beleuchtet die historische Entwicklung und die Herausforderungen, die die Arbeit der kirchlichen Entwicklungswerke prägen.
Das zweite Kapitel analysiert die Besonderheiten kirchlicher Entwicklungsarbeit. Es betrachtet die gesellschaftliche Akzeptanz, die organisatorischen Strukturen und die Partnerorientierung. Darüber hinaus werden die thematischen Schwerpunkte der Projektarbeit, der Dualismus von Projekt- und Inlandsarbeit sowie die kirchlich-staatliche Kooperation im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit untersucht.
Schlüsselwörter
Deutsche kirchliche Entwicklungswerke, Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Partnerorientierung, Graswurzelansatz, Kirchlich-staatliche Kooperation, Gesellschaftliche Akzeptanz, Moralische Autorität.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die bekanntesten kirchlichen Entwicklungswerke in Deutschland?
Zu den bedeutendsten Werken gehören Misereor (katholisch) sowie "Brot für die Welt" und der Evangelische Entwicklungsdienst (EED) (evangelisch).
Was unterscheidet kirchliche von staatlicher Entwicklungszusammenarbeit?
Kirchliche Werke gelten oft als basisorientierter und weniger an außenpolitische Interessen gebunden. Sie arbeiten häufig direkt mit lokalen Partnerorganisationen und Gemeinden vor Ort zusammen ("Graswurzelansatz").
Was bedeutet das Prinzip der "Hilfe zur Selbsthilfe"?
Dieses Prinzip zielt darauf ab, Menschen in Entwicklungsländern so zu unterstützen, dass sie langfristig ihre Lebensbedingungen aus eigener Kraft verbessern können, statt nur kurzfristige Nothilfe zu erhalten.
Sind kirchliche Entwicklungshilfe und Mission dasselbe?
Nein, in der deutschen kirchlichen Arbeit gibt es seit den 1950er Jahren eine strikte Trennung zwischen der Verkündigung des Glaubens (Mission) und der professionellen Entwicklungszusammenarbeit.
Wie arbeiten Staat und Kirchen in der Entwicklungshilfe zusammen?
Der Staat (BMZ) finanziert einen erheblichen Teil der kirchlichen Entwicklungsarbeit aus Steuermitteln, da die Kirchen über gewachsene, vertrauensvolle Strukturen in den Partnerländern verfügen, die staatliche Akteure oft nicht haben.
Was ist "Advocacy-Arbeit" im Kontext kirchlicher Werke?
Advocacy bedeutet politische Lobbyarbeit. Kirchliche Werke versuchen, Einfluss auf politische Rahmenbedingungen zu nehmen, um strukturelle Entwicklungshemmnisse wie ungerechte Handelsstrukturen oder Menschenrechtsverletzungen zu beseitigen.
- Citar trabajo
- Madeleine Koalick (Autor), 2004, Kirchliche Entwicklungswerke - unverzichtbare Akteure in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit oder nur ein "Tropfen auf den heißen Stein"?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41450