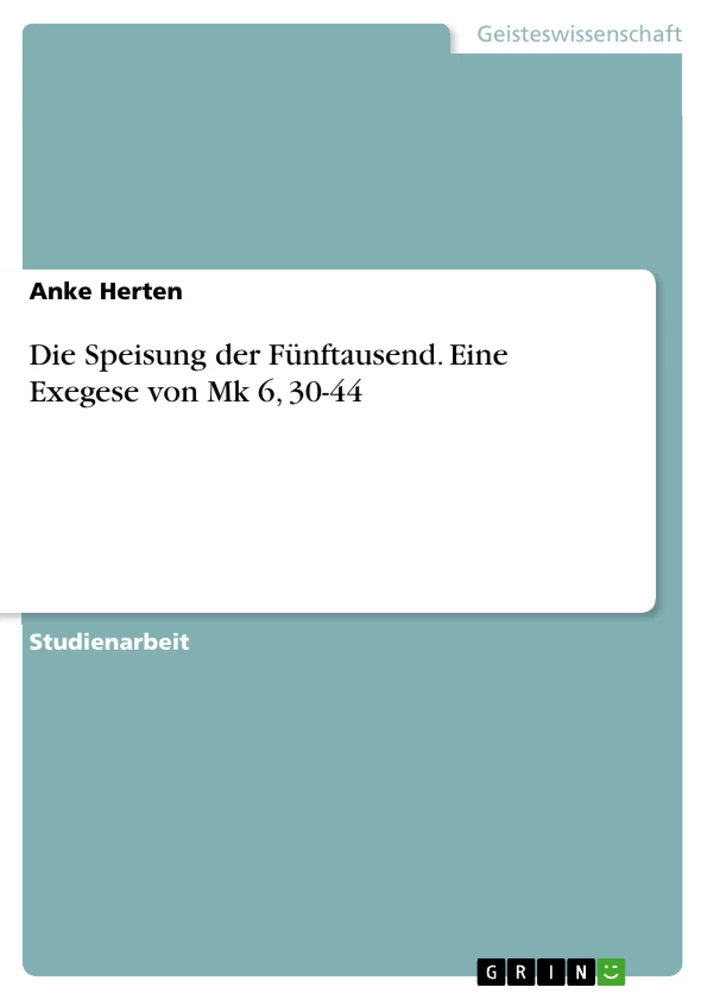Schon in unserer frühen Sozialisation begegnen uns Geschichten von Jesu Wundertaten im Alltag, wie zum Beispiel im Kindergottesdienst oder im Religionsunterricht. In den Evangelien und in der Apostelgeschichte spielen die Wundergeschichten eine wichtige Rolle und treten besonders zahlreich auf. Als Kind wird einem durch diese Geschichten deutlich, dass Jesus kein normaler Mensch gewesen sein kann. Durch Jesu Wundertaten werden die Allmacht, die Barmherzigkeit und die Güte des Herrn offenbart. Dies geschieht in einer besonders anschaulichen und bildlichen Weise. Manch einer erinnert sich auch im Erwachsenenalter noch gut an die Heilungswunder, den Gang Jesu auf dem Wasser oder die Umwandlung von Wasser zu Wein, die ihm in der Kindheit zuletzt begegnet sind. Die Wundergeschichten sind nämlich meist leicht verständlich, eingängig und bleiben den Hörern oder Lesern unter anderem durch die ausgelöste Verwunderung lange im Gedächtnis. Aber gerade diese anstößige, verwunderliche und außergewöhnliche Komponente der ntl. Wundergeschichten macht sie auch zu einer sehr komplexen und schwierigen Textart.
Ziel dieser Exegese ist es, die Formen, Strukturen und Intentionen dieser neutestamentlichen Textart näher zu betrachten. Anhand einer ausgewählten Wundergeschichte, der Speisung der Fünftausend aus dem Markusevangelium, wird dies spezifisch betrachtet. Die Perikope soll exegetisch analysiert werden um die Redaktion und Komposition, sowie auch den historischen Kontext und die Intentionen der Perikope freizulegen.
Im Anschluss daran soll die Perikope hermeneutisch reflektiert und auf ihr heutiges didaktisches Potenzial für den Schulunterricht hin untersucht werden. Dazu soll versucht werden, die mythische, vielleicht auch redaktionell bearbeitete Gestalt der Perikope abzutragen, um den Kern der Erzählung herauszuarbeiten und auszulegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzung
- Textkritik
- Realien
- Kontext- und Kohärenzkritik
- Formgeschichte
- Literarkritik-synoptischer Vergleich
- Redaktions- und Kompositionskritik
- Hermeneutische Reflexion
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Wundergeschichte der Speisung der Fünftausend aus dem Markusevangelium (Mk 6, 30-44). Die Zielsetzung ist es, die Formen, Strukturen und Intentionen dieser neutestamentlichen Textart näher zu betrachten und die Perikope exegetisch zu analysieren, um die Redaktion und Komposition, sowie den historischen Kontext und die Intentionen freizulegen. Die Arbeit untersucht auch das didaktische Potenzial der Perikope für den Schulunterricht und versucht, die mythische Gestalt der Perikope abzutragen, um den Kern der Erzählung herauszuarbeiten.
- Exegetische Analyse der Wundergeschichte
- Redaktions- und Kompositionskritik
- Historischer Kontext und Intentionen
- Didaktisches Potenzial für den Schulunterricht
- Herausarbeitung des Kerns der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Wundergeschichten in der frühen Sozialisation und in den Evangelien. Sie stellt die Bedeutung der Wundergeschichten für die Offenbarung von Jesu Allmacht, Barmherzigkeit und Güte dar.
- Übersetzung: In diesem Kapitel wird die Übersetzung der Perikope der Speisung der Fünftausend aus dem Markusevangelium vorgestellt. Die Arbeit verwendet die Zürcher neue deutsche Übersetzung der Bibel von 2007 und erläutert die Besonderheiten und die Übersetzungsphilosophie dieser Bibelübersetzung.
- Textkritik: Das Kapitel befasst sich mit der Textkritik und erklärt, wie Veränderungen im Text durch das Abschreiben entstanden sind. Es werden verschiedene Ursachen für die Veränderungen, wie Lese- und Schreibfehler, dogmatische Gründe und Textunverständnis, erläutert.
- Realien: Dieses Kapitel behandelt die Realien, die im Kontext der Wundergeschichte relevant sind. Es beleuchtet die sozialen und kulturellen Aspekte, die für das Verständnis der Perikope wichtig sind.
- Kontext- und Kohärenzkritik: Die Kontext- und Kohärenzkritik befasst sich mit der Einordnung der Perikope in den Kontext des Markusevangeliums und untersucht die Kohärenz der Erzählung im größeren Rahmen.
- Formgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die formgeschichtliche Analyse der Perikope und untersucht die Gattung, zu der die Wundergeschichte gehört.
- Literarkritik-synoptischer Vergleich: Die Literarkritik-synoptischer Vergleich setzt sich mit dem Vergleich der Perikope der Speisung der Fünftausend in den anderen Evangelien (Matthäus und Lukas) auseinander und analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
- Redaktions- und Kompositionskritik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Redaktions- und Kompositionskritik und untersucht die Entscheidungen des Evangelisten Markus bei der Gestaltung der Perikope.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema neutestamentliche Wundergeschichten, insbesondere der Speisung der Fünftausend im Markusevangelium. Zu den Schlüsselbegriffen zählen exegetische Analyse, Redaktions- und Kompositionskritik, historischer Kontext, Intentionen, didaktisches Potenzial, mythische Gestalt, Kern der Erzählung, Zürcher neue deutsche Übersetzung der Bibel, Textkritik und Realien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Exegese von Mk 6, 30-44?
Die Arbeit analysiert die Wundergeschichte der Speisung der Fünftausend hinsichtlich Form, Struktur, Redaktion und historischem Kontext.
Welche Rolle spielen Wundergeschichten im Markusevangelium?
Sie dienen dazu, die Allmacht, Barmherzigkeit und Güte Jesu Christi anschaulich zu offenbaren.
Was wird bei der Textkritik untersucht?
Es wird untersucht, wie der Text durch Abschreibfehler oder dogmatische Anpassungen im Laufe der Zeit verändert wurde.
Welche Bedeutung hat die Perikope für den Schulunterricht?
Die Arbeit reflektiert das didaktische Potenzial der Geschichte, um Schülern den Kern der christlichen Botschaft näherzubringen.
Was ist ein synoptischer Vergleich?
Dabei werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Erzählung in den Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas analysiert.
- Arbeit zitieren
- Anke Herten (Autor:in), 2016, Die Speisung der Fünftausend. Eine Exegese von Mk 6, 30-44, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414606