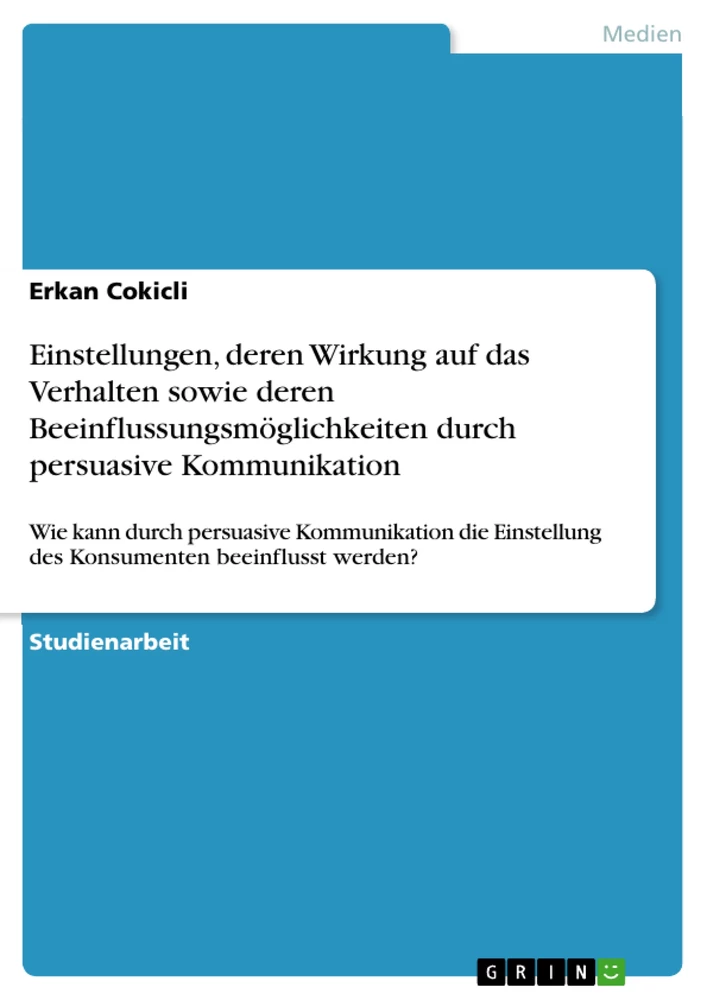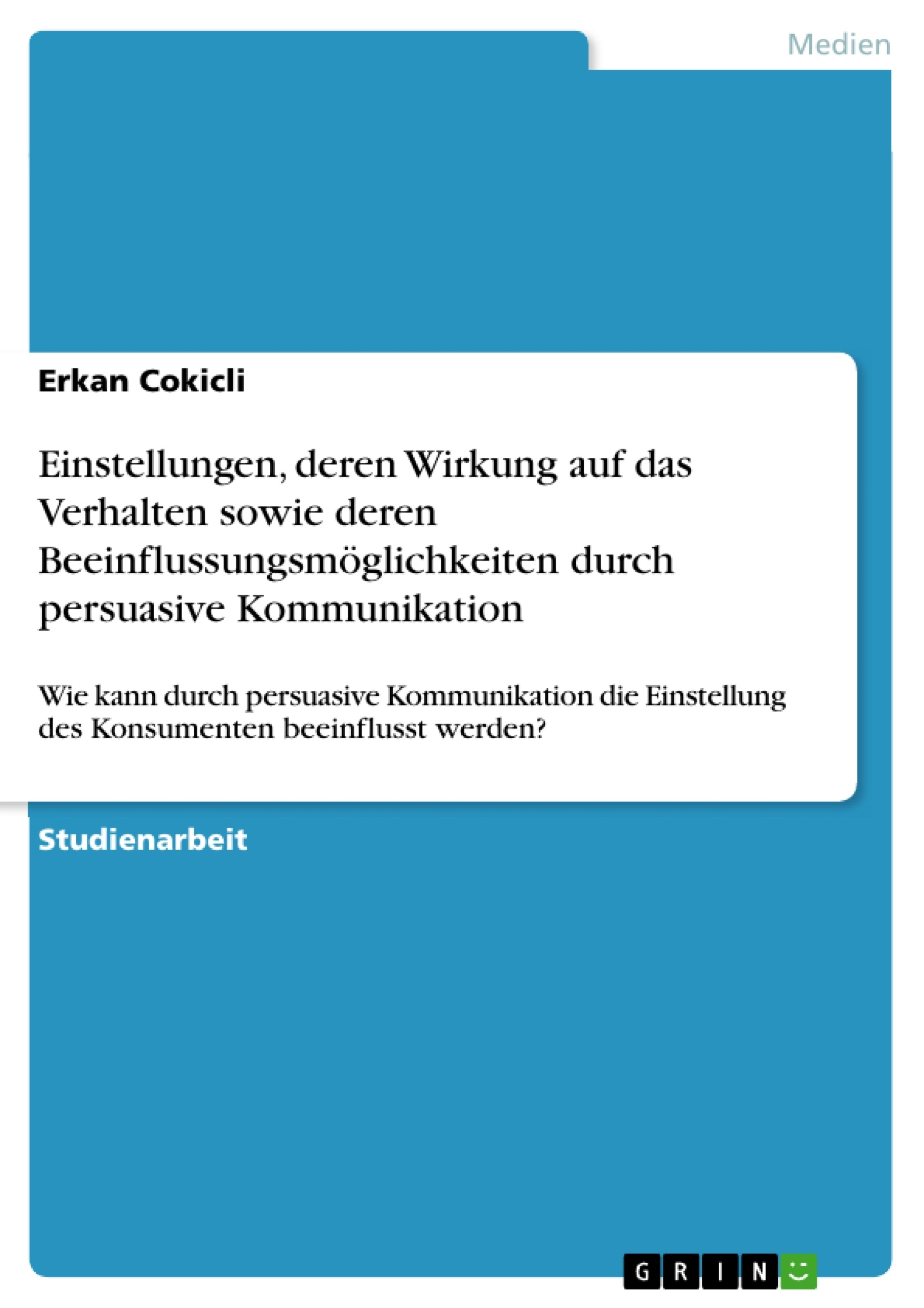Diese Semesterarbeit geht auf Einstellungen von Kunden, Konsumenten und Dienstleistungsbezügern gegenüber Produkten, Dienstleistungen, Unternehmen oder dem Image eines Unternehmens ein. Die vorliegende Literaturarbeit zeigt mit Hilfe der bestehenden Theorie auf, was Einstellungen sind, wie sie sich auf das Verhalten auswirken und wie sie durch persuasive Kommunikation verändert werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Zweck der Arbeit und Themenabgrenzung
- Theoretische Grundlagen
- Begrifflichkeiten
- Einstellungen
- Definitionen von Einstellungen
- Ebenen von Einstellungen
- Struktur von Einstellungen
- Entstehung von Einstellungen
- Funktionen von Einstellungen
- Zusammenfassung
- Verhalten
- Respondentes Verhalten
- Operantes Verhalten
- Theorie des überlegten Handelns
- Theorie des geplanten Verhaltens
- MODE Modell
- Theorie der kognitiven Dissonanz
- Zusammenfassung
- Einstellungsänderung durch persuasive Kommunikation
- Kommunikationsmodell nach Shannon und Weaver
- Kommunikationstheorie nach Schulz von Thun
- Persuasive Kommunikation im Marketing
- Yale Ansatz zur Einstellungsänderung
- Zusammenfassung
- Werbewirkungsmodelle
- Hierarchische Modelle
- AIDA Modell
- McGuires Ebenen der Wirksamkeit einer persuasiven Kommunikation
- Hierarchie-von-Effekten-Modelle
- Zwei-Prozess-Modelle
- Elaborationswahrscheinlichkeits-Modell
- Heuristisch-Systematische-Modell
- Alternative-Wege-Modell
- Fazit und Ausblick
- Definition und verschiedene Arten von Einstellungen
- Der Einfluss von Einstellungen auf das Verhalten
- Die Funktionsweise von persuasiver Kommunikation
- Verschiedene Werbewirkungsmodelle
- Die Rolle des Involvement bei der Informationsverarbeitung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit zielt darauf ab, die Funktionsweise von Einstellungen, deren Einfluss auf das Verhalten und die Möglichkeiten, diese durch persuasive Kommunikation zu verändern, zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und stellt die Forschungsfrage: „Wie kann durch persuasive Kommunikation die Einstellung des Konsumenten beeinflusst werden?“.
Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen, wobei insbesondere die Definition von Einstellungen, deren Ebenen, Struktur, Entstehung, Funktionen und die Verbindung zum Verhalten im Fokus stehen.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Thema „Einstellungsänderung durch persuasive Kommunikation“. Es werden verschiedene Kommunikationsmodelle, wie das Modell von Shannon und Weaver sowie die Theorie von Schulz von Thun, behandelt. Weiterhin wird die persuasive Kommunikation im Marketing und der Yale Ansatz zur Einstellungsänderung erläutert.
Kapitel 4 widmet sich verschiedenen Werbewirkungsmodellen. Es werden hierarchische Modelle, wie das AIDA Modell, sowie Zwei-Prozess-Modelle, wie das Elaborationswahrscheinlichkeits-Modell und das Heuristisch-Systematische-Modell, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind Einstellungen, Verhalten, persuasive Kommunikation, Werbewirkungsmodelle, Involvement, Informationsverarbeitung, Konsumentenverhalten, Marketing, Werbung, und Einstellungsänderung. Die Arbeit analysiert die Beziehung zwischen Einstellungen und Verhalten und erforscht, wie persuasive Kommunikation und Werbewirkungsmodelle eingesetzt werden können, um die Einstellungen von Konsumenten zu beeinflussen und so das Verhalten zu steuern.
Häufig gestellte Fragen
Was ist persuasive Kommunikation?
Persuasive Kommunikation ist eine Form der Kommunikation, die darauf abzielt, die Einstellungen und das Verhalten von Empfängern (z.B. Konsumenten) gezielt zu beeinflussen oder zu ändern.
Wie hängen Einstellungen und Verhalten zusammen?
Einstellungen dienen oft als Prädiktoren für Verhalten. Theorien wie das "geplante Verhalten" erklären, wie die Einstellung zu einer Handlung die tatsächliche Ausführung beeinflusst.
Was besagt das AIDA-Modell?
Es beschreibt die Stufen der Werbewirkung: Attention (Aufmerksamkeit), Interest (Interesse), Desire (Wunsch) und Action (Handlung).
Was ist kognitive Dissonanz?
Kognitive Dissonanz ist ein unangenehmer Gefühlszustand, der entsteht, wenn Einstellungen und Verhalten nicht übereinstimmen. Menschen versuchen, diesen Zustand durch Einstellungsänderung aufzulösen.
Welche Rolle spielt das "Involvement"?
Das Involvement bestimmt, wie intensiv Informationen verarbeitet werden. Bei hohem Involvement erfolgt eine systematische Prüfung, bei geringem Involvement wirken eher oberflächliche Reize.
Was ist der Yale-Ansatz zur Einstellungsänderung?
Dieser Forschungsansatz untersucht, welche Faktoren der Quelle (wer), der Botschaft (was) und des Empfängers (zu wem) die Überzeugungskraft einer Kommunikation bestimmen.
- Citation du texte
- Erkan Cokicli (Auteur), 2017, Einstellungen, deren Wirkung auf das Verhalten sowie deren Beeinflussungsmöglichkeiten durch persuasive Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414632