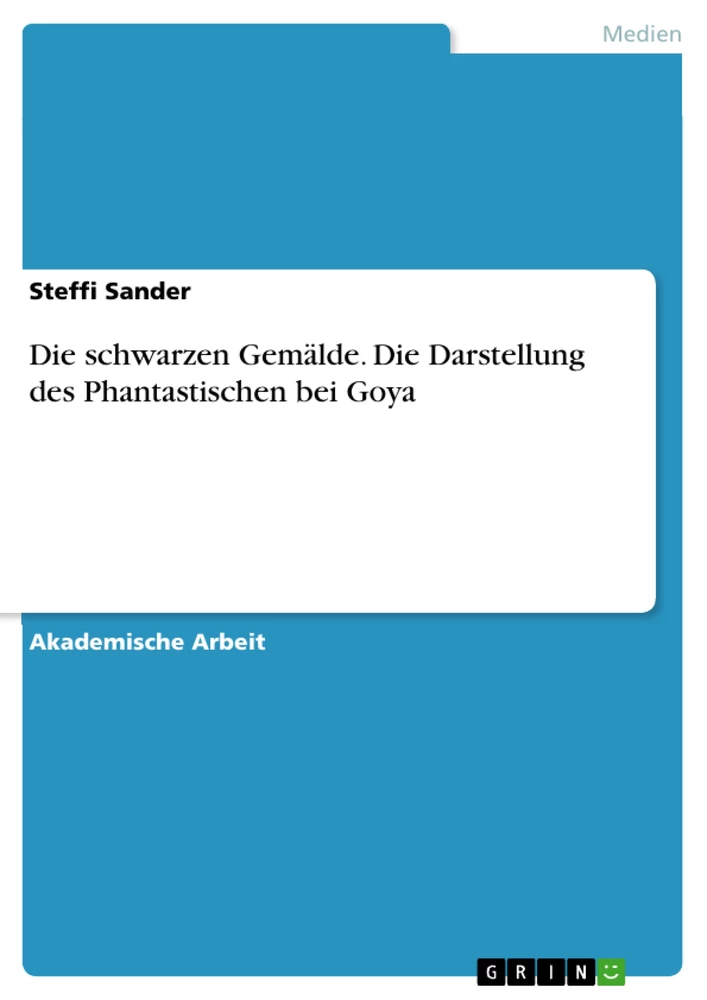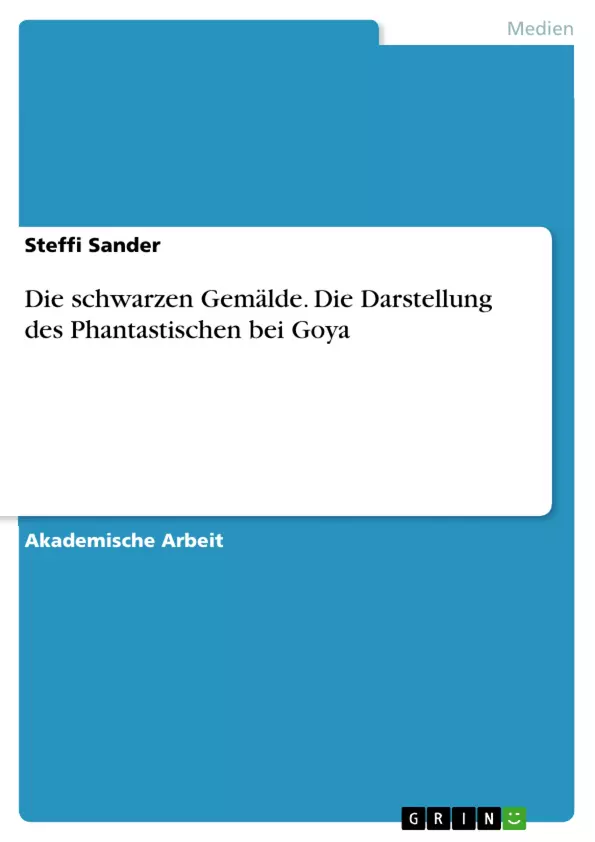Der spanische Maler Francisco de Goya (30.03.1746 – 16.04.1828) repräsentiert bis in unsere Zeit die Moderne und gilt unter Kunstexperten als Begründer des Expressionismus.
Neben zahlreichen Portraits und Zeichnungen reihen sich auch die pinturas negras, Goyas viel diskutierte schwarze Gemälde, in die Riege seiner Meisterwerke ein.
Die schwarzen Gemälde zeichnen sich durch einen extensiven Hang zum Phantastischen aus. Sie stellen Düsternis und unheimliche Szenen dar, die oftmals als Ausdruck von Krisen und Konflikten im Innenleben der Menschen, aber auch des Landes Spanien gedeutet werden. Doch die schwarzen Gemälde geben der Forschung bis heute mehr Rätsel auf, als dass sie Goyas künstlerische Motivation preisgeben. Ihre exakte Deutung ist unter Fachleuten umstritten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Forschungsstand
- 3. Vorgehen und Methode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Seminararbeit ist die Beantwortung der Forschungsfrage, ob sich Goya durch die Darstellung phantastischer Momente in seinen schwarzen Gemälden gesellschaftskritisch äußert. Die Arbeit untersucht Goyas künstlerische Entwicklung und die Interpretation seiner schwarzen Gemälde im Kontext seines Lebens und der historischen Ereignisse seiner Zeit.
- Goyas künstlerische Entwicklung und die Entstehung der schwarzen Gemälde
- Die verschiedenen Interpretationen der schwarzen Gemälde in der Kunstgeschichte
- Der sozio-politische Kontext der Entstehung der schwarzen Gemälde
- Goyas Darstellung des Phantastischen als Ausdruck gesellschaftskritischer Haltung (These)
- Analyse ausgewählter Werke: "la romería de San Isidro" und "Saturno devorando a sus hijos"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Fragestellung: Die Einleitung stellt Francisco de Goya und seine schwarzen Gemälde vor, die bis heute rätselhaft bleiben und kontrovers diskutiert werden. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Äußert sich Goya durch die Darstellung phantastischer Momente in den schwarzen Gemälden wirklich gesellschaftskritisch? Die Arbeit zielt darauf ab, diese Frage durch die Analyse von Goyas Darstellung des Phantastischen und den Wandel seiner Darstellungsweise zu beantworten. Die scheinbar verschlüsselte Kritik in den Gemälden, im Gegensatz zu seinen anderen Werken mit offen antiklerikalen Botschaften, bildet den Ausgangspunkt der Untersuchung.
2. Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Goya-Forschung zum Thema der schwarzen Gemälde seit dem 20. Jahrhundert. Es werden verschiedene Interpretationen von Kunsthistorikern vorgestellt, die von Bewunderung für die Technik bis hin zu Ablehnung der Themen reichen. Die Meinungen reichen von der Deutung als Ausdruck von Goyas zwiespältigem Charakter (Hofmaler mit antimonarchischer Haltung) bis hin zu der Interpretation als Allegorien und Ausdruck des Phantastischen. Auch feministische und liberale Ansätze in der Interpretation werden diskutiert, ebenso wie die kontroverse Theorie, die Goya nicht als den eigentlichen Schöpfer der Gemälde sieht, sondern seinen Sohn Javier. Die unterschiedlichen Perspektiven verdeutlichen die Komplexität und die anhaltende Debatte um die Bedeutung der schwarzen Gemälde.
3. Vorgehen und Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise der Seminararbeit. Es werden zwei der schwarzen Gemälde, "la romería de San Isidro" und "Saturno devorando a sus hijos", im Zusammenhang mit Goyas Darstellung des Phantastischen analysiert. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil, der die These der gesellschaftskritischen Haltung Goyas aus sozio-politischer Perspektive untersucht, und einen analytischen Teil, der die ausgewählten Gemälde im Detail betrachtet. Der historische Kontext wird beleuchtet, indem Goyas Leben und die Ereignisse wie sein Hörverlust und die napoleonische Invasion, die seine künstlerische Entwicklung beeinflusst haben, berücksichtigt werden. Die Analyse des aktuellen Forschungsstands bildet die Grundlage für die Schlussfolgerungen der Arbeit.
Schlüsselwörter
Francisco de Goya, Schwarze Gemälde, Phantastisches, Gesellschaftskritik, Expressionismus, Kunstgeschichte, Sozio-politischer Kontext, Interpretation, Forschungsstand, "la romería de San Isidro", "Saturno devorando a sus hijos".
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit über Goyas Schwarze Gemälde
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht, ob sich Francisco de Goya durch die Darstellung phantastischer Momente in seinen schwarzen Gemälden gesellschaftskritisch äußert. Sie analysiert Goyas künstlerische Entwicklung und die Interpretation seiner Werke im Kontext seines Lebens und der historischen Ereignisse seiner Zeit.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Äußert sich Goya durch die Darstellung phantastischer Momente in den schwarzen Gemälden wirklich gesellschaftskritisch?
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: 1. Einleitung und Fragestellung, 2. Forschungsstand und 3. Vorgehen und Methode.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt Francisco de Goya und seine schwarzen Gemälde vor und erläutert die Forschungsfrage. Sie betont die scheinbar verschlüsselte Kritik in den Gemälden im Gegensatz zu Goyas anderen Werken.
Was wird im Kapitel zum Forschungsstand dargestellt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Goya-Forschung zu den schwarzen Gemälden seit dem 20. Jahrhundert. Es werden verschiedene Interpretationen von Kunsthistorikern vorgestellt, von Bewunderung bis Ablehnung, einschließlich feministischer und liberaler Ansätze, sowie die kontroverse Theorie der Urheberschaft.
Wie lautet die Methode der Arbeit?
Die Arbeit analysiert zwei ausgewählte schwarze Gemälde ("la romería de San Isidro" und "Saturno devorando a sus hijos") im Zusammenhang mit Goyas Darstellung des Phantastischen. Sie kombiniert eine theoretische Untersuchung der These einer gesellschaftskritischen Haltung mit einer detaillierten Analyse der ausgewählten Werke und dem historischen Kontext (Goyas Leben, Hörverlust, napoleonische Invasion).
Welche Gemälde werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert "la romería de San Isidro" und "Saturno devorando a sus hijos".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Francisco Goya, Schwarze Gemälde, Phantastisches, Gesellschaftskritik, Expressionismus, Kunstgeschichte, Sozio-politischer Kontext, Interpretation, Forschungsstand, "la romería de San Isidro", "Saturno devorando a sus hijos".
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Ziel der Seminararbeit ist die Beantwortung der Forschungsfrage zur gesellschaftskritischen Aussage in Goyas schwarzen Gemälden durch Analyse von Goyas künstlerischer Entwicklung und der Interpretation seiner Werke im Kontext seines Lebens und der historischen Ereignisse.
- Arbeit zitieren
- Steffi Sander (Autor:in), 2016, Die schwarzen Gemälde. Die Darstellung des Phantastischen bei Goya, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414650