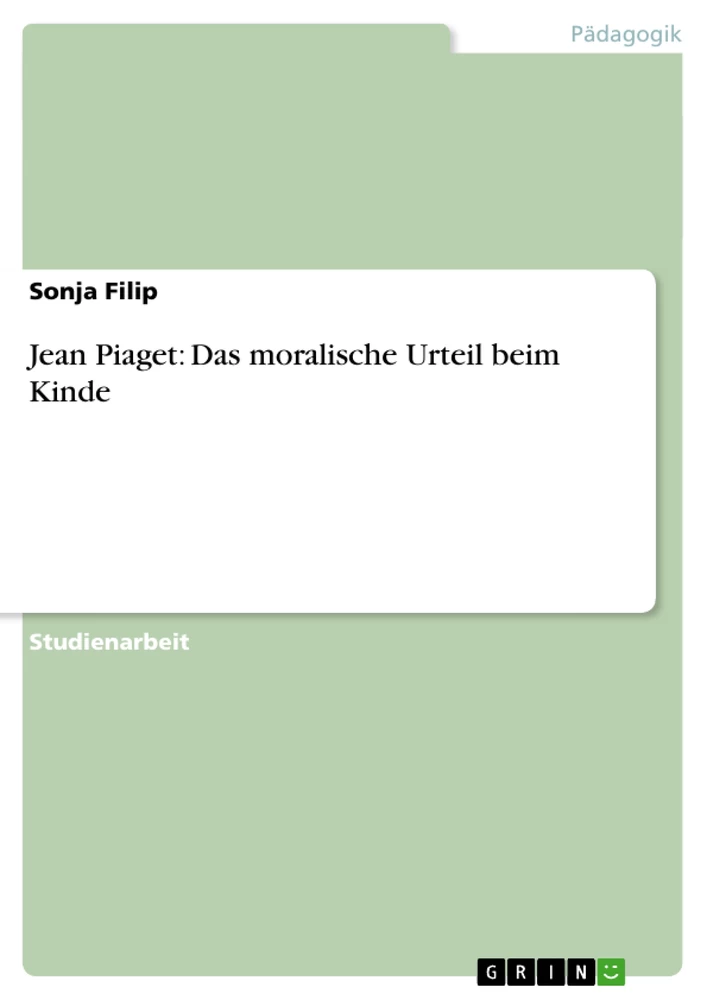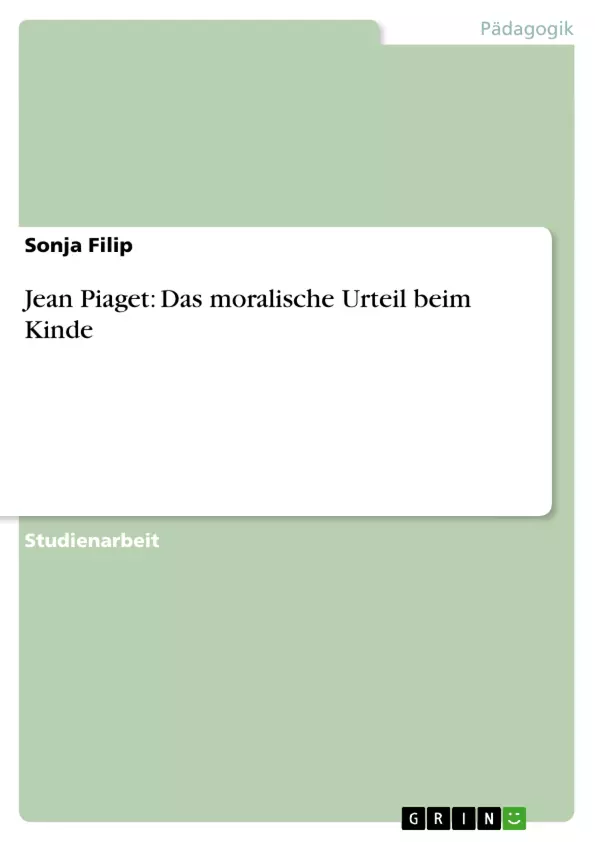Jean Piaget wurde am 9. August 1896 in Neuenburg geboren und starb am 16. September 1980 in Genf. Bereits im Alter zwischen sieben und zehn Jahren verfasste er „Abhandlungen“, z. B. über die Vogelwelt oder den Dampfmotor. Nach seiner Matura schrieb er sich an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Neuenburg ein, wo er auch zum Doktor der Naturwissenschaften promovierte. Während eines Studiensemesters in Zürich setzte er sich mit der Psychoanalyse auseinander. Danach reiste er für ein Jahr nach Paris, wo er sich im Laboratoire Alfred Binet mit Experimenten zur Logik der Kinder beschäftigte. Ab 1921 war er Oberassistent am Rousseau-Institut in Genf und machte in dieser Zeit gemeinsam mit seiner Frau an seinen drei Kindern psychologische Beobachtungen wie die Entwicklung der Intelligenz von der Geburt bis zum Spracherwerb und Experimente, deren Ergebnisse er in 3 Büchern veröffentlichte ("Das Erwachen der Intelligenz beim Kind", "Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kind", "Nachahmung, Spiel und Traum").
1925 wurde Piaget an den Lehrstuhl für Philosophie in Neuenburg gerufen, wo er auch Psychologie und Soziologie unterrichtete. 1932 wurde er zum Direktor des Rousseau-Instituts berufen und 1940 wurde er Direktor des psychologischen Laboratoriums der Universität Genf. 1955 gründete er die interdisziplinäre Forschungsstätte Centre International d'Epistémologie Génétique (Zentrum für genetische Erkenntnistheorie), die er bis zu seinem Tod leitete.
Piaget wird gerne als „interdisziplinärer Grenzgänger“ bezeichnet, da sein Lebenswerk Wurzeln sowohl in den Naturwissenschaften wie z.B. der Biologie als auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften wie der Philosophie und der Psychologie hat. Mit seinen Arbeiten in genetischer Psychologie und Erkenntnistheorie wollte Piaget eine Antwort auf die Grundfrage nach dem Aufbau der Erkenntnis geben. Seine Forschungsarbeiten um die Logik des Kindes haben deutlich werden lassen, dass diese sich progressiv nach eigenen Gesetzen aufbaut und dass sie sich dann im Laufe des Lebens, charakteristischen Etappen folgend bis zum Erwachsenenstadium hin weiterentwickelt. Der wesentlichste erkenntnistheoretische Beitrag Piagets war, nachgewiesen zu haben, dass das Kind spezifische, wissenschaftliche Denkformen entwickelt, die sich von denen des Erwachsenen gänzlich unterscheiden Das Werk Piagets hat eine weltweite Verbreitung erfahren und ist mit zahlreichen Preisen geehrt worden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Zur Person Piagets
- 2. zu Piaget: Die moralische Regel beim Kind
- 2.1. Vorbemerkungen zur Methode
- 2.1.1.
- 2.1.2.
- 2.1.3. Ein Einwand gegen die psychologische Methode Bovets
- 2.2. Die Frage nach Bildung eines autonomen Bewusstseins
- 2.2.1. Die beiden Formen der Achtung – untersucht anhand von Spielregeln
- 2.2.2. Zwang und moralischer Realismus
- 2.2.3. Zwang und moralische Autonomie
- 2.2.3.1 Untersuchung des Begriffs der Gerechtigkeit
- 2.3. Zusammenfassung
- 2.1. Vorbemerkungen zur Methode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Kurzreferat untersucht Jean Piagets Theorie der moralischen Entwicklung beim Kind. Ziel ist es, Piagets Methode und seine zentralen Thesen zur Entstehung moralischen Empfindens, des Gerechtigkeitssinns und des Respekts vor objektiver Wahrheit darzustellen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des moralischen Bewusstseins vom heteronomen zum autonomen Stadium.
- Entwicklung des moralischen Urteils beim Kind
- Die Rolle von Heteronomie und Autonomie in der Moralentwicklung
- Der Einfluss von Spielregeln auf die Entwicklung des moralischen Bewusstseins
- Die Konzepte des moralischen Realismus und der objektiven versus subjektiven Verantwortung
- Der Übergang vom egozentrischen Denken zum Verständnis von Kooperation und gegenseitiger Achtung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zur Person Piagets: Dieser Abschnitt bietet eine biografische Skizze von Jean Piaget, hebt seine interdisziplinäre Arbeitsweise hervor und beschreibt seinen Werdegang von frühen wissenschaftlichen Interessen bis zur Gründung des Centre International d'Epistemologie Génétique. Piagets Fokus auf die genetische Erkenntnistheorie und seine wegweisenden Forschungen zur kindlichen Logik werden als Grundlage seiner Theorie der moralischen Entwicklung herausgestellt. Seine Arbeiten werden als bahnbrechend für die Psychologie und Erkenntnistheorie beschrieben, mit weltweiter Verbreitung und Anerkennung.
2. zu Piaget: Die moralische Regel beim Kind: Dieser zentrale Abschnitt präsentiert Piagets These zur Entwicklung des moralischen Bewusstseins. Er kritisiert die reduktionistischen Ansätze früherer Psychologen und betont die Notwendigkeit einer psychologischen Untersuchung der Moralentwicklung. Piaget analysiert den Einfluss sozialer Interaktionen, insbesondere von Spielregeln, auf die Entwicklung von moralischem Denken. Es wird die Entwicklung von der einseitigen Achtung (Heteronomie) zur gegenseitigen Achtung (Autonomie) beschrieben und die Bedeutung von Kooperation und dem Verständnis von Regeln als verhandelbar hervorgehoben.
2.1. Vorbemerkungen zur Methode: Dieser Abschnitt erläutert die methodischen Ansätze Piagets, insbesondere im Vergleich zu anderen Psychologen wie Baldwin und Bovet. Kritisch setzt er sich mit der Sichtweise des Kindes als "kleiner Erwachsener" auseinander und betont die Notwendigkeit einer kindgerechten Methode. Ein wichtiger Punkt ist die Auseinandersetzung mit dem scheinbaren Widerspruch zwischen individueller und sozialer Prägung von Moralvorstellungen, der letztlich als kein wirklicher Widerspruch aufgelöst wird.
2.2. Die Frage nach Bildung eines autonomen Bewusstseins: Dieser Teil befasst sich mit der zentralen Frage, wie das kindliche Bewusstsein von der Heteronomie (der Akzeptanz von Regeln aufgrund von Autorität) zur Autonomie (der selbstbestimmten Moral) gelangt. Piaget analysiert dies anhand der Entwicklung der Achtung vor Regeln im Spiel. Die Unterscheidung zwischen einseitiger und gegenseitiger Achtung wird ausführlich erörtert, ebenso die Entwicklung des Verständnisses von Regeln als veränderbar und verhandelbar. Das Kapitel demonstriert, wie die zunehmende Fähigkeit zur Kooperation und zum Perspektivwechsel mit der Entwicklung der moralischen Autonomie einhergeht.
2.2.2. Zwang und moralischer Realismus: Dieser Unterabschnitt beleuchtet Piagets Konzept des moralischen Realismus, das beschreibt, wie Kinder Regeln zunächst als absolute und unveränderliche Gebote betrachten, die unabhängig von den Intentionen der handelnden Personen gelten. Der Fokus liegt auf dem Konzept der "objektiven Verantwortung", wo die Handlung selbst, unabhängig von der Absicht, als gut oder schlecht bewertet wird. Im Gegensatz dazu steht die Entwicklung der "subjektiven Verantwortung", bei der die Intention des Handelnden eine entscheidende Rolle spielt.
Häufig gestellte Fragen zu "Die moralische Regel beim Kind" von Jean Piaget
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text ist ein umfassendes Kurzreferat zu Jean Piagets Theorie der moralischen Entwicklung beim Kind. Er behandelt Piagets Methode, zentrale Thesen zur Entstehung moralischen Empfindens, des Gerechtigkeitssinns und des Respekts vor objektiver Wahrheit und konzentriert sich auf die Entwicklung des moralischen Bewusstseins vom heteronomen zum autonomen Stadium.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in zwei Hauptkapitel: "1. Zur Person Piagets" und "2. zu Piaget: Die moralische Regel beim Kind". Das zweite Kapitel ist weiter unterteilt in Unterkapitel zu Piagets Methode, der Entwicklung des autonomen Bewusstseins, Zwang und moralischem Realismus und einer Zusammenfassung.
Was wird im Kapitel "Zur Person Piagets" behandelt?
Dieses Kapitel bietet eine biografische Skizze von Jean Piaget, beschreibt seinen Werdegang und hebt seine interdisziplinäre Arbeitsweise und seinen Fokus auf die genetische Erkenntnistheorie hervor. Es stellt seine wegweisenden Forschungen zur kindlichen Logik als Grundlage seiner Theorie der moralischen Entwicklung dar und würdigt seine weltweite Anerkennung.
Worüber handelt das Kapitel "Die moralische Regel beim Kind"?
Das Hauptkapitel präsentiert Piagets These zur Entwicklung des moralischen Bewusstseins. Es kritisiert reduktionistische Ansätze früherer Psychologen und betont die Notwendigkeit einer psychologischen Untersuchung der Moralentwicklung. Piaget analysiert den Einfluss sozialer Interaktionen, insbesondere von Spielregeln, auf die Entwicklung moralischen Denkens und beschreibt die Entwicklung von der einseitigen Achtung (Heteronomie) zur gegenseitigen Achtung (Autonomie).
Welche methodischen Ansätze werden im Text erläutert?
Der Text erläutert Piagets methodische Ansätze im Vergleich zu anderen Psychologen. Er kritisiert die Sichtweise des Kindes als "kleiner Erwachsener" und betont die Notwendigkeit einer kindgerechten Methode. Ein wichtiger Punkt ist die Auseinandersetzung mit dem scheinbaren Widerspruch zwischen individueller und sozialer Prägung von Moralvorstellungen.
Wie beschreibt Piaget die Entwicklung des autonomen Bewusstseins?
Der Text beschreibt die Entwicklung des autonomen Bewusstseins anhand der Entwicklung der Achtung vor Regeln im Spiel. Die Unterscheidung zwischen einseitiger und gegenseitiger Achtung wird ausführlich erörtert, ebenso die Entwicklung des Verständnisses von Regeln als veränderbar und verhandelbar. Die zunehmende Fähigkeit zur Kooperation und zum Perspektivwechsel wird als entscheidend für die Entwicklung der moralischen Autonomie dargestellt.
Was ist der "moralische Realismus" nach Piaget?
Der "moralische Realismus" beschreibt, wie Kinder Regeln zunächst als absolute und unveränderliche Gebote betrachten, die unabhängig von den Intentionen der handelnden Personen gelten. Der Fokus liegt auf der "objektiven Verantwortung", wo die Handlung selbst, unabhängig von der Absicht, als gut oder schlecht bewertet wird. Im Gegensatz dazu steht die Entwicklung der "subjektiven Verantwortung", bei der die Intention des Handelnden eine entscheidende Rolle spielt.
Welche zentralen Themen werden im Text behandelt?
Zentrale Themen sind die Entwicklung des moralischen Urteils beim Kind, die Rolle von Heteronomie und Autonomie in der Moralentwicklung, der Einfluss von Spielregeln auf die Entwicklung des moralischen Bewusstseins, die Konzepte des moralischen Realismus und der objektiven versus subjektiven Verantwortung sowie der Übergang vom egozentrischen Denken zum Verständnis von Kooperation und gegenseitiger Achtung.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text ist ein Kurzreferat und eignet sich für Personen, die sich einen schnellen Überblick über Piagets Theorie der moralischen Entwicklung verschaffen möchten. Er ist insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse von Themen im Bereich der Entwicklungspsychologie nützlich.
- Citation du texte
- Sonja Filip (Auteur), 2005, Jean Piaget: Das moralische Urteil beim Kinde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41515