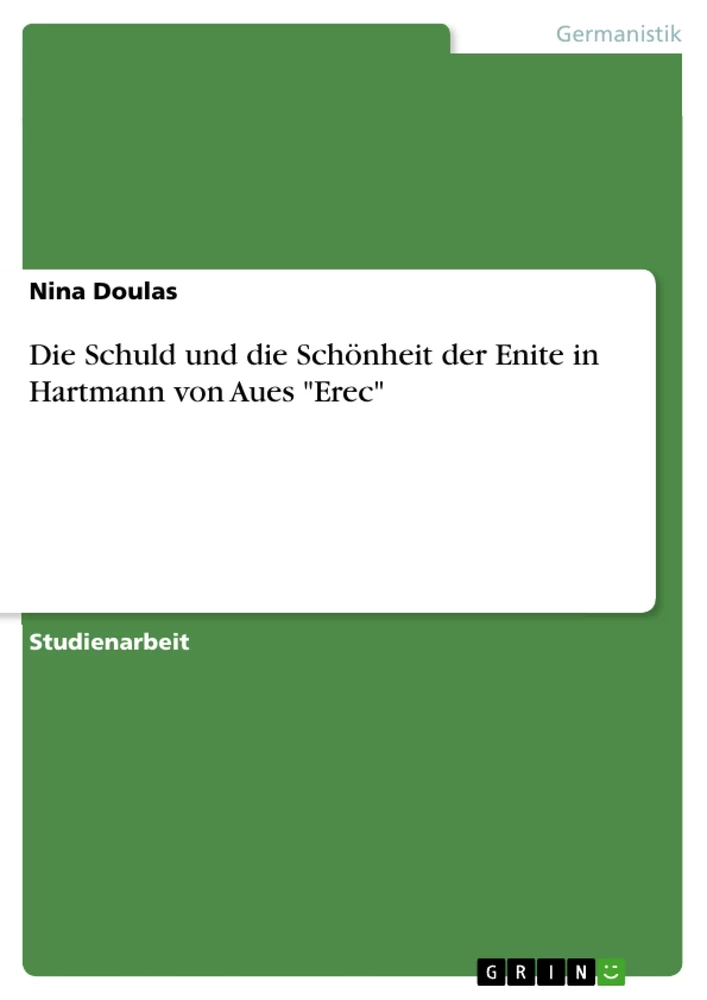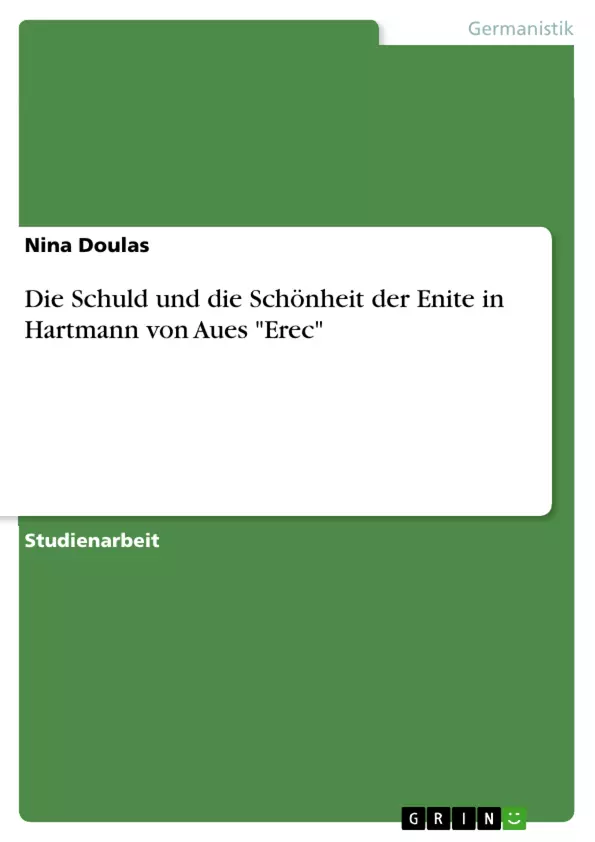Diese Hausarbeit soll die These beleuchtet, ob eine mögliche Schuld und Strafe Enites in ihrer sie als festes Attribut durch die Erzählung begleitenden Schönheit begründet sein könnte. Nicht völlig unerwähnt bleiben, aber wegen der gebotenen Kürze der Arbeit knapp gehalten sollen hierbei einige der Änderungen, die Hartmann in den ausgewählten Textstellen gegenüber der französischen Vorlage vornahm.
Die literarische Gattung des arthurischen Versromans fand nach gängiger Datierung um 1170 ihren Anfang – mit dem ältesten uns überlieferten Artusroman in romanischer Sprache: Chrétien de Troyes‘ Erec et Enide. Diese Dichtung wird in der Forschung zumeist als Hauptquelle für den ältesten überlieferten Artusroman in deutscher Sprache betrachtet: Hartmann von Aues Erec.
Chrétien führte mit seinem ersten Roman ein Novum ein: Galt sonst das Werben als Handlungsmotiv und die Eheschließung als erfolgreiches Ende einer Geschichte, findet hier die Vermählung schon früh statt, woraufhin die eigentliche âventiure erst beginnt. Das Herrscherpaar stürzt in eine Krise und muss sich die verlorene Ehre mühsam wiederverdienen, wobei auch die Verbindung der Liebenden auf dem Prüfstand steht. Dass eine Frau den Ritter auf seinen Abenteuern begleitet, sollte aber eine einmalige Ausnahme bleiben – in keinem anderen Artusroman ist diese Situation zu finden. Nicht mal Chrétien selbst wiederholte sie in seinen drei späteren Werken.
Zum Ehrverlust gibt es in der Forschung immer wieder Diskussionen, ob – und falls ja – womit Enite beim verligen Schuld auf sich lud, die ihre spätere Sanktion durch Erec mit niederen Diensten und dem Redeverbot nach sich ziehen konnte. Peter Wapnewski nennt dies missbilligend den „Zwang des Syllogismus“. Dem gegenüber steht Thomas Cramer, der eine eindeutige Schuld Enites in ihrem unverdienten sozialen Aufstieg zu sehen meint. Die Begleitung einer Dame bei einer Aventiurefahrt ist zumindest ein zu augenfälliges Element, um nicht nach denkbaren Gründen zu forschen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das höfische Schönheitsideal
- Enites Schönheit
- Erste Begegnung
- Der Sperberkampf
- Der Artushof
- Der Ritt zum Artushof
- Am Artushof
- Die Hochzeit
- Enites Schuld
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Motiv der Schuld und Schönheit der Figur Enite im Erec Hartmanns von Aue. Sie untersucht, ob Enites Schönheit als Grund für ihre mögliche Schuld und Strafe in der Erzählung interpretiert werden kann.
- Das höfische Schönheitsideal im Mittelalter
- Die Darstellung von Enites Schönheit im Erec
- Die Frage nach Enites Schuld und ihrer möglichen Verbindung zu ihrer Schönheit
- Hartmanns Bearbeitung der französischen Vorlage Chrétiens de Troyes
- Die Rolle von Enite als Begleiterin Erecs auf seinen Abenteuern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Artusromans und die Rolle von Enite in Hartmanns Erec ein. Sie beleuchtet die Debatte in der Forschung über Enites Schuld und die Frage, ob sie für ihre spätere Bestrafung durch Erec verantwortlich ist. Kapitel 2 untersucht das höfische Schönheitsideal im Mittelalter und die Bedeutung von Schönheit als Ausdruck innerer Tugendhaftigkeit.
Kapitel 3 widmet sich Enites Schönheit und analysiert ihre Darstellung in der Erzählung, insbesondere bei der ersten Begegnung mit Erec und während ihres Aufenthalts am Artushof. Die Analyse der Textstellen verdeutlicht, wie Hartmann die Schönheit Enites als ein zentrales Merkmal ihrer Persönlichkeit und ihrer Beziehung zu Erec darstellt.
Schlüsselwörter
Artusroman, Hartmann von Aue, Erec, Enite, Schönheit, höfisches Schönheitsideal, Schuld, Strafe, Aventiure, Minnegemeinschaft, Ehre, Ritterlichkeit, höfische Kultur, mittelalterliche Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im "Erec" von Hartmann von Aue?
Es ist der erste deutsche Artusroman und thematisiert den Ehrverlust des Ritterpaares Erec und Enite sowie deren gemeinsame Aventiure zur Wiedererlangung der Ehre.
Welche Rolle spielt Enites Schönheit in der Erzählung?
Ihre Schönheit ist ein festes Attribut, das oft als Ausdruck ihrer inneren Tugend gewertet wird, aber auch in Verbindung mit der Krise des Paares diskutiert wird.
Wird Enite eine Mitschuld am "verligen" Erecs zugeschrieben?
In der Forschung ist umstritten, ob Enite durch ihr Schweigen oder ihre Schönheit eine Mitschuld am Ehrverlust trägt, was Erec zu Sanktionen wie dem Redeverbot veranlasst.
Was bedeutet das "höfische Schönheitsideal"?
Es beschreibt die mittelalterliche Vorstellung, dass äußere Makellosigkeit ein Zeichen für hohen sozialen Status und moralische Reinheit ist.
Wie unterscheidet sich Hartmanns Erec von der Vorlage Chrétiens de Troyes?
Hartmann nahm spezifische Änderungen in der Charakterzeichnung und Symbolik vor, um das Werk an das deutsche höfische Publikum anzupassen.
- Arbeit zitieren
- Nina Doulas (Autor:in), 2017, Die Schuld und die Schönheit der Enite in Hartmann von Aues "Erec", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/415224