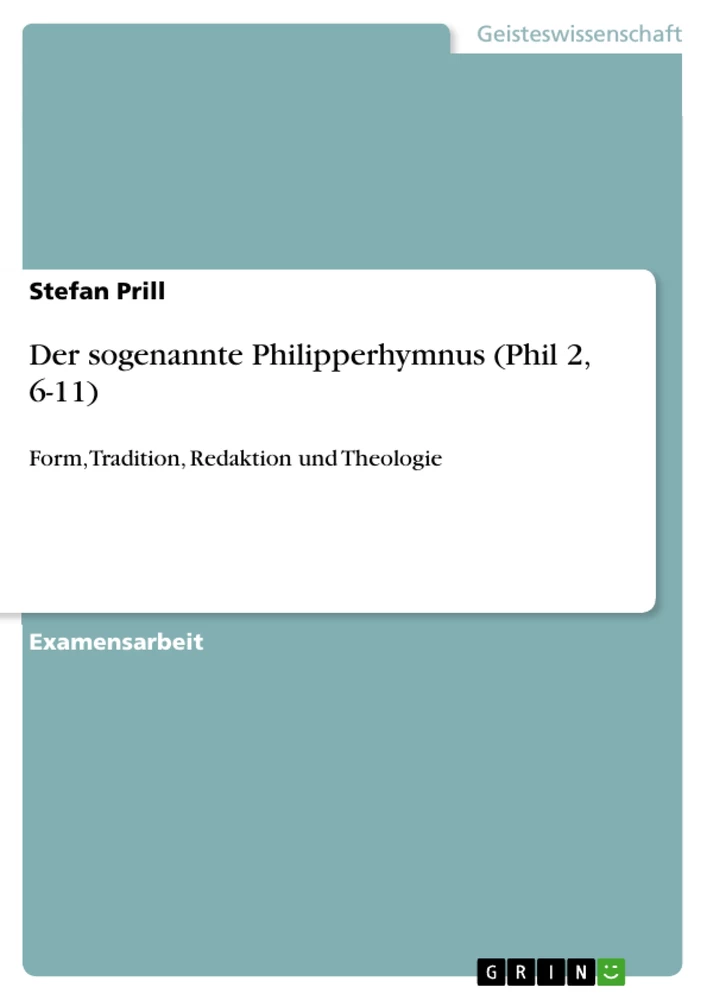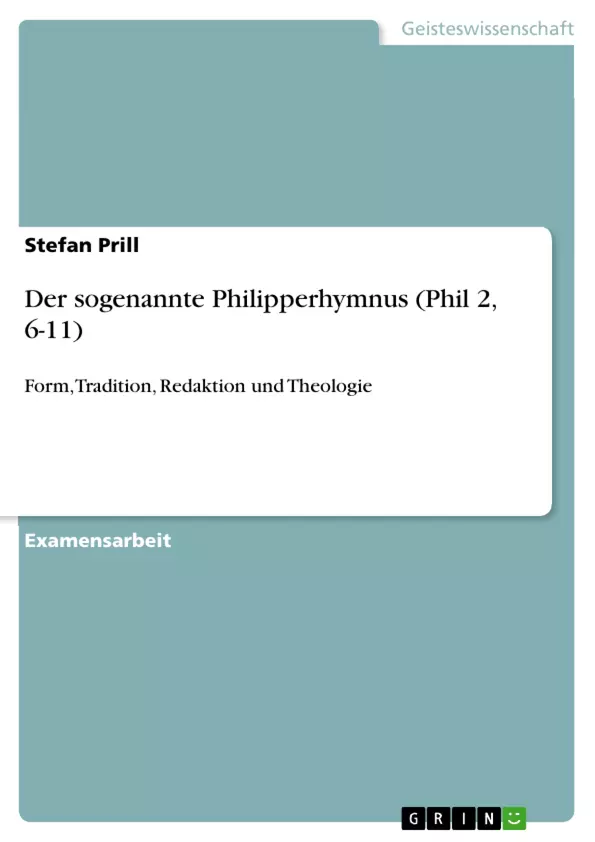Bei dem sog. Philipperhymnus „handelt es sich um den meistkommentierten Abschnitt des Philipperbriefs und einen der meistkommentierten des Neuen Testaments.“ Kaum an einen anderen Text des Neuen Testaments sind so viele unterschiedliche Deutungen herangetragen worden, wie an den Christustext in Phil 2. Kaum ein anderer neutestamentlicher Text hat eine so schillernde Wirkungsgeschichte erfahren, wie der sog Christushymnus im Rahmen der christologischen Auseinandersetzungen der Alten Kirche. Auch gegenwärtig lässt sich in der Forschung kein Konsens bzgl. der Form, Tradition, Redaktion und Theologie des sogenannten Philipperhymnus herstellen. Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, sich dem „locus classicus paulinischer Christologie im Philipperbrief“ aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern. Dazu soll der Christustext zunächst auf synchroner Ebene untersucht werden. Aus rezeptionshermeneutischer Sicht ist der Text allerdings zunächst ein Teil des paulinischen Schreibens an die christliche Gemeinde in Philippi und soll als solcher auch gewürdigt werden. Der erste Hauptteil dieser Arbeit untersucht daher zunächst das Philipperschreiben in seiner Gesamtheit und versucht aus der Perspektive des Briefes erste Rückschlüsse auf die Funktion des Christustextes innerhalb seines Kontextes zu ziehen. Im zweiten Hauptteil der Arbeit soll dann die Perspektive gewechselt werden und der Christustext selbst zu Gehör kommen. Dabei sollen synchrone Zugangswege zum Text genauso Berücksichtigung finden wie diachrone Betrachtungsweisen. Der letzte Hauptteil der Arbeit ist dann dem theologischen Gehalt des Christustextes gewidmet und versucht die exegetischen Beobachtungen zu Phil 2,6-11 unter theologischen, christologischen, soteriologischen, eschatologischen und ethischen Gesichtspunkten zu systematisieren und zu diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die christliche Gemeinde in Philippi
- 3. Der Philipperbrief
- 3.1. Abfassungsort und -zeit des Briefes
- 3.2. Die literarische Integrität des Briefes
- 3.3. Aufbau und Inhalt
- 3.4. Gute und schlechte Vorbilder im Philipperbrief
- 3.5. Die Schlüsselstellen Phil 2,6-11 und Phil 3,17-21
- 3.6. Zwischenfazit
- 4. Exegetische Beobachtungen zu Phil 2,6-11
- 4.1. Eigene Übersetzung
- 4.2. Syntaktische Analyse
- 4.2.1. Syntax, Sprache und Stil
- 4.2.2. Gliederung
- 4.3. Semantische Analyse und Gedankengang
- 4.3.1. Die Selbsterniedrigung Jesu Christi (Phil 2,6-8)
- 4.3.2. Die Erhöhung des Gekreuzigten (Phil 2,9-11)
- 4.4. Formbestimmung und Verfasserschaft
- 4.5. Traditionsgeschichte
- 4.5.1. Alttestamentlich-jüdische Traditionen
- 4.5.2. Römisch-hellenistische Einflüsse
- 5. Der theologische Gehalt des Christustextes
- 5.1. Herr ist Jesus Christus
- 5.2. Die Königsherrschaft Christi
- 5.3. Ethische Implikationen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den sogenannten Philipperhymnus (Phil 2,6-11) aus verschiedenen Perspektiven, um einen umfassenden Überblick über seine Form, Tradition, Redaktion und Theologie zu gewinnen. Es wird sowohl eine synchrone als auch diachrone Analyse durchgeführt.
- Untersuchung des Philipperbriefs im Kontext der Gemeinde in Philippi
- Exegetische Analyse des Philipperhymnus (Phil 2,6-11)
- Erforschung der literarischen Traditionen des Hymnus
- Theologische Interpretation des Christustextes
- Ausarbeitung der ethischen Implikationen des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Philipperhymnus als einen der meistkommentierten Abschnitte des Neuen Testaments vor und betont den Mangel an Konsens in der Forschung bezüglich seiner Form, Tradition, Redaktion und Theologie. Die Arbeit verfolgt das Ziel, den Text aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, zunächst im Kontext des Philipperbriefs und anschließend durch eine eingehende exegetische Analyse. Der letzte Teil widmet sich dem theologischen Gehalt des Textes.
2. Die christliche Gemeinde in Philippi: Dieses Kapitel beleuchtet die historische und soziale Situation der christlichen Gemeinde in Philippi im 1. Jahrhundert n. Chr. Es beschreibt die Stadt Philippi, ihre Geschichte als römische Kolonie und ihre multikulturelle Bevölkerung, inklusive der möglichen Anwesenheit einer jüdischen Gemeinde. Der Fokus liegt auf den Beziehungen zwischen Paulus und der Gemeinde, deren finanzielle Unterstützung für Paulus und den innergemeindlichen Austausch über Mitarbeiter wie Timotheus und Epaphroditus. Die heidenchristliche Mehrheit der Gemeinde wird hervorgehoben, wobei auch auf eine mögliche judenchristliche Minderheit hingewiesen wird. Dies legt den Grundstein für das Verständnis des Kontextes, in dem der Philipperbrief und somit auch der Hymnus entstanden sind.
3. Der Philipperbrief: Dieses Kapitel behandelt den Philipperbrief selbst, einschliesslich seiner Echtheit, seines Adressatenkreises und seines Aufbaus. Es wird diskutiert, warum Paulus auf seinen Aposteltitel verzichtet und sich als "Knecht Christi Jesu" bezeichnet. Das Kapitel verweist auf die guten Beziehungen zwischen Paulus und der Gemeinde in Philippi und deutet an, wie der Hymnus in den Gesamtkontext des Briefes einzuordnen ist. Es wird kurz auf die Thematik guter und schlechter Vorbilder sowie die Schlüsselstellen Phil 2,6-11 und Phil 3,17-21 eingegangen.
Schlüsselwörter
Philipperhymnus (Phil 2,6-11), Paulinische Christologie, Philipperbrief, Gemeinde Philippi, Exegese, Hermeneutik, Tradition, Redaktion, Theologie, Selbsterniedrigung, Erhöhung, Christologie, Soteriologie, Eschatologie, Ethik.
Häufig gestellte Fragen zum Philipperbrief und dem Philipperhymnus (Phil 2,6-11)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Philipperhymnus (Phil 2,6-11) umfassend. Sie untersucht seine Form, Tradition, Redaktion und Theologie aus verschiedenen Perspektiven, sowohl synchron als auch diachron.
Welche Aspekte des Philipperbriefs werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Philipperbrief im Kontext der Gemeinde in Philippi, die exegetische Analyse des Philipperhymnus, die literarischen Traditionen des Hymnus, die theologische Interpretation des Christustextes und die ethischen Implikationen des Textes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, die christliche Gemeinde in Philippi, der Philipperbrief (inklusive Abfassungsort, -zeit, Aufbau und Inhalt, sowie gute und schlechte Vorbilder), eine detaillierte exegetische Beobachtung zu Phil 2,6-11 (inkl. Übersetzung, syntaktischer und semantischer Analyse, Formbestimmung, Traditionsgeschichte), der theologische Gehalt des Christustextes (Herrschaft Christi, ethische Implikationen) und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine umfassende Zusammenfassung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet sowohl synchrone als auch diachrone Analysemethoden. Die exegetische Analyse beinhaltet eine eigene Übersetzung, syntaktische und semantische Analysen sowie die Untersuchung der Traditionsgeschichte (alttestamentlich-jüdische Traditionen und römisch-hellenistische Einflüsse).
Welche Schlüsselstellen werden besonders untersucht?
Die Schlüsselstellen Phil 2,6-11 und Phil 3,17-21 stehen im Mittelpunkt der Analyse. Besonderes Augenmerk liegt auf Phil 2,6-11 (Philipperhymnus), der aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird.
Welche theologischen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie die paulinische Christologie, die Selbsterniedrigung und Erhöhung Jesu Christi, die Königsherrschaft Christi und die ethischen Implikationen des Philipperhymnus. Soteriologische und eschatologische Aspekte werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Informationen zur Gemeinde in Philippi werden gegeben?
Die Arbeit beschreibt die historische und soziale Situation der Gemeinde in Philippi im 1. Jahrhundert n. Chr., einschließlich der Stadtgeschichte, der multikulturellen Bevölkerung, der Beziehungen zwischen Paulus und der Gemeinde und der finanziellen Unterstützung der Gemeinde für Paulus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Philipperhymnus (Phil 2,6-11), Paulinische Christologie, Philipperbrief, Gemeinde Philippi, Exegese, Hermeneutik, Tradition, Redaktion, Theologie, Selbsterniedrigung, Erhöhung, Christologie, Soteriologie, Eschatologie, Ethik.
- Citar trabajo
- Stefan Prill (Autor), 2017, Der sogenannte Philipperhymnus (Phil 2, 6-11), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/415717