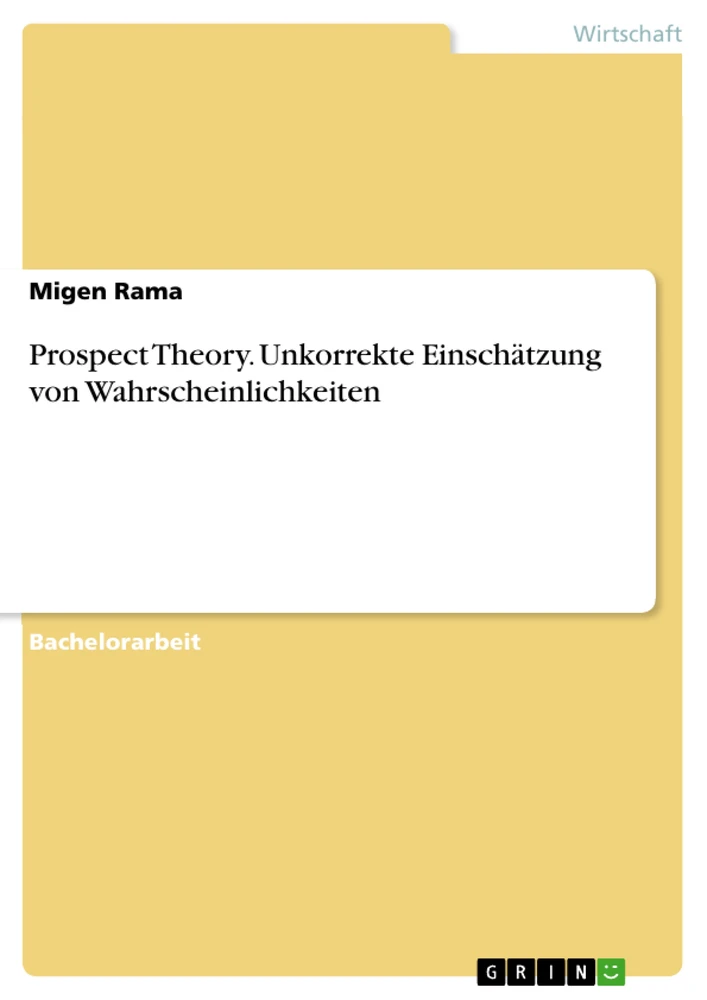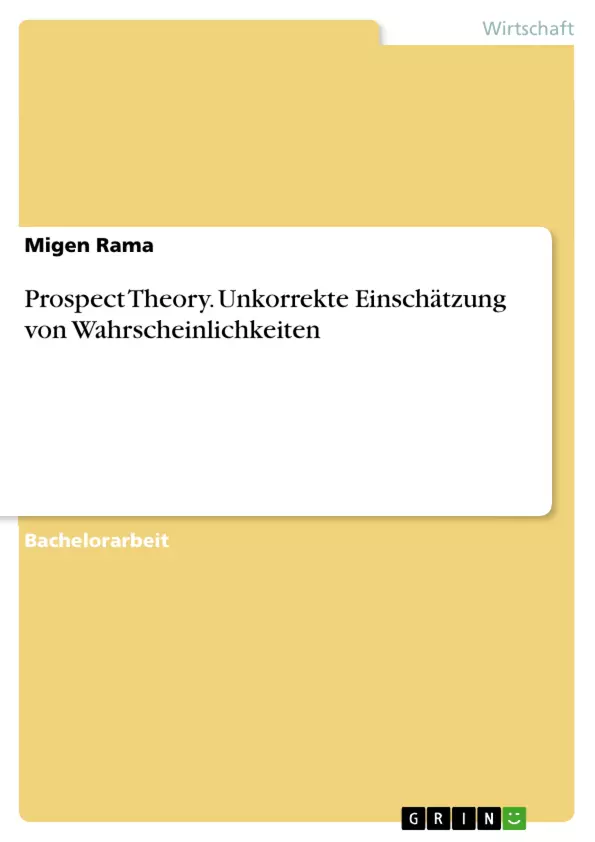Wir treffen täglich Entscheidungen, seien es triviale Entscheidungen wie das Einkaufen von Lebensmitteln oder lebensverändernde Entscheidungen wie den Lebenspartner oder Beruf auszusuchen. Die Schwierigkeit Entscheidungen zu treffen liegt nicht an den vielzähligen möglichen Alternativen, sondern an der Unsicherheit der zukünftigen Folgen der gewählten Handlungsalternative.
Die zukünftigen Folgen sind im Vorfeld nicht bestimmbar, da man zum Beispiel nicht weiß, ob man ein Gerichtsverfahren gewinnt oder ob ein Produkt den Markt erobern wird. Ist die Entscheidung die man treffen muss komplex und mit einer großen Anzahl von Alternativen mit großen Unsicherheiten verbunden, so gewinnen Verfahren, die eine systematische Entscheidungsfindung besitzen an Bedeutung.
Es gibt zwei Theorien die Entscheidungsträgern die Auswahlmöglichkeit erleichtern sollen, die präskriptive und deskriptive Entscheidungstheorie. In dieser wissenschaftlichen Arbeit beziehen wir uns hauptsächlich auf die deskriptive Entscheidungstheorie. In der deskriptiven Entscheidungstheorie ist der von Daniel Kahneman und Amos Tversky veröffentlichte Artikel "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk" vertreten.
In diesem Artikel wurde aufgezeigt, dass die Erwartungsnutzentheorie von den tatsächlichen Entscheidungen abweicht. Diese Abweichungen oder auch Verzerrungen werden Bias genannt und beeinflussen die Entscheidungsträger. In den folgenden Kapiteln werden diese Bias aufgezählt und es werden Maßnahmen erläutert wie man diese Verzerrungen im Controlling mildern kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erwartungsnutzentheorie
- 2.1 Grundlagen der Erwartungsnutzentheorie
- 2.2 Axiom 1: Unabhängigkeit
- 2.3 Axiom 2: Dominanz
- 2.4 Axiom 3: Invarianz
- 2.5 Kritik an der Erwartungsnutzentheorie
- 3. Prospect Theory - PT (1979)
- 3.1 Grundlagen der Prospect Theory
- 3.2 Editierungsphase
- 3.2.1 Coding
- 3.2.2 Combination
- 3.2.3 Segregation
- 3.2.4 Cancellation
- 3.2.5 Simplification
- 3.2.6 Detection Of Dominance
- 3.3 Evaluationsphase
- 3.3.1 Nutzenfunktion
- 3.3.2 Wertefunktion
- 3.3.3 Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion
- 3.4 Kritik an der Prospect Theory (1979)
- 4. Cumulative Prospect Theory (CPT)
- 4.1 Grundlagen der Cumulative Prospect Theory
- 4.2 Verlauf der Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion
- 4.3 Kritik an der Cumulative Prospect Theory
- 5. Der Referenzpunkteffekt als Ursache für Cognitive Bias
- 5.1 Verlustaversion
- 5.2 Endowment-Effekt
- 5.3 Status Quo-Bias
- 5.4 Anchoring-Effekt
- 5.5 Abnehmende Sensitivität
- 6. Maßnahmen im Controlling gegen Cognitive Bias
- 6.1 Milderung der Verlustaversion
- 6.2 Milderung des Endowment-Effektes
- 6.3 Milderung des Status Quo-Bias
- 6.4 Milderung des Anchoring-Effektes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Darstellung von Entscheidungsfindungsprozessen anhand der Prospect Theory und der Cumulative Prospect Theory. Die Arbeit untersucht, wie kognitive Verzerrungen (Bias) Entscheidungen beeinflussen und welche Gegenmaßnahmen im Controlling eingesetzt werden können, um diese zu mildern.
- Die Erwartungsnutzentheorie und ihre Grenzen
- Die Prospect Theory und ihre zentralen Elemente (Editierungs- und Evaluationsphase)
- Die Cumulative Prospect Theory als Erweiterung der Prospect Theory
- Der Referenzpunkteffekt und verschiedene kognitive Bias
- Maßnahmen zur Milderung kognitiver Bias im Controlling
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit ein und hebt die Bedeutung deskriptiver Entscheidungstheorien hervor, insbesondere der Prospect Theory von Kahneman und Tversky. Sie beschreibt die Zielsetzung der Arbeit – die Erläuterung von Entscheidungsfindungsprozessen mithilfe der Prospect Theory und der Cumulative Prospect Theory, inklusive der Analyse kognitiver Bias und deren Milderung im Controlling – und skizziert die Struktur der Arbeit.
2. Erwartungsnutzentheorie: Dieses Kapitel präsentiert die Erwartungsnutzentheorie als Grundlage für die Analyse von Entscheidungen unter Risiko. Es erläutert die drei Axiome (Unabhängigkeit, Dominanz, Invarianz) und beleuchtet kritische Punkte der Theorie, die zu Abweichungen vom rationalen Entscheidungsverhalten führen. Die Schwächen der Erwartungsnutzentheorie bilden die Grundlage für die Einführung der Prospect Theory.
3. Prospect Theory (1979): Dieses Kapitel beschreibt die ursprüngliche Prospect Theory von Kahneman und Tversky. Der Schwerpunkt liegt auf den zwei zentralen Phasen: der Editierungsphase (mit ihren Subprozessen wie Coding, Combination, Segregation, Cancellation und Simplification) und der Evaluationsphase (mit der Nutzenfunktion und der Wertefunktion). Die Kritikpunkte an der ursprünglichen Prospect Theory werden ebenfalls diskutiert, die den Weg für die Cumulative Prospect Theory ebnen.
4. Cumulative Prospect Theory (CPT): Das Kapitel stellt die Cumulative Prospect Theory als Weiterentwicklung der ursprünglichen Prospect Theory vor. Es konzentriert sich auf die Funktionsweise der CPT und insbesondere auf den Verlauf der Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion. Die Kritikpunkte an der CPT werden ebenfalls beleuchtet und in Bezug zu den Stärken und Schwächen der ursprünglichen Prospect Theory gesetzt.
5. Der Referenzpunkteffekt als Ursache für Cognitive Bias: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Referenzpunkteffekt als Ursache für verschiedene kognitive Bias. Es werden fünf spezifische Bias (Verlustaversion, Endowment-Effekt, Status Quo-Bias, Anchoring-Effekt und abnehmende Sensitivität) im Detail erläutert und ihr Zusammenhang mit dem Referenzpunkteffekt hergestellt. Die Beispiele illustrieren, wie diese Bias zu systematischen Fehlern in der Entscheidungsfindung führen können.
6. Maßnahmen im Controlling gegen Cognitive Bias: Dieses Kapitel befasst sich mit praktischen Maßnahmen im Controlling, um die im vorherigen Kapitel beschriebenen kognitiven Bias zu mildern. Für jeden Bias werden spezifische Strategien und Methoden vorgestellt, um deren negative Auswirkungen auf Entscheidungen zu reduzieren. Das Kapitel bietet praktische Handlungsempfehlungen für die Entscheidungsfindung im Controllingkontext.
Schlüsselwörter
Prospect Theory, Cumulative Prospect Theory, Erwartungsnutzentheorie, Referenzpunkteffekt, kognitive Verzerrungen (Bias), Verlustaversion, Endowment-Effekt, Status Quo-Bias, Anchoring-Effekt, Entscheidungsfindung, Controlling, Risikowahrnehmung, Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion, Nutzenfunktion, Wertefunktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Prospect Theory und Cumulative Prospect Theory im Controlling
Was ist der Inhalt dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit befasst sich mit Entscheidungsfindungsprozessen unter Unsicherheit, insbesondere anhand der Prospect Theory und der Cumulative Prospect Theory. Sie untersucht den Einfluss kognitiver Verzerrungen (Bias) auf Entscheidungen und präsentiert Maßnahmen im Controlling zur Milderung dieser Bias.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Erwartungsnutzentheorie, die Prospect Theory (1979), die Cumulative Prospect Theory (CPT) und deren Kritikpunkte. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der beiden Prospect-Theorien, einschließlich ihrer Editierungs- und Evaluationsphasen.
Was sind die zentralen Elemente der Prospect Theory?
Die Prospect Theory umfasst zwei Phasen: die Editierungsphase (Coding, Combination, Segregation, Cancellation, Simplification, Detection of Dominance) und die Evaluationsphase (Nutzenfunktion, Wertefunktion, Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion). Die Cumulative Prospect Theory erweitert die ursprüngliche Theorie, vor allem hinsichtlich der Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion.
Welche kognitiven Bias werden untersucht?
Die Arbeit analysiert den Referenzpunkteffekt als Ursache für verschiedene kognitive Bias, darunter Verlustaversion, Endowment-Effekt, Status Quo-Bias und Anchoring-Effekt. Die abnehmende Sensitivität wird ebenfalls berücksichtigt.
Wie werden kognitive Bias im Controlling gemildert?
Die Arbeit beschreibt praktische Maßnahmen im Controlling zur Milderung der identifizierten kognitiven Bias. Für jeden Bias werden spezifische Strategien und Methoden vorgestellt, um deren negative Auswirkungen auf Entscheidungen zu reduzieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Erwartungsnutzentheorie, Prospect Theory (1979), Cumulative Prospect Theory, Referenzpunkteffekt als Ursache für Cognitive Bias und Maßnahmen im Controlling gegen Cognitive Bias. Jedes Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung im Text.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Darstellung von Entscheidungsfindungsprozessen anhand der Prospect Theory und der Cumulative Prospect Theory. Sie untersucht, wie kognitive Verzerrungen Entscheidungen beeinflussen und welche Gegenmaßnahmen im Controlling eingesetzt werden können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prospect Theory, Cumulative Prospect Theory, Erwartungsnutzentheorie, Referenzpunkteffekt, kognitive Verzerrungen (Bias), Verlustaversion, Endowment-Effekt, Status Quo-Bias, Anchoring-Effekt, Entscheidungsfindung, Controlling, Risikowahrnehmung, Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion, Nutzenfunktion, Wertefunktion.
- Arbeit zitieren
- Migen Rama (Autor:in), 2018, Prospect Theory. Unkorrekte Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/415959