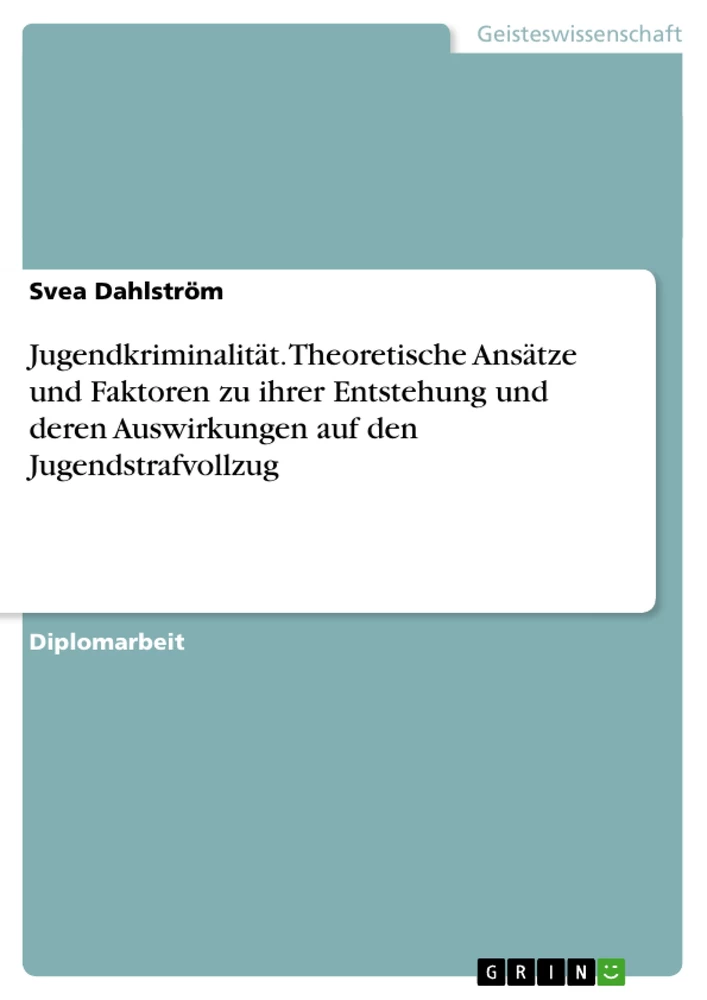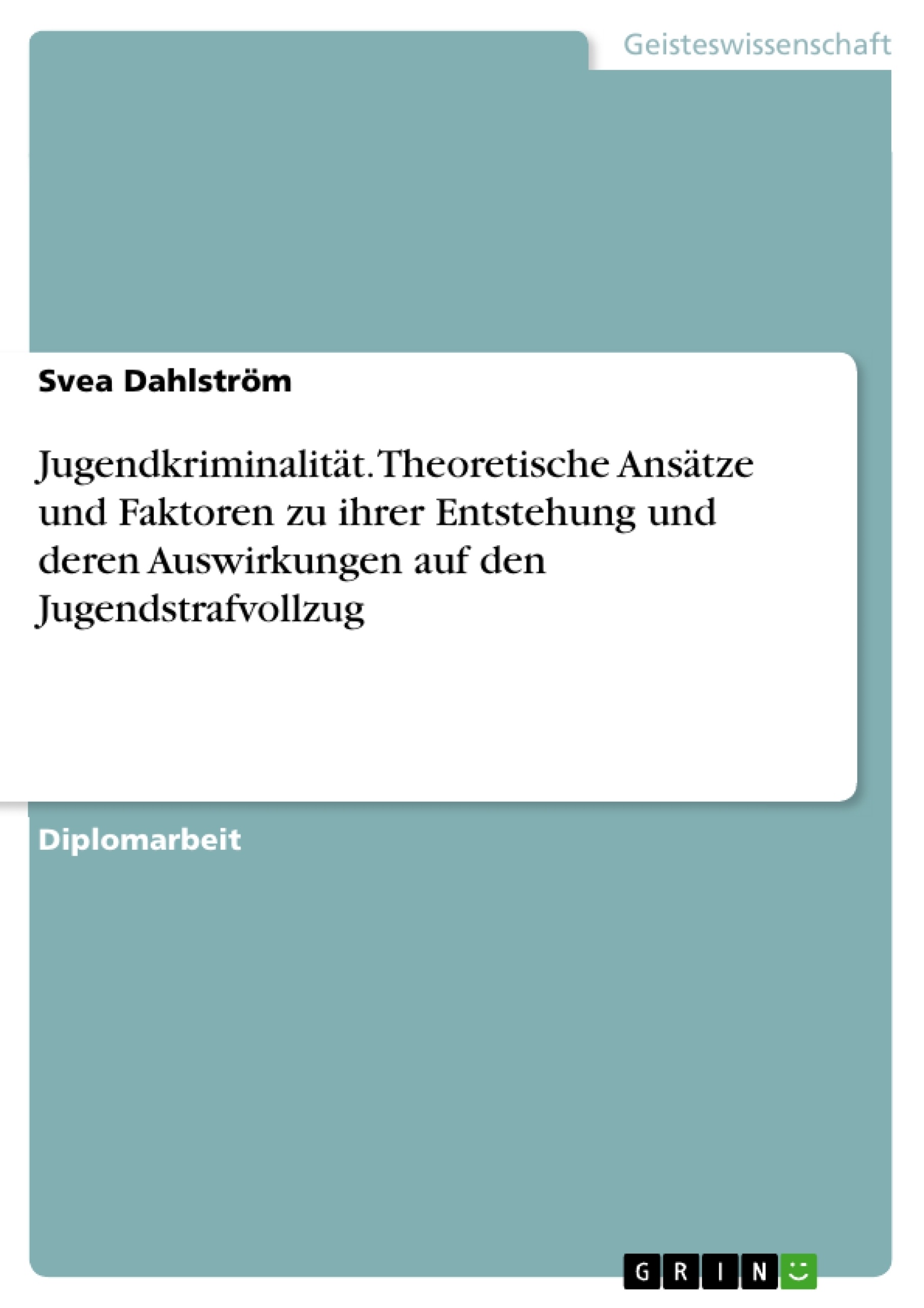Es gibt keinen Tag, an dem keine neuen Schreckensmeldungen über jugendliche Kriminelle, erwachsene Straftäter, Wiederholungstäter und deren „Greultaten“ in den Medien berichtet wird. Entsetzen und Fragen bei allen Betroffenen und bei allen Nicht-Betroffenen: Warum hat er/sie das getan? Hat das denn niemand ahnen können? Und vor allem die Frage: Wer ist letztendlich schuld? Wen können wir dafür verantwortlich machen? Wer hat es zu verantworten, dass solche Menschen frei herumlaufen?
Aber wie viele Menschen werden sich fragen: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass dieser Mensch so etwas tut? War dieser Täter nicht vielleicht selbst ein Opfer?
Solche Dinge werden abends am Stammtisch wohl kaum diskutiert werden. Die lautesten Stimmen dort werden rufen: „Alle einsperren, nie wieder rauslassen, abschieben.“ Und solche Äußerungen sind entgegen der Realität noch harmlos.
Was dabei immer wieder vergessen wird, ist die Tatsache, dass all diese „Kriminellen“ unserer Gesellschaft entstammen. Es ist unter anderem unsere Sozialisation, die sie zum dem gemacht hat, was sie sind. Wie steht es um das Verantwortungsgefühl des einzelnen und aller gegenüber den Mitgliedern unserer Gesellschaft? Wie steht es um Solidarität, Akzeptanz und Respekt gegenüber anderen Menschen, Kulturen und deren Sitten? Haben wir tatsächlich alle in unsere Gemeinschaft aufgenommen? Oder ist es nicht vielleicht so, dass viele kriminelle Handlungen verübt werden, weil wir gar keine Gemeinschaft sind? Weil keiner mehr auf den anderen achtet?
Wo liegen die Gründe dafür, dass unsere Kinder kriminell werden? Sind es vielleicht die Medien, die alle schon von klein auf an Gewalt gewöhnen? Sind wir es selbst, weil wir keine Zeit mehr haben unsere Kinder zu erziehen, ihnen Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken? Ist es vielleicht die Wirtschaft, die dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass die Mehrzahl so wenig verdient, so dass schon Kinder und Jugendliche zum Sozialfall werden und sie sich ihre, durch unsere Gesellschaft produzierten Konsumwünsche, mittels krimineller Handlungen befriedigen wollen? Ist es das Fehlen der immer mehr in Vergessenheit geratenden humanistischen Werte? Es könnte auch das immer wieder im Fadenkreuz stehende Bildungssystem sein. Oder der Zerfall der „klassischen“ Familienkonstellation.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Phänomen Jugendkriminalität
- 2.1 Was ist Kriminalität?
- 2.2 Was ist Jugendkriminalität?
- 2.3 Definition des Begriffs „Jugend“
- 2.3.1 Welche Altersgruppe umschreibt der Begriff Jugend?
- 2.3.2 Adoleszenz
- 2.4 Deliktarten, Alter, Geschlecht und Ausländeranteil
- 2.4.1 Tatverdächtige der Altersgruppen bei Straftaten insgesamt
- 2.4.2 Geschlecht
- 2.4.3 Ausländeranteil
- 2.5 Deliktarten
- 2.6 Sanktionen im Jugendstrafrecht
- 2.6.1 Erziehungsmaßregeln
- 2.6.2 Zuchtmittel
- 2.6.3 Jugendstrafe
- 2.7 Besonderheiten der Jugendkriminalität
- 2.8 Ursachen für die Entstehung von Jugendkriminalität
- 3 Kriminalitätstheorien
- 3.1 Einleitung
- 3.2 Klassifikation der theoretischen Ansätze zur Entstehung abweichenden Verhaltens
- 3.3 Auswahl unterschiedlicher Ansätze zur Entstehung von Kriminalität
- 3.3.1 Ätiologische Ansätze
- 3.3.2 Die klassische Schule
- 3.3.3 Sozialstrukturelle Ansätze
- 3.3.4 Interaktionistische Ansätze
- 3.4 Inhaltliche Darstellung ausgewählter Theorien zur Entstehung von Kriminalität
- 3.4.1 Psychoanalytische Kriminalitätstheorie
- 3.4.2 Sozialisationstheorie
- 3.4.3 Lerntheorie/Theorie des differentiellen Lernens
- 3.4.4 Anomie Theorie
- 3.4.5 Labeling Approach / Etikettierungsansatz
- 3.4.6 Das „Teufelskreis-Modell“ von Quensel
- 4 Jugendstrafvollzug
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Der Vollzug der Jugendstrafe
- 4.3 Allgemeines zur Jugendstrafe
- 4.4 Komponenten eines Jugendstrafvollzugsgesetzes
- 4.4.1 Gesetzesziel/Vollzugsziel
- 4.4.2 Vollzugsplan/Erziehungsplan/Förderplan
- 4.4.3 Zielgerichtete Betreuung
- 4.4.4 Entlassungsvorbereitung/Wiedereingliederung
- 4.4.5 Mitarbeit des Jugendlichen
- 4.4.6 Freizeitangebot
- 4.4.7 Personal
- 4.4.8 Kleidung
- 4.4.9 Unterbringung
- 4.4.10 Inhaftierung
- 5 Strafen, Erziehen, Resozialisieren?
- 5.1 Was bedeutet „Erziehung“?
- 5.1.1 Zur Begrifflichkeit der Erziehung im Jugendstrafvollzug
- 5.1.2 Die Problematik der Erziehung im Jugendstrafvollzug
- 5.2 Resozialisierung in oder durch den Jugendstrafvollzug?
- 5.2.1 Zur Begrifflichkeit
- 5.2.2 Berücksichtigung von Erkenntnissen aus Kriminalitätstheorien im Jugendstrafvollzug?
- 5.1 Was bedeutet „Erziehung“?
- 6 Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen von Jugendkriminalität, beleuchtet Besonderheiten des Phänomens und präsentiert verschiedene Theorien zu deren Entstehung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung des Jugendstrafvollzugs und der Fragestellung, wie weit die Faktoren der Entstehung von Kriminalität im Vollzug Berücksichtigung finden. Die Arbeit analysiert die Begriffe Erziehen, Strafen und Resozialisieren im Kontext des Jugendstrafvollzugs.
- Ursachen von Jugendkriminalität
- Kriminalitätstheorien und deren Relevanz
- Der Jugendstrafvollzug und seine Praxis
- Erziehung, Strafe und Resozialisierung im Jugendstrafvollzug
- Zusammenhang zwischen Kriminalitätstheorien und Jugendstrafvollzug
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung thematisiert die öffentliche Wahrnehmung von Jugendkriminalität und die damit verbundenen emotionalen Reaktionen. Sie wirft kritische Fragen nach den Ursachen von Kriminalität auf, hinterfragt gesellschaftliche Verantwortung und die Rolle von Sozialisation, Medien, Wirtschaft und Bildungssystem. Die Arbeit wird als Versuch positioniert, die komplexen Ursachen von Jugendkriminalität zu untersuchen und die Praxis des Jugendstrafvollzugs zu beleuchten. Sie kündigt die Analyse von Kriminalitätstheorien und die Auseinandersetzung mit den Begriffen Erziehen, Strafen und Resozialisieren an.
2 Das Phänomen Jugendkriminalität: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Kriminalität und Jugendkriminalität und beschreibt die Altersgruppen, die unter den Begriff "Jugend" fallen, inklusive der Phase der Adoleszenz. Es analysiert statistische Daten zu Deliktarten, Alter, Geschlecht und Ausländeranteil von Tatverdächtigen. Des Weiteren werden Sanktionen im Jugendstrafrecht (Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel, Jugendstrafe) erläutert und Besonderheiten der Jugendkriminalität hervorgehoben. Schließlich werden erste Überlegungen zu den Ursachen für die Entstehung von Jugendkriminalität angestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit vertieft werden.
3 Kriminalitätstheorien: Dieses Kapitel klassifiziert theoretische Ansätze zur Entstehung abweichenden Verhaltens und stellt verschiedene Theorien zur Entstehung von Kriminalität vor (z.B. ätiologische Ansätze, die klassische Schule, sozialstrukturelle und interaktionistische Ansätze). Es analysiert ausgewählte Theorien im Detail, wie die psychoanalytische Kriminalitätstheorie, die Sozialisationstheorie, die Lerntheorie, die Anomie-Theorie, den Labeling Approach und das Teufelskreis-Modell von Quensel. Der Fokus liegt auf der Darstellung der unterschiedlichen Perspektiven und Erklärungsmuster für die Entstehung von Kriminalität.
4 Jugendstrafvollzug: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Vollzug der Jugendstrafe und den Komponenten eines Jugendstrafvollzugsgesetzes. Es werden die Ziele des Vollzugs, der Vollzugsplan, die zielgerichtete Betreuung, die Entlassungsvorbereitung, die Mitarbeit des Jugendlichen, das Freizeitangebot, das Personal, die Kleidung und die Unterbringung beleuchtet. Das Kapitel beschreibt den Jugendstrafvollzug als komplexes System mit dem Ziel der Resozialisierung.
5 Strafen, Erziehen, Resozialisieren?: Dieses Kapitel befasst sich mit den Begriffen „Erziehung“, „Strafen“ und „Resozialisierung“ im Kontext des Jugendstrafvollzugs. Es hinterfragt die Problematik der Erziehung im Jugendstrafvollzug und diskutiert die Möglichkeiten und Herausforderungen der Resozialisierung. Der Zusammenhang zwischen den im vorherigen Kapitel dargestellten Kriminalitätstheorien und der Praxis des Jugendstrafvollzugs wird kritisch untersucht.
Schlüsselwörter
Jugendkriminalität, Kriminalitätstheorien, Jugendstrafvollzug, Resozialisierung, Erziehung, Strafe, Adoleszenz, Deliktarten, Sozialisation, Anomie, Labeling Approach, Teufelskreis-Modell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Jugendkriminalität, Kriminalitätstheorien und Jugendstrafvollzug
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Jugendkriminalität. Sie untersucht die Ursachen, beleuchtet Besonderheiten des Phänomens und präsentiert verschiedene Kriminalitätstheorien. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Jugendstrafvollzug und der Frage, inwieweit die Entstehung von Kriminalität im Vollzug berücksichtigt wird. Die Arbeit analysiert die Begriffe Erziehen, Strafen und Resozialisieren im Kontext des Jugendstrafvollzugs.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition von Kriminalität und Jugendkriminalität, statistische Daten zu Delikten, Alter, Geschlecht und Ausländeranteil, Sanktionen im Jugendstrafrecht, verschiedene Kriminalitätstheorien (z.B. psychoanalytische Theorie, Sozialisationstheorie, Lerntheorie, Anomie-Theorie, Labeling Approach, Teufelskreis-Modell), Komponenten des Jugendstrafvollzugs (Ziele, Vollzugsplan, Betreuung, Entlassung, etc.), und eine kritische Auseinandersetzung mit den Begriffen Erziehung, Strafe und Resozialisierung im Jugendstrafvollzug.
Welche Kriminalitätstheorien werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Kriminalitätstheorien vor, darunter ätiologische Ansätze, die klassische Schule, sozialstrukturelle und interaktionistische Ansätze. Im Detail werden die psychoanalytische Kriminalitätstheorie, die Sozialisationstheorie, die Lerntheorie/Theorie des differentiellen Lernens, die Anomie-Theorie, der Labeling Approach/Etikettierungsansatz und das „Teufelskreis-Modell“ von Quensel analysiert.
Wie ist der Jugendstrafvollzug beschrieben?
Der Jugendstrafvollzug wird als komplexes System mit dem Ziel der Resozialisierung beschrieben. Die Arbeit beleuchtet die Komponenten eines Jugendstrafvollzugsgesetzes, inklusive Gesetzeszielen, Vollzugsplan, zielgerichteter Betreuung, Entlassungsvorbereitung, Mitarbeit des Jugendlichen, Freizeitangebot, Personal, Kleidung und Unterbringung.
Wie werden die Begriffe „Erziehung“, „Strafen“ und „Resozialisierung“ behandelt?
Die Arbeit hinterfragt die Problematik der Erziehung im Jugendstrafvollzug und diskutiert die Möglichkeiten und Herausforderungen der Resozialisierung. Der Zusammenhang zwischen den vorgestellten Kriminalitätstheorien und der Praxis des Jugendstrafvollzugs wird kritisch untersucht.
Welche Altersgruppen werden unter dem Begriff „Jugend“ betrachtet?
Die Arbeit definiert den Begriff "Jugend" und berücksichtigt die damit verbundenen Altersgruppen, inklusive der Phase der Adoleszenz.
Welche Arten von Sanktionen im Jugendstrafrecht werden genannt?
Die Arbeit erläutert die Sanktionen im Jugendstrafrecht, darunter Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und Jugendstrafe.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse jedes Abschnitts zusammenfasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Jugendkriminalität, Kriminalitätstheorien, Jugendstrafvollzug, Resozialisierung, Erziehung, Strafe, Adoleszenz, Deliktarten, Sozialisation, Anomie, Labeling Approach, Teufelskreis-Modell.
- Citation du texte
- Svea Dahlström (Auteur), 2005, Jugendkriminalität. Theoretische Ansätze und Faktoren zu ihrer Entstehung und deren Auswirkungen auf den Jugendstrafvollzug, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41621