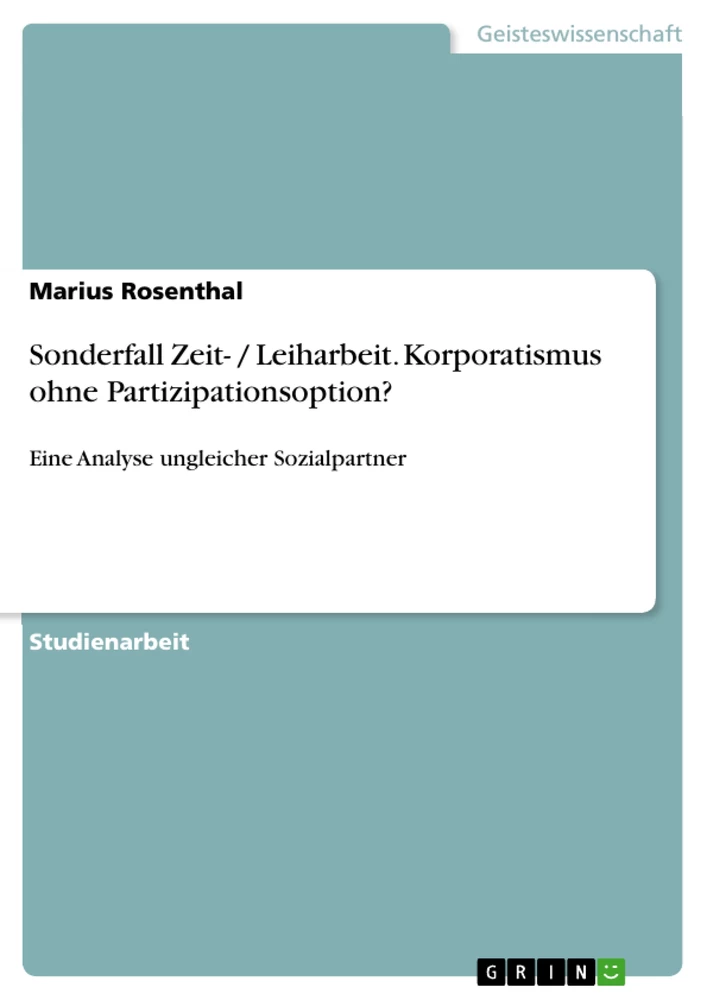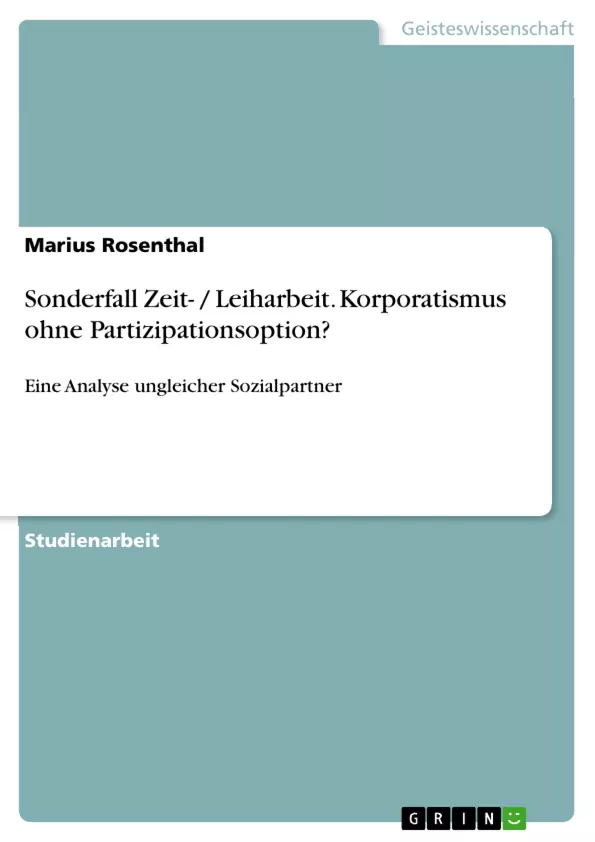In den Debatten der aktuellen Tagespolitik sorgt das Thema „Agenda 2010“ immer noch regelmäßig für angeheizte Diskussionen. Trotz nunmehr 14 Jahren seit Verkündigung der Reformpläne durch Bundeskanzler Gerhard Schröder im Jahre 2003 scheint diese Thematik die Bundespolitik bis heute nachhaltig verändert zu haben. Im Vordergrund steht dabei seitdem häufig die neue Rolle der Zeit-/ und Leiharbeit. Dieser so rasch wachsende Wirtschaftssektor stellt, wie so oft, auch hier einen bemerkenswerten Spezialfall dar.
Im Fokus dieser Arbeit, steht eine Betrachtung der Interessenvertretungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern des Sektors. Mit Schwerpunkt auf Besonderheiten der Arbeitnehmerseite, werden in der Analyse die Schwierigkeiten der Arbeitnehmerverbände in Zeit-/Leiharbeit erörtert und die daraus resultierende Sonderrolle des Gesetzgebers aufgezeigt. Die Analyse erfolgt nach Betrachtung der Organisation von Zeit-/ und Leiharbeit in ausgewählten, europäischen Ländern im Vergleich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Machtressourcentheorie und (Neo-)Korporatismusansatz in Zeit-/ und Leiharbeit
- Klassische Annahmen
- Akteure der sozialen Konzertierung in Zeit-/ und Leiharbeit in Deutschland
- Maß der Regulierung und institutionelle Ausgestaltung von Zeit-/ und Leiharbeit im europäischen Vergleich
- Deutschland
- Frankreich
- Großbritannien
- Niederlande
- Forschungsstand
- Fragestellungen für die Analyse
- Analyse
- Schwierigkeiten der Arbeitnehmervertretungen
- Rolle des Staates als Gesetzgeber
- Fazit
- Ausblick und aktuelle Entwicklungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die besonderen Herausforderungen der Sozialpartnerschaft und des sozialen Dialogs im Kontext der Zeit-/ und Leiharbeit. Sie untersucht, inwiefern die traditionellen Prinzipien des Korporatismus im Kontext der Zeit-/ und Leiharbeit, insbesondere in Bezug auf die Arbeitnehmerseite, Gültigkeit besitzen.
- Die Rolle der Machtressourcentheorie und des (Neo-)Korporatismusansatzes im Bereich der Zeit-/ und Leiharbeit
- Der Einfluss der Regulierung und der institutionellen Ausgestaltung von Zeit-/ und Leiharbeit auf die Sozialpartnerschaft
- Die Schwierigkeiten der Arbeitnehmervertretungen in der Zeit-/ und Leiharbeit
- Die Sonderrolle des Gesetzgebers als Akteur im sozialen Dialog der Zeit-/ und Leiharbeit
- Ein Vergleich der Situation in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit führt in die Thematik der Zeit-/ und Leiharbeit im Kontext der „Agenda 2010“ ein. Sie beleuchtet die zunehmende Bedeutung dieser Arbeitsform und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Sozialpartnerschaft.
Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen der Arbeit, die Machtressourcentheorie und den (Neo-)Korporatismusansatz, und erklärt ihre Relevanz für die Analyse der Sozialpartnerschaft in der Zeit-/ und Leiharbeit.
Kapitel 3 betrachtet die Regulierung und die institutionelle Ausgestaltung von Zeit-/ und Leiharbeit in ausgewählten europäischen Ländern, mit Fokus auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden.
Kapitel 4 präsentiert den Forschungsstand und die wichtigsten Fragestellungen für die Analyse der Arbeitnehmervertretungen in der Zeit-/ und Leiharbeit.
Kapitel 5 analysiert die Schwierigkeiten der Arbeitnehmervertretungen in der Zeit-/ und Leiharbeit und die daraus resultierende Sonderrolle des Gesetzgebers.
Schlüsselwörter
Zeit-/ und Leiharbeit, Sozialpartnerschaft, sozialer Dialog, (Neo-)Korporatismus, Machtressourcentheorie, Arbeitnehmervertretungen, Gesetzgeber, Regulierung, Europa, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt die Zeit- und Leiharbeit als Sonderfall des Korporatismus?
Weil die klassischen Mechanismen der Sozialpartnerschaft (Gewerkschaften/Arbeitgeberverbände) in diesem Sektor aufgrund der hohen Fluktuation und der Dreiecksbeziehung zwischen Verleiher, Entleiher und Arbeitnehmer schwerer greifen.
Was ist der (Neo-)Korporatismusansatz?
Es beschreibt die institutionalisierte Beteiligung organisierter Interessenverbände an politischen Entscheidungsprozessen und der Regulierung des Arbeitsmarktes.
Welche Schwierigkeiten haben Arbeitnehmervertretungen in der Leiharbeit?
Die geringe gewerkschaftliche Organisierungsrate und die räumliche Trennung der Leiharbeitnehmer erschweren eine effektive Interessenvertretung und Partizipation.
Wie unterscheidet sich die Regulierung der Leiharbeit in Europa?
Länder wie Frankreich haben strengere gesetzliche Schutzvorschriften, während Großbritannien einen eher marktliberalen Ansatz verfolgt. Deutschland liegt mit dem AÜG und der Agenda 2010 dazwischen.
Welche Rolle spielt der Staat als Gesetzgeber in diesem Sektor?
Da die Sozialpartner oft keine autonomen Lösungen finden, greift der Staat häufiger regulierend ein, um Mindeststandards und den Rahmen für die Leiharbeit festzulegen.
- Citation du texte
- Marius Rosenthal (Auteur), 2018, Sonderfall Zeit- / Leiharbeit. Korporatismus ohne Partizipationsoption?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416895