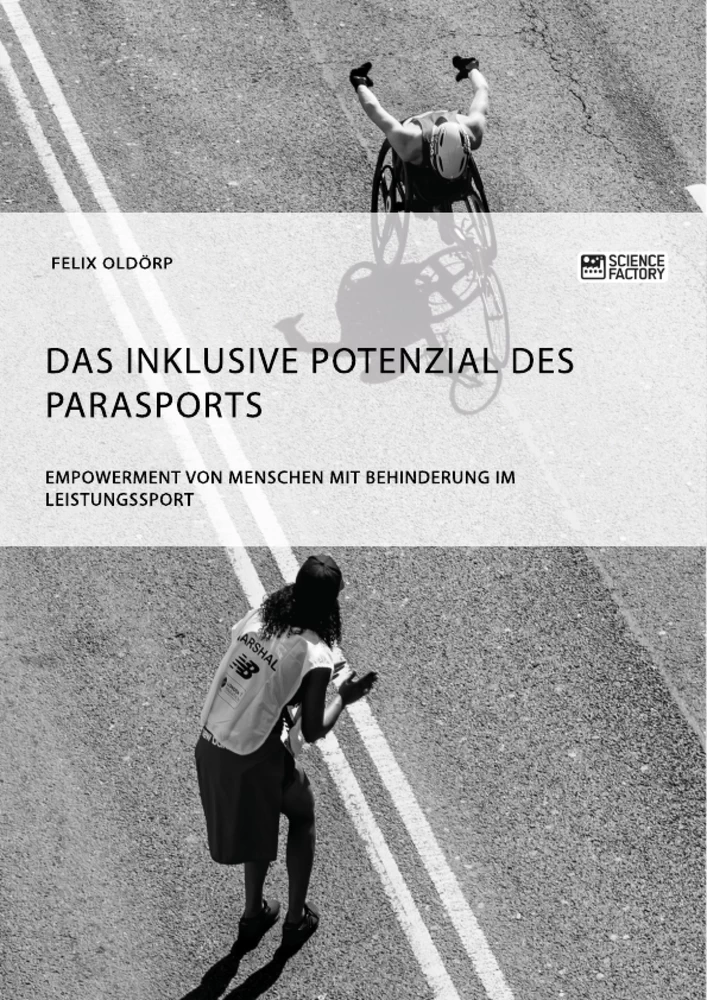Sport ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Mit Sport werden Eigenschaften wie Stärke, Fitness, Dominanz, Wohlbefinden und Leistungsvermögen assoziiert. Zugleich geben die Medien uns immer mehr vor, wie der normale Körper auszusehen hat und welche sportlichen Fähigkeiten als angemessen gelten.
Wie verhält es sich jedoch für Menschen mit Behinderung, die einen Leistungssport ausüben? Behinderung wird mit Schwäche, Abhängigkeit, Unfähigkeit und mangelnder Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. In seiner Publikation zeigt Felix Oldörp, dass der Sport enorm zur Inklusion von Menschen mit Behinderung beitragen kann.
Organisationen wie das Internationale Paralympische Komitee oder die Special Olympics haben sich das Ziel gesetzt, für mehr Empowerment und Inklusion von Menschen mit Behinderung im Leistungssport zu sorgen. Er zeigt auf, wie der Behindertenleistungssport die Inklusionschancen für Menschen mit Behinderung verbessert.
Aus dem Inhalt:
- Paralympics;
- Leistungssport;
- Menschen mit Behinderung;
- Inklusion;
- Empowerment;
- Integration
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsbestimmungen
- 2.1 Behinderung
- 2.2 (Behinderten-) Leistungssport
- 2.3 Paralympische Spiele
- 2.4 Special Olympics
- 2.5 Deaflympics
- 3 Theoretischer Ansatz
- 3.1 Inklusion
- 3.2 Menschenbild im Sport
- 3.3 Ansätze für ein ganzheitliches Menschenbild
- 3.4 Darstellung von Behinderung und Sport in den Medien
- 3.5 Zusammenfassung
- 4 Inklusion im und durch Leistungssport
- 4.1 Inklusion und Empowerment
- 4.2 Segregation und Disempowerment
- 4.3 Zusammenfassung und Kategorisierung der Variablen
- 5 Schlussfolgerungen und Ausblick
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das inklusive Potenzial des Behindertenleistungssports im Kontext von Luhmanns Systemtheorie und anthropologischen Überlegungen zu einem ganzheitlichen Menschenbild. Dabei steht die Frage im Zentrum, wie Behindertenleistungssport zur sozialen Inklusion von Menschen mit Behinderungen beitragen kann. Die Analyse erfolgt anhand einer Literaturrecherche und betrachtet die Inklusion durch und im Leistungssport.
- Inklusion und Segregation im Behindertenleistungssport
- Empowerment und Disempowerment von Menschen mit Behinderung im Sport
- Das Menschenbild im Sport und seine Relevanz für die Inklusion
- Die Rolle von Medien in der Darstellung von Behinderung und Sport
- Analyse verschiedener Sportveranstaltungen wie Paralympische Spiele, Special Olympics und Deaflympics
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung und stellt den Forschungsgegenstand sowie die Forschungsfrage vor. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition von Behinderung, Leistungssport und verschiedenen Formen von Sportveranstaltungen für Menschen mit Behinderungen, darunter die Paralympischen Spiele, Special Olympics und Deaflympics. Kapitel 3 beleuchtet den theoretischen Ansatz der Arbeit und diskutiert die Konzepte von Inklusion und dem Menschenbild im Sport. Zudem werden Ansätze für ein ganzheitliches Menschenbild und die Rolle der Medien in der Darstellung von Behinderung und Sport analysiert. Kapitel 4 widmet sich der Inklusion im und durch Leistungssport. Dabei werden Faktoren für Empowerment und Disempowerment sowie Inklusion und Segregation am Beispiel der Paralympischen Spiele, Special Olympics und Deaflympics untersucht.
Schlüsselwörter
Inklusion, Behindertenleistungssport, Empowerment, Disempowerment, Menschenbild, Sport, Paralympische Spiele, Special Olympics, Deaflympics, Segregation, Systemtheorie, Medien, Literaturanalyse.
- Quote paper
- Felix Oldörp (Author), 2018, Das inklusive Potenzial des Parasports. Empowerment von Menschen mit Behinderung im Leistungssport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416921