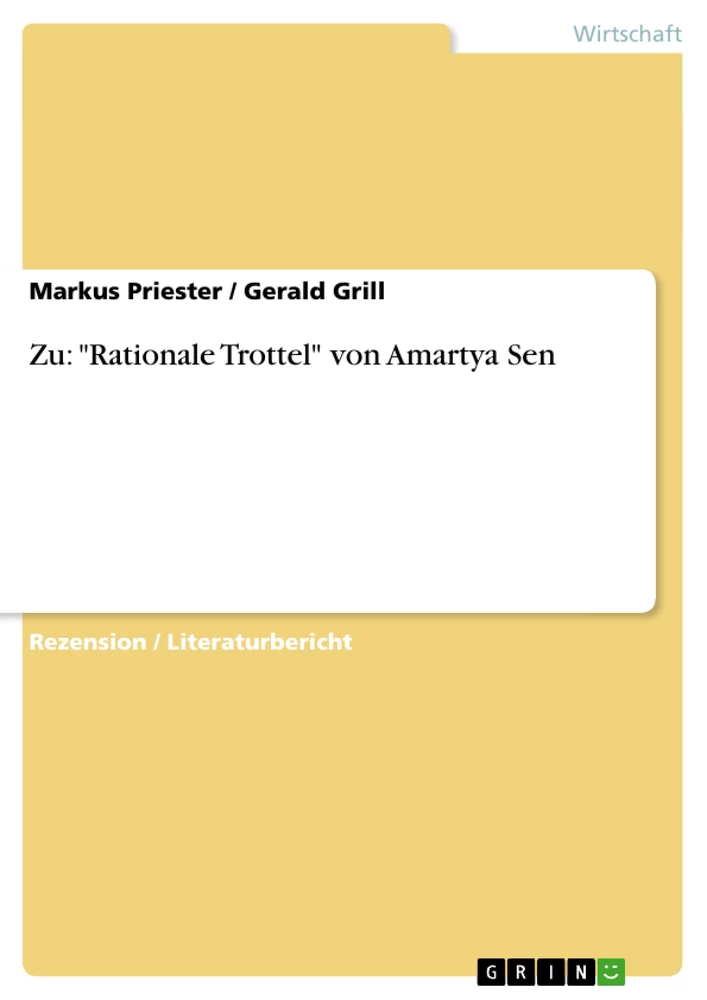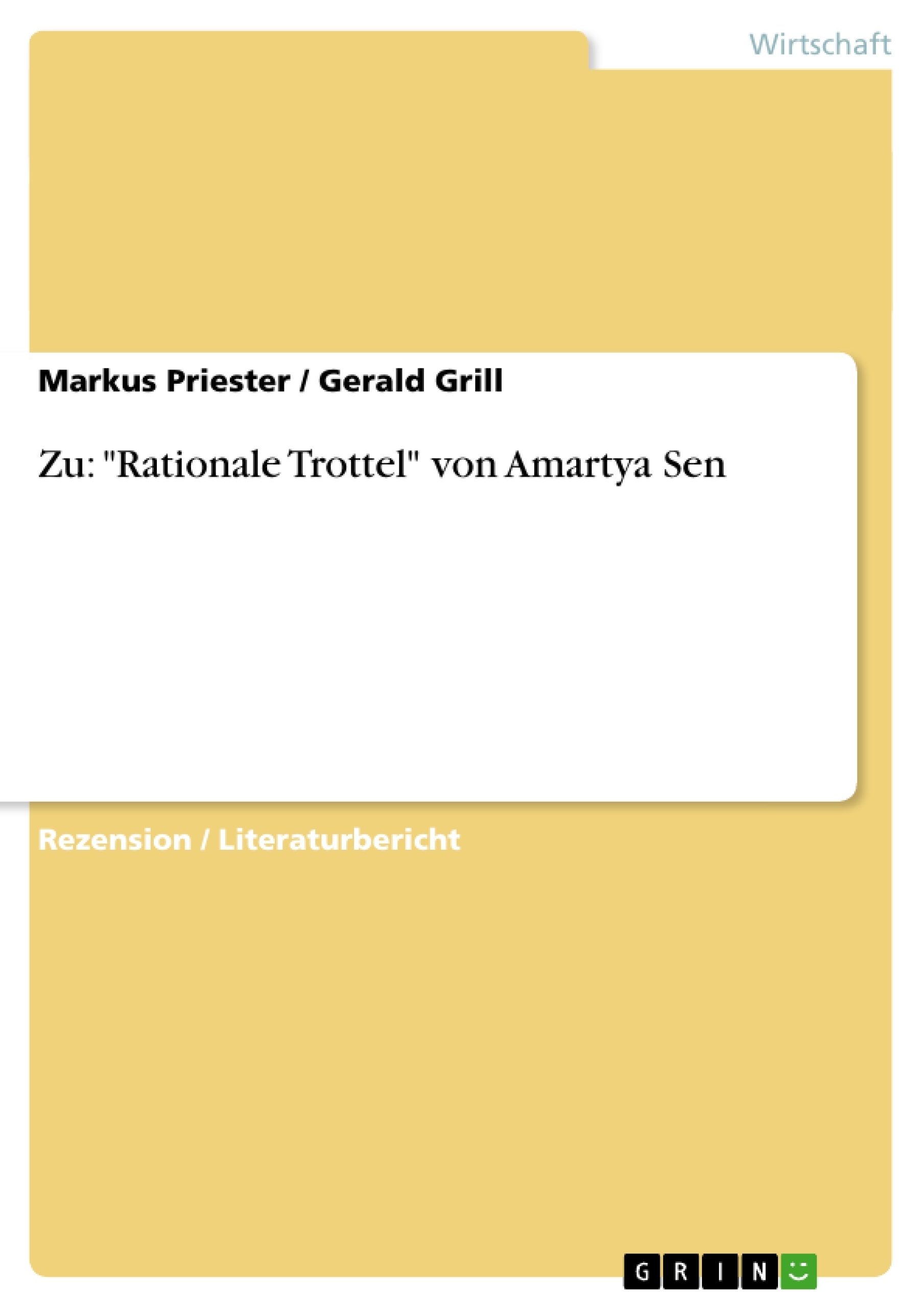1. Einleitung
Das Ziel unserer Arbeit ist es den Aufsatz Rationale Trottel von Amartya K. Sen zusammenzufassen, seine wesentlichen Aussagen herauszufiltern und den Text zu reflektieren.
In der Zusammenfassung versuchen wir uns auf die wesentliche Aspekte der einzelnen Kapitel zu konzentrieren.
2. Zusammenfassung des Textes
2.1. Kapitel I
Seit Adam Smiths Zeiten steht der „Homo Oeconomicus“ im Mittelpunkt vieler Wirtschaftstheorien. Auch modernere Ökonomische Theorien beziehen sich in ihren Ansätzen immer wieder auf das Individuum das grundsätzlich nur zum eigenen Vorteil handelt.
Auch Amartya K. Sen geht in seiner Kritik mit F.Y. Edgeworth („Jeder handelnde wird nur von seinem Eigeninteresse geleitet.“) hart ins Gericht, weil er der Meinung ist, dass:
„es bei all der Theorie nicht um das Verhältnis zwischen postulierten Modellen und der realen Wirtschaftswelt geht, sondern um den Wert von Antworten auf sorgfältig definierte Fragen, die auf Grund von vorgefassten Annahmen in erheblichem Maße die Art der Modelle eingrenzen, die in die Untersuchung Eingang finden.“
2.2. Kapitel II
Jedes Individuum das an einer Marktwirtschaft teilnimmt wird in einem Schema erfasst, das ihm gewisse Präferenzen bei diversen Entscheidungen zuzuordnen versucht.
Amartya K. Sen kritisiert diesen Ansatz, da er der Meinung ist, dass nicht alle Verhaltensmuster in einen formalen Rahmen gepresst werden können auf den die Theorie der Nutzenmaximierung beruht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zusammenfassung des Textes
- Kapitel I
- Kapitel II
- Kapitel III
- Kapitel IV
- Kapitel V
- Kapitel VI
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text fasst den Aufsatz „Rationale Trottel“ von Amartya K. Sen zusammen, analysiert seine zentralen Aussagen und reflektiert über seine Bedeutung. Der Fokus liegt dabei auf der kritischen Analyse der traditionellen ökonomischen Vorstellung vom „Homo Oeconomicus“ und der Untersuchung von Verhaltensweisen, die von Mitgefühl und Verpflichtung geprägt sind.
- Kritik am „Homo Oeconomicus“ und seiner einseitigen Fokussierung auf Eigeninteresse
- Die Rolle von Mitgefühl und Verpflichtung im menschlichen Verhalten
- Die Grenzen der Nutzenmaximierungstheorie in der Erklärung komplexer Entscheidungsfindung
- Die Bedeutung von kollektiven Gütern und die Herausforderungen bei deren Finanzierung
- Die Interaktion von individueller Wahl und gesellschaftlichem Wohl
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I
Das Kapitel stellt den „Homo Oeconomicus“ als zentrales Element vieler ökonomischer Theorien vor und kritisiert seine Annahme, dass Individuen ausschließlich eigeninteressiert handeln. Sen argumentiert, dass der Fokus auf realitätsfernen Modellen die Erforschung wichtiger Fragen in der Wirtschaft behindert.
Kapitel II
Sen kritisiert die Reduktion komplexer Verhaltensmuster auf ein Schema von Präferenzen, die der Theorie der Nutzenmaximierung zugrunde liegt. Er argumentiert, dass nicht alle menschlichen Handlungen auf diese Weise erklärt werden können.
Kapitel III
Das Kapitel beleuchtet die Annahme, dass Menschen einen beliebigen Grad an Egoismus besitzen können. Sen weist darauf hin, dass Verhalten durch Präferenzen erklärt wird, die wiederum nur durch Verhalten definiert werden können. Er stellt die Frage nach der Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit der Theorie unter idealen Beobachtungsbedingungen sowie die begrenzte Aussagekraft von Laboruntersuchungen.
Kapitel IV
Das Kapitel untersucht die Unterscheidung zwischen Mitgefühl und Verpflichtung. Mitgefühl wird als egozentrisch angesehen, da es sich um eine Sorge um andere handelt, die das eigene Wohlergehen unmittelbar berührt. Verpflichtung hingegen basiert auf einem Zusammenhang zwischen Entscheidungen einer Person und dem antizipierten Grad des Wohlergehens derselben Person. Sen argumentiert, dass Mitgefühl in der Wirtschaftstheorie als „Externalismus“ behandelt wird, der die theoretischen Modelle komplizieren würde. Er weist darauf hin, dass Verpflichtung einen Keil zwischen persönlicher Wahl und persönlichem Wohl treibt, was in vielen Theorien ignoriert wird.
Kapitel V
Sen beleuchtet die Bedeutung von Verpflichtung und Mitgefühl für das Wahlverhalten. Er räumt ihnen im Bereich der Konsumgüterentscheidungen nur gelegentliche Bedeutung ein, jedoch große Bedeutung bei öffentlichen Gütern, insbesondere bei beitragsfinanzierten Projekten. Die Herausforderung besteht darin, dass Individuen ihren persönlichen Nutzen herunterzuspielen versuchen, um ihren Beitrag zu minimieren, was zur Nichtverwirklichung vieler Projekte führen kann. Das Kapitel stellt die Frage, ob Menschen immer vorteilsmaximierend handeln oder ob sie dies nur oft genug tun, um es zur angemessenen Voraussetzung für die Wissenschaftstheorie zu machen.
Kapitel VI
Der Zusammenhang zwischen Verpflichtung und Arbeitsmotivation wird untersucht. Begriffe wie „Vertrauen, Moral, Verantwortung und Solidarität“ werden kurz angesprochen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind: Homo Oeconomicus, Eigeninteresse, Mitgefühl, Verpflichtung, Nutzenmaximierung, Präferenzen, Wahlverhalten, öffentliche Güter, Externalismus, kollektives Wohl, Arbeitsmotivation.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Amartya Sen am Modell des „Homo Oeconomicus“?
Sen kritisiert die einseitige Annahme, dass Menschen ausschließlich aus Eigeninteresse handeln. Er bezeichnet Individuen, die nur ihren eigenen Nutzen maximieren und soziale Bindungen ignorieren, als „rationale Trottel“.
Was ist der Unterschied zwischen Mitgefühl und Verpflichtung laut Sen?
Mitgefühl (Sympathy) liegt vor, wenn das Wohlergehen anderer das eigene Befinden direkt beeinflusst. Verpflichtung (Commitment) hingegen führt dazu, dass man eine Handlung wählt, auch wenn sie nicht das eigene Wohlbefinden steigert, etwa aus moralischen Gründen.
Warum ist Verpflichtung für die Wirtschaftstheorie problematisch?
Verpflichtung treibt einen Keil zwischen die persönliche Wahl und das persönliche Wohlergehen. Da viele ökonomische Modelle davon ausgehen, dass die Wahl immer das Wohlbefinden widerspiegelt, stellt Verpflichtung diese Theorien infrage.
Welche Rolle spielen öffentliche Güter in Sens Argumentation?
Bei öffentlichen Gütern ist das Trittbrettfahrer-Problem zentral. Sen zeigt auf, dass rein egoistisches Verhalten zur Nicht-Bereitstellung dieser Güter führen würde, während Verpflichtung und Solidarität deren Finanzierung ermöglichen.
Wie hängen Verpflichtung und Arbeitsmotivation zusammen?
Sen argumentiert, dass Arbeitsleistung nicht nur durch finanzielle Anreize, sondern auch durch Begriffe wie Vertrauen, Verantwortung und Solidarität gesteuert wird, was über die klassische Nutzenmaximierung hinausgeht.
- Quote paper
- Mag. Markus Priester (Author), Gerald Grill (Author), 2003, Zu: "Rationale Trottel" von Amartya Sen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41693