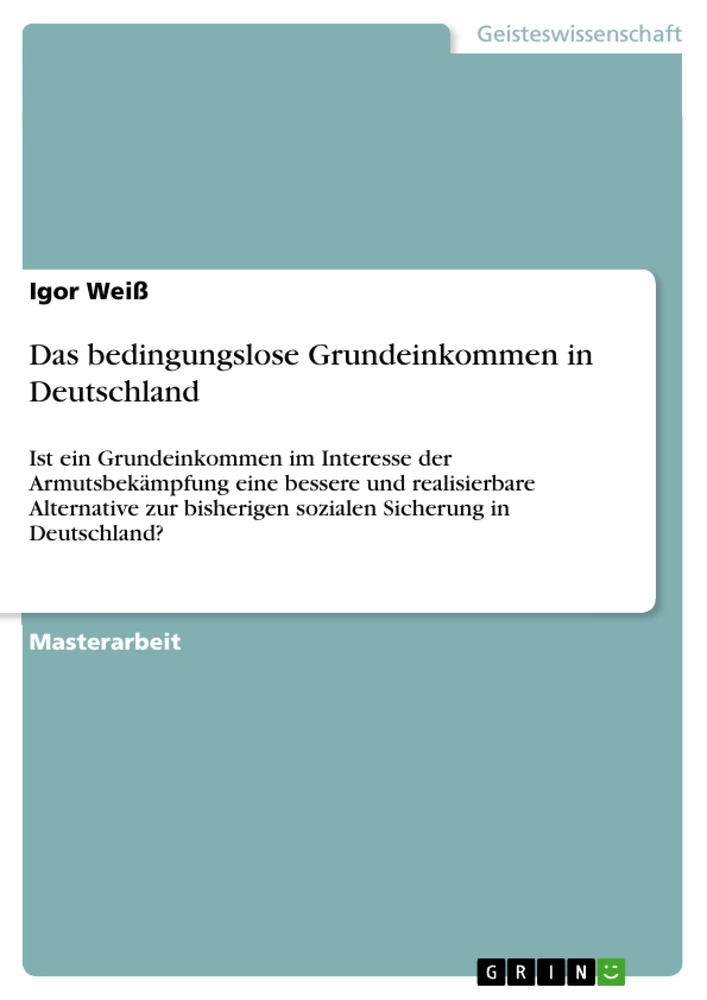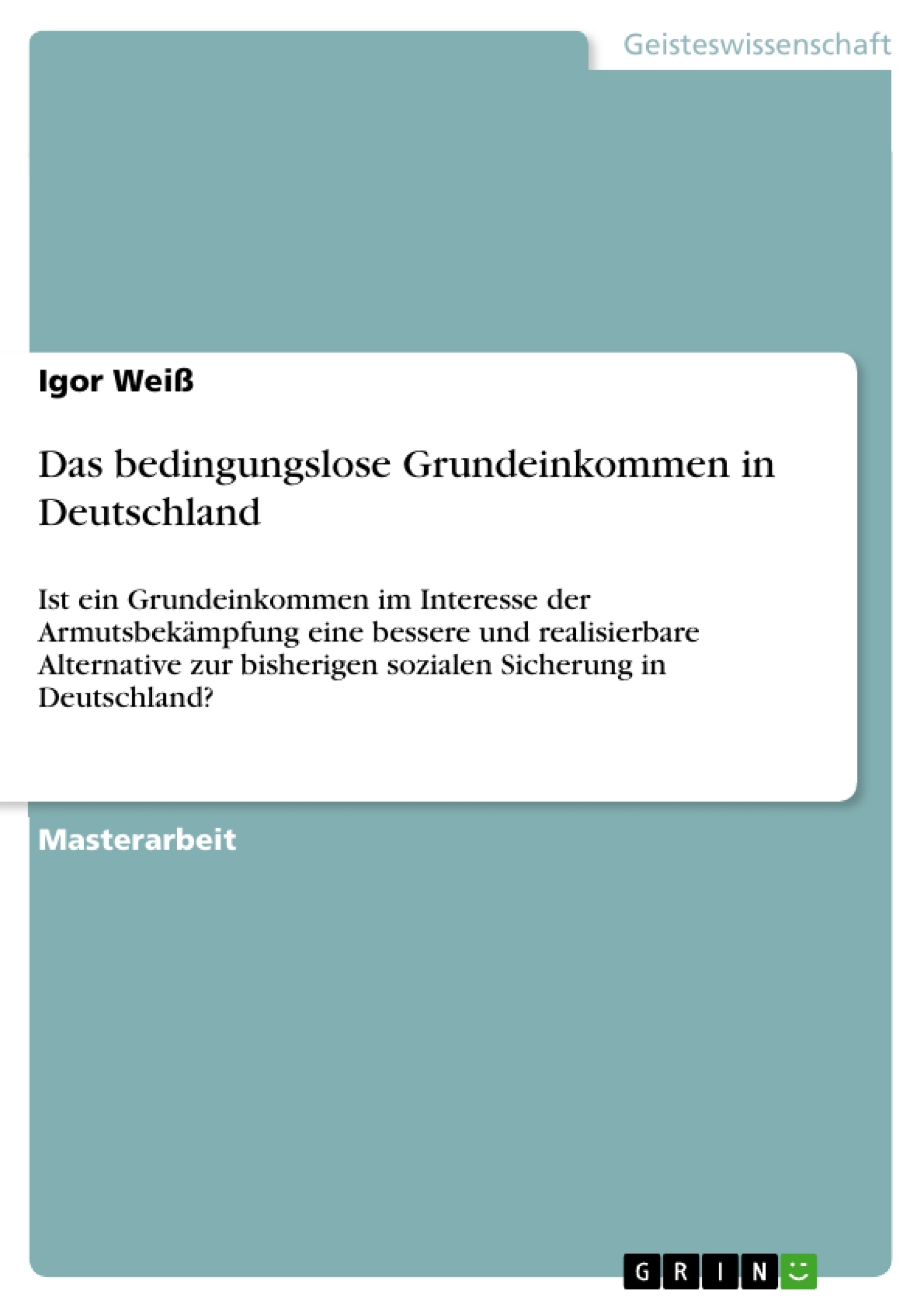Diese Arbeit behandelt das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland. Der Autor dieser wissenschaftlichen Arbeit möchte sich dieser angepriesenen sozialpolitischen Initiative, die weltweit zum Politikum wird, annehmen, indem ein kritischer Beitrag hinsichtlich der wirtschaftlichen und sozialen Perspektiven geleistet wird. Dadurch sollen auch die wesentlichen Herausforderungen eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht in Vergessenheit geraten.
Als Antwort auf die drängenden sozialen Probleme der gegenwärtigen Zukunft wird immer häufiger das „Bedingungslose Grundeinkommen“, kurz BGE, gesehen. Die Idee findet aktuell nach und nach Einzug in politischen und wissenschaftlichen Diskussionen sowie im gesellschaftlichen Mainstream. Aber auch immer mehr Unternehmer sind von dem Konzept angetan und sprechen sich für dessen Einführung aus. Die Befürworter des BGEs fordern ein alternatives Sozialsystem auf Basis einer egalitären, freiheitlichen, unkonventionellen und repressionsfreien Philosophie. Die Auszahlung einer staatlichen Unterstützung von beispielsweise 1000 Euro soll Chancengleichheit schaffen. Das gegenwärtige System sei im Unterschied dazu, hier besteht ein gemeinschaftlicher Konsens mit allgemeinen Kritikern, veraltet und bedürfe einer grundlegenden Reformierung.
Seit über zwei Jahrzehnten werden in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zunehmend Stimmen laut, die darauf hinweisen, dass der deutsche Sozialstaat die gegenwärtigen sozialen Probleme nicht auffangen könnte und in diesem Sinne defizitäre Strukturen aufweise. Zu den anfänglichen Gründen gehörte das hohe Niveau der Arbeitslosigkeit, aber auch der demografische Wandel in Form des Geburtenrückgangs und der gesellschaftlichen Alterung, sowie die stetig ansteigenden Armutszahlen. Sie werden als Folgen des sozialstaatlichen Zerfalls ausgemacht. Das gegenwärtig größte Problem stellt für das deutsche Wohlfahrtsstaatsmodell die Flüchtlingsbewegung ab 2015 dar. Diese Angelegenheit betrifft allerdings alle Staaten der Europäischen Union (EU), die ihre sozialstaatlichen Grundsätze immer öfter gefährdet sehen und auf eine Politik der Abschottung setzen. Während dem Missstand der Arbeitsgesellschaft des späten zwanzigsten Jahrhunderts mit steuerfinanzierter Beschäftigungsförderung und einschneidenden Reformmaßnahmen begegnet werden konnte, müssen angesichts der Flüchtlingskrise neue Strategien von deutschen bzw. europäischen Politikern erst entwickelt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 PROBLEMSTELLUNG
- 1.2 ZIELSETZUNG
- 1.3 VORGEHENSWEISE
- 2. DAS SOZIALSTAATSPRINZIP DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- 2.1 DER SOZIALSTAAT
- 2.2 SOZIALPOLITIK
- 2.3 DAS RECHT DER SOZIALEN SICHERHEIT
- 3. DIE ENTWICKLUNG(EN) DES DEUTSCHEN SOZIALSTAATES
- 3.1 SOZIALSTAATSENTWICKLUNG VOM DEUTSCHEN KAISERREICH BIS ZUM 2. WELTKRIEG
- 3.2 SOZIALSTAATSENTWICKLUNG NACH DEM 2. WELTKRIEG BIS HEUTE
- 3.3 DIE REFORMPOLITIK UNTER DER ROT-GRÜNEN REGIERUNG
- 3.3.1 DIE RENTENREFORM
- 3.3.2 HARTZ IV ALS REFORMPROJEKT
- 4. DAS GRUND- UND MINDESTSICHERUNGSSYSTEM IN DEUTSCHLAND
- 4.1 DAS SGB II ALS GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE
- 4.1.1 GRUNDSÄTZE DER ARBEITSLOSENHILFE
- 4.1.2 LEISTUNGSBERECHTIGTE
- 4.1.3 LEISTUNGEN NACH DEM SGB II
- 4.1.4 FINANZIERUNG UND TRÄGERSCHAFT
- 4.1.5 KRITIK AM SGB II
- 4.2 DIE SOZIALHILFE (SGB XII) ALS LETZTES NETZ DES SOZIALGESETZBUCHES
- 4.2.1 GRUNDSÄTZE DER SOZIALHILFE
- 4.2.2 LEISTUNGSBERECHTIGTE
- 4.2.3 LEISTUNGEN NACH DEM SGB XII
- 4.2.4 FINANZIERUNG UND TRÄGERSCHAFT
- 4.2.5 KRITIK AM SGB XII
- 4.3 SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN
- 4.1 DAS SGB II ALS GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE
- 5. ARMUT IN DEUTSCHLAND
- 5.1 BEGRIFFLICHKEITEN IM ARMUTSKONTEXT
- 5.2 KINDER- UND JUGENDARMUT IN DEUTSCHLAND
- 5.3 ALTERSARMUT IN DEUTSCHLAND
- 5.4 KRITIK AM 5. ARMUTS- UND REICHTUMSBERICHT DER BUNDESREGIERUNG
- 6. DAS BEDINGUNGSLOSE GRUNDEINKOMMEN IN DEUTSCHLAND
- 6.1 CHARAKTERISIERUNG DER BEGRIFFE UND DEFINITIONEN
- 6.2 DIE IDEE IN POLITIK UND GESELLSCHAFT
- 6.3 FORSCHUNGSSTAND
- 6.4 GRUNDEINKOMMENSMODELLE IN DEUTSCHLAND
- 6.4.1 DAS SOLIDARISCHE BÜRGERGELD (SBG)
- 6.4.1.1 URSPRUNG DES MODELLS
- 6.4.1.2 GRUNDSÄTZE DES MODELLS
- 6.4.1.3 LEISTUNGSBERECHTIGTE
- 6.4.1.4 LEISTUNGEN NACH DEM SBG
- 6.4.1.5 FINANZIERUNG UND TRÄGERSCHAFT
- 6.4.1.6 KRITIK AM MODELL
- 6.4.2 DAS GRUNDEINKOMMEN NACH GÖTZ W. WERNER
- 6.4.2.1 URSPRUNG DES MODELLS
- 6.4.2.2 GRUNDSÄTZE DES MODELLS
- 6.4.2.3 LEISTUNGSBERECHTIGTE
- 6.4.2.4 LEISTUNGEN NACH DEM MODELL
- 6.4.2.5 FINANZIERUNG UND TRÄGERSCHAFT
- 6.4.2.6 KRITIK AM MODELL
- 6.4.1 DAS SOLIDARISCHE BÜRGERGELD (SBG)
- 7. ANALYSE DER BGE-MODELLE AUF IHRE TRAGWEISE HINSICHTLICH DER REALISIERBARKEIT UND ARMUTSBEKÄMPFUNG
- 7.1 FISKALISCHE REALISIERBARKEIT DER BGE-MODELLE
- 7.1.1. DAS SBG NACH DIETER ALTHAUS
- 7.1.2 DAS BGE NACH GÖTZ WERNER
- 7.2 PRÜFUNG DER EIGNUNG VON BGE-MODELLEN HINSICHTLICH DER ARMUTSBEKÄMPFUNG
- 7.2.1 AUSWAHL EINES ARMUTSINDIKATORS
- 7.2.2 FALLBEISPIEL: GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSUCHENDE
- 7.2.2.1 DAS SBG NACH DIETER ALTHAUS IM FALLBEISPIEL
- 7.2.2.2 DAS BGE NACH GÖTZ WERNER IM FALLBEISPIEL
- 7.2.2.3 VERGLEICH DER GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE MIT DEN LEISTUNGEN DER BGE-MODELLE
- 7.2.3 FALLBEISPIEL: GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG
- 7.2.3.1 DAS SBG NACH DIETER ALTHAUS IM FALLBEISPIEL
- 7.2.3.2 DAS BGE NACH GÖTZ WERNER IM FALLBEISPIEL
- 7.2.3.3 VERGLEICH DER GRUNDSICHERUNG IM ALTER MIT DEN LEISTUNGEN DER BGE-MODELLE
- 7.1 FISKALISCHE REALISIERBARKEIT DER BGE-MODELLE
- Entwicklung des deutschen Sozialstaates
- Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) und seine Modelle
- Fiskalische Realisierbarkeit des BGE
- Armutsbekämpfung und Auswirkungen des BGE auf verschiedene Bevölkerungsgruppen
- Vergleich des BGE mit den bestehenden sozialen Sicherungssystemen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Master-Thesis untersucht die Realisierbarkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland und dessen Eignung zur Bekämpfung von Armut im Vergleich zu den bestehenden sozialen Sicherungssystemen. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des deutschen Sozialstaates, die verschiedenen Modelle des bedingungslosen Grundeinkommens und deren fiskalische Tragfähigkeit sowie die Auswirkungen auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, insbesondere im Hinblick auf Armutsindikatoren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit vor und erläutert die Vorgehensweise. Kapitel 2 behandelt das Sozialstaatsprinzip in der Bundesrepublik Deutschland und umfasst die Themengebiete des Sozialstaates, der Sozialpolitik und des Rechts der sozialen Sicherheit. Kapitel 3 beleuchtet die Entwicklung des deutschen Sozialstaates vom Deutschen Kaiserreich bis zum 2. Weltkrieg und die Weiterentwicklung nach dem 2. Weltkrieg bis zur Gegenwart. Das Kapitel beinhaltet auch die Reformpolitik unter der rot-grünen Regierung mit Fokus auf die Rentenreform und das Hartz-IV-Projekt. Kapitel 4 analysiert das Grund- und Mindestsicherungssystem in Deutschland, wobei die Leistungen des SGB II und SGB XII im Detail betrachtet werden. Im Fokus stehen die Grundprinzipien, Leistungsberechtigte, Leistungen und die Finanzierung sowie Kritikpunkte der jeweiligen Sicherungssysteme. Kapitel 5 befasst sich mit dem Thema Armut in Deutschland, wobei die Begrifflichkeiten im Armutskontext, die Kinder- und Jugendarmut sowie die Altersarmut beleuchtet werden. Kapitel 6 führt das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland ein, beleuchtet die verschiedenen Modelle des BGE und erläutert deren Ursprung, Grundprinzipien, Leistungsberechtigte und Leistungen. Darüber hinaus werden Finanzierungsmodelle und Kritikpunkte an den einzelnen Modellen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Sozialstaat, Sozialpolitik, Recht der sozialen Sicherheit, Armut, Armutsbekämpfung, bedingungsloses Grundeinkommen, BGE, Solidaritätsprinzip, fiskalische Tragfähigkeit, SGB II, SGB XII, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Rentenreform, Hartz IV, Kinder- und Jugendarmut, Altersarmut, Reichtumsbericht der Bundesregierung, Modellanalysen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens (BGE)?
Es ist eine staatliche Unterstützung (z. B. 1000 Euro), die ohne Gegenleistung oder Bedürftigkeitsprüfung an alle Bürger ausgezahlt wird, um Chancengleichheit zu schaffen.
Welche BGE-Modelle werden in Deutschland diskutiert?
Die Arbeit analysiert insbesondere das "Solidarische Bürgergeld" von Dieter Althaus und das Modell von Götz W. Werner.
Ist ein Grundeinkommen in Deutschland fiskalisch realisierbar?
Die Master-Thesis untersucht kritisch die fiskalische Tragfähigkeit der Modelle und vergleicht sie mit dem aktuellen System (SGB II/XII).
Kann das BGE Armut in Deutschland wirksam bekämpfen?
Die Arbeit prüft die Eignung der Modelle anhand von Armutsindikatoren und Fallbeispielen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Warum wird das aktuelle Sozialsystem kritisiert?
Kritiker sehen es als veraltet an und führen Probleme wie Altersarmut, Kinderarmut und die Folgen des demografischen Wandels auf defizitäre Strukturen zurück.
- Arbeit zitieren
- Igor Weiß (Autor:in), 2018, Das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/416979